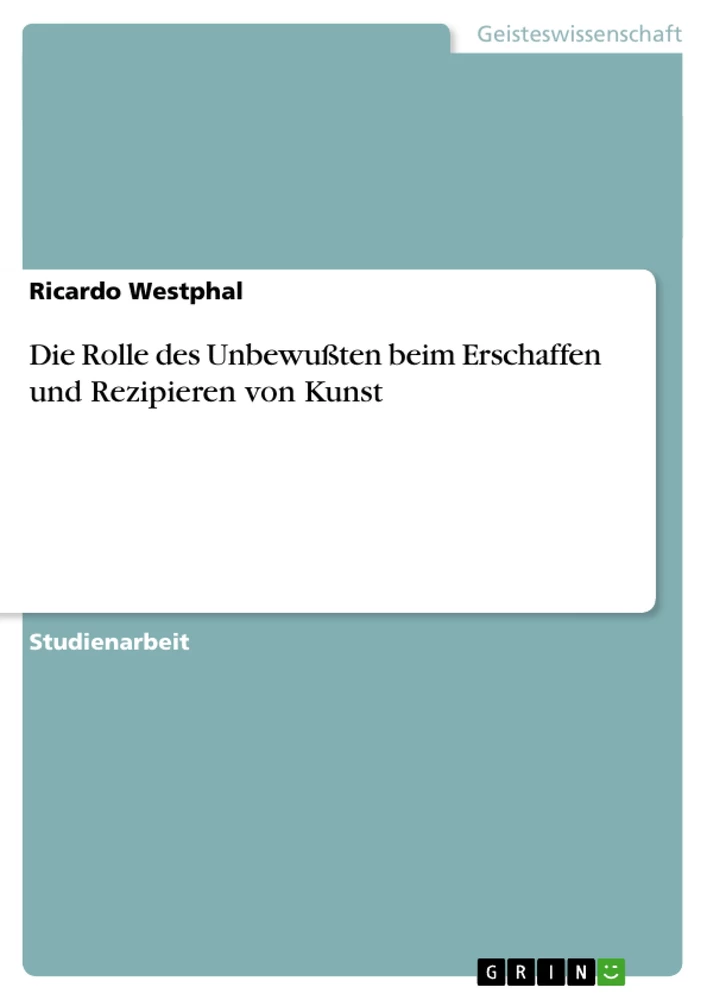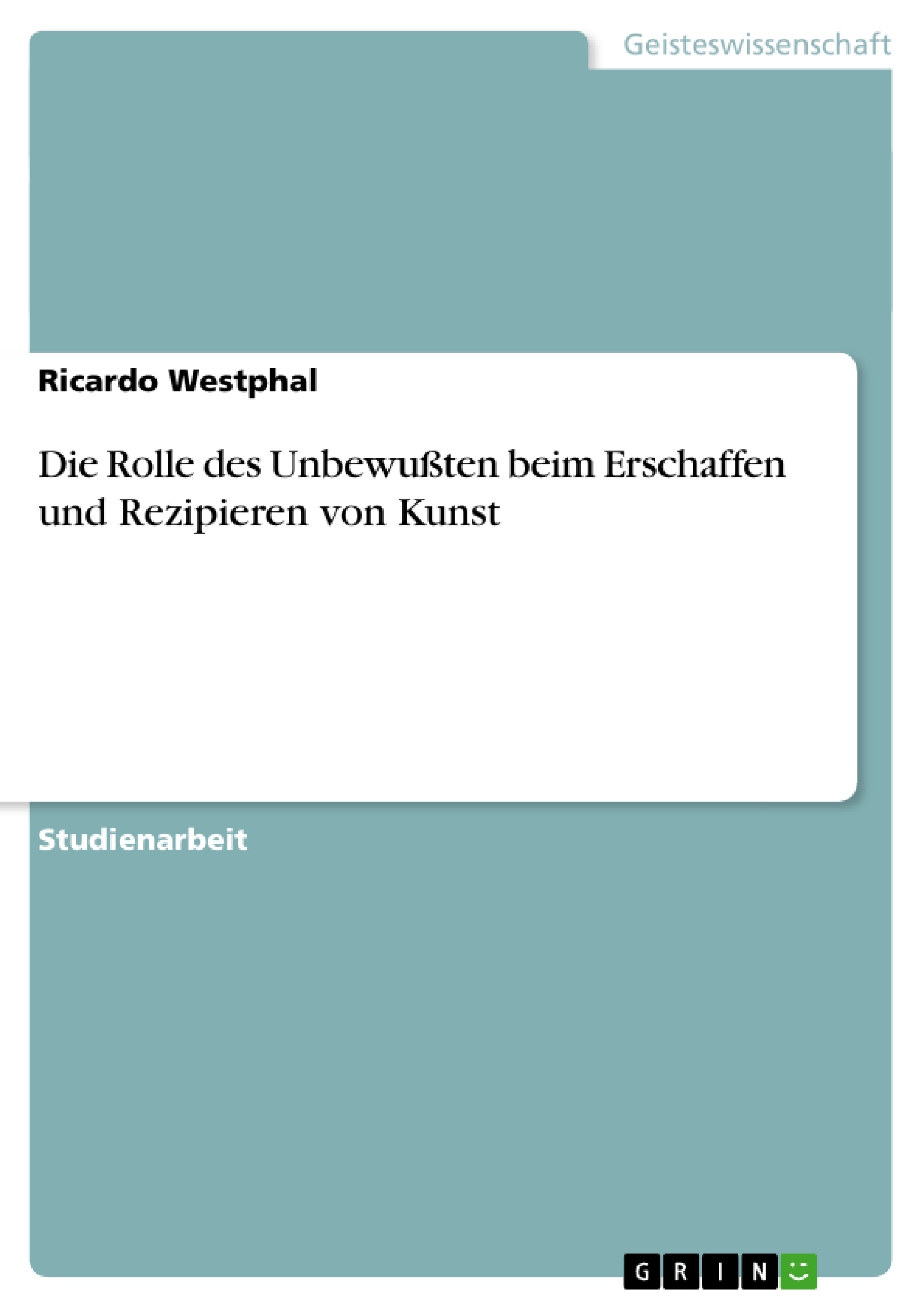An Kunstwerken und deren Schaffen oder Betrachten hatte bereits Freud großes Interesse. Die Psychoanalyse ist mehr am Inhalt als an der Form eines Kunstwerks interessiert und weist dem Unbewußtsein dabei eine große Rolle zu. Deutlich wird dies schon dadurch, daß die meisten Menschen kaum in der Lage sind, ein Kunsterlebnis mit Worten auszudrücken.
Da zwischen dem Unbewußten und dem Bewußtsein ein dynamischer Zusammenhang besteht, liegt es nahe, daß sich die Vorgänge im Unbewußten durch Kunstwerke am klarsten äußern können. Sie können also dazu dienen, Verdrängtes freizulegen.
Anders gesagt laufen beim Schaffen und Rezipieren von Kunst unbewußte Prozesse ab, die in den Inhalt eines Kunstwerks einfließen oder den Betrachter unbewußt beeinflussen
Die wichtigsten psychoanalytischen Theorien dazu, werden in dieser Arbeit beleuchtet: Beginnend bei Freud bis zu den Lehren gegenwärtiger Wissenschaftler. Außerdem wird auf die Methoden der mit der Psychoanalyse engverwandten Kunsttherapie eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Freuds Auffassung über die Wirkung von Kunst
- Alfred Adlers und Carl Gustav Jungs Ansichten über die Kunst
- Kreativität und Kunst aus Sicht der Psychoanalyse seit 1960
- Anton Ehrenzweig (1967)
- Hans Müller-Braunschweig (1977)
- Hans & Shulamith Kreitler (1980)
- Kunsttherapie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Rolle des Unbewußten im Schaffen und der Rezeption von Kunst aus psychoanalytischer Perspektive zu untersuchen. Die Entwicklung der psychoanalytischen Theorien zur Kunst von Freud bis zu gegenwärtigen Wissenschaftlern wird nachgezeichnet. Dabei wird auch die Kunsttherapie als eng verwandtes Feld beleuchtet.
- Das Unbewußte als zentrale Instanz in der Kunstproduktion und -rezeption
- Freuds Konzepte der Sublimierung und Triebverzicht im Kontext von Kunst
- Vergleichende Betrachtung der Ansichten Freuds, Adlers und Jungs zur Kunst
- Entwicklung der psychoanalytischen Kunsttheorie seit 1960
- Die Bedeutung der Kunsttherapie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die psychoanalytische Theorie des Unbewußten ein und beschreibt dessen zentrale Rolle in Freuds Werk. Sie betont die Bedeutung des Unbewußten sowohl für das Verhalten als auch für die Kunst, wobei der Fokus auf der Wirkung von Kunstwerken und deren unbewußten Ursachen liegt. Die Arbeit kündigt an, die Entwicklung der psychoanalytischen Kunsttheorie von Freud bis in die Gegenwart zu verfolgen.
Freuds Auffassung über die Wirkung von Kunst: Dieses Kapitel beschreibt Freuds Sichtweise auf Kunst als eine Form der Sublimierung, bei der unbewußte Wünsche und Triebe in gesellschaftlich akzeptierte Kanäle umgelenkt werden. Freud betrachtet Kunst als eine Möglichkeit, das durch gesellschaftliche Normen und Werte verursachte Leid zu lindern, indem sie eine stellvertretende Triebbefriedigung im Phantasiebereich ermöglicht. Allerdings ist diese Befriedigung weniger intensiv als die direkte Befriedigung primärer Triebe und nicht allen Menschen zugänglich. Freuds Analyse konzentriert sich vor allem auf Kunstwerke mit triebrelevanten Inhalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Psychoanalytische Perspektiven auf Kunst
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Unbewußten in der Entstehung und Wahrnehmung von Kunst aus psychoanalytischer Sicht. Sie verfolgt die Entwicklung psychoanalytischer Kunsttheorien von Freud bis in die Gegenwart und beleuchtet die Kunsttherapie als verwandtes Feld.
Welche psychoanalytischen Ansätze werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ansichten von Sigmund Freud, Alfred Adler und Carl Gustav Jung zur Kunst. Darüber hinaus werden neuere psychoanalytische Kunsttheorien seit 1960 von Autoren wie Anton Ehrenzweig, Hans Müller-Braunschweig und Hans & Shulamith Kreitler diskutiert.
Welche zentralen Themen werden untersucht?
Zentrale Themen sind das Unbewußte als Instanz in Kunstproduktion und -rezeption, Freuds Konzepte der Sublimierung und des Triebverzichts im Kontext von Kunst, ein Vergleich der Ansichten Freuds, Adlers und Jungs, die Entwicklung der psychoanalytischen Kunsttheorie seit 1960 und die Bedeutung der Kunsttherapie.
Wie beschreibt Freud die Wirkung von Kunst?
Freud betrachtet Kunst als Sublimierung, bei der unbewußte Wünsche und Triebe in gesellschaftlich akzeptierte Formen umgewandelt werden. Kunst bietet eine stellvertretende Triebbefriedigung im Phantasiebereich und lindert so das durch gesellschaftliche Normen verursachte Leid. Diese Befriedigung ist jedoch weniger intensiv als die direkte Triebbefriedigung und nicht jedem zugänglich. Freuds Analysen konzentrieren sich auf Kunstwerke mit triebrelevanten Inhalten.
Welche weiteren Autoren werden behandelt und was sind ihre Beiträge?
Neben Freud werden die Ansichten von Alfred Adler und Carl Gustav Jung zum Thema Kunst vergleichend betrachtet. Die Arbeit analysiert außerdem die Entwicklung der psychoanalytischen Kunsttheorie seit 1960, mit Fokus auf die Beiträge von Anton Ehrenzweig (1967), Hans Müller-Braunschweig (1977) und Hans & Shulamith Kreitler (1980).
Welche Rolle spielt die Kunsttherapie?
Die Kunsttherapie wird als eng verwandtes Feld zur psychoanalytischen Kunsttheorie beleuchtet und ihre Bedeutung im Kontext der Arbeit diskutiert. Sie wird jedoch nicht im Detail behandelt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Freuds Auffassung von Kunst, den Ansichten Adlers und Jungs, der Entwicklung der psychoanalytischen Kunsttheorie seit 1960 (mit Unterkapiteln zu Ehrenzweig, Müller-Braunschweig und Kreitler), einem Kapitel zur Kunsttherapie und einem Fazit.
- Quote paper
- Ricardo Westphal (Author), 2005, Die Rolle des Unbewußten beim Erschaffen und Rezipieren von Kunst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46245