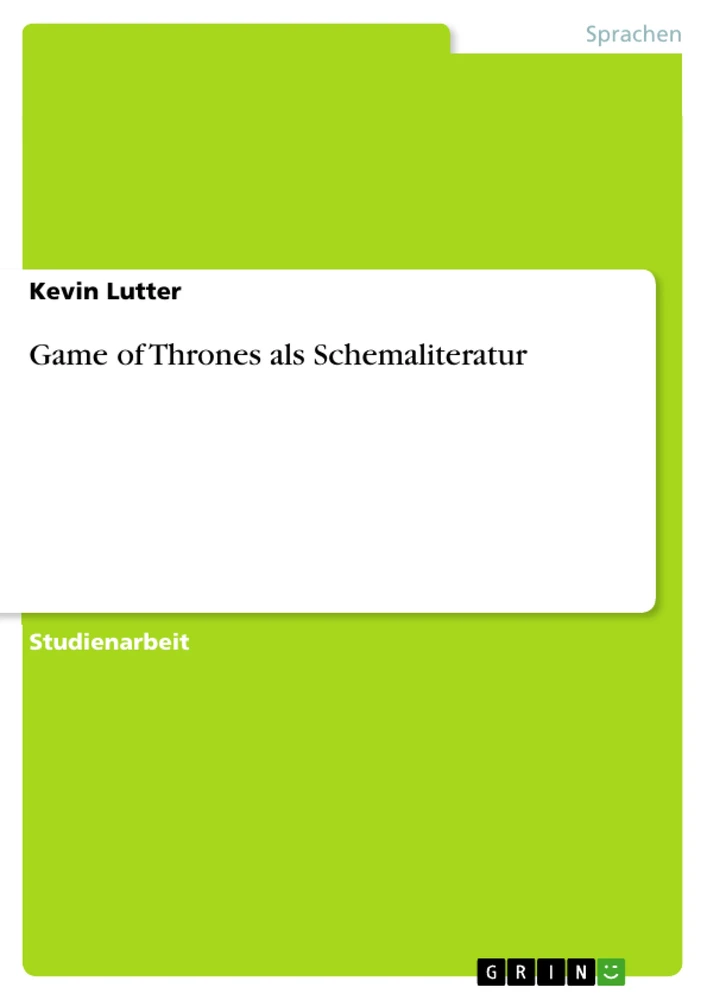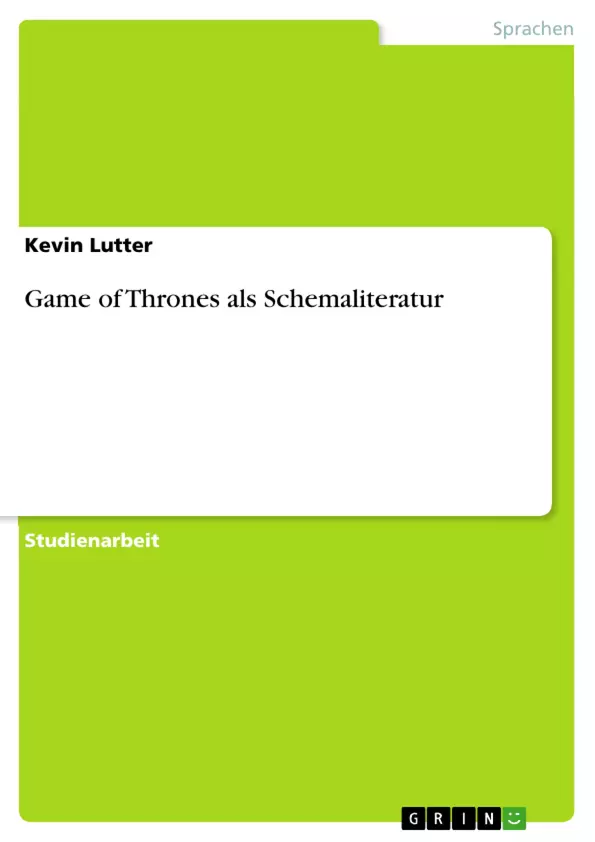Ziel dieser Arbeit ist es, die von Martin geschaffenen Figuren mit dem gattungstypischen Schema zu vergleichen und Abweichungen aufzuzeigen. Als Primärliteratur wird auf die deutsche Übersetzung von Game of Thrones zurückgegriffen, weil eine semantische Auseinandersetzung auf Wortebene für diesen Zweck nicht erforderlich ist. Außerdem dient das Werk Der Herr der Ringe von J. R. R. Tolkien als Vergleichsobjekt, weil es als Grundstein der modernen Fantasyliteratur gilt.
Da in diesem Forschungsgebiet noch kein begrifflicher Konsens herrscht, wird zunächst eine Definition von Fantasyliteratur erarbeitet. Daraufhin erfolgen eine gattungskonforme Darstellung von Helden sowie die binäre Figureneinteilung in Gut und Böse in der High Fantasy. Auf dieser Grundlage werden exemplarisch verschiedene Figuren aus Game of Thrones herangezogen und mit den zugrundeliegenden Kriterien verglichen. Im Fazit werden die zentralen Ergebnisse zusammengefasst und kritisch reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einordnung von Fantasyliteratur
- Das Schema in der Fantasyliteratur
- Der Held und seine Quest
- Binäre Gut-Böse-Beziehungen
- Heterogene Helden
- Eddard Stark
- Jon Schnee
- Daenerys Targaryen
- Ergebnis
- Figuren zwischen Gut und Böse
- Theon Graufreud
- Jaime Lennister
- Ergebnis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht, wie George R. R. Martins "Game of Thrones" von den typischen Schemata der Fantasyliteratur abweicht. Die Arbeit vergleicht die Figuren der Reihe mit den gängigen Helden- und Bösewicht-Archetypen der High Fantasy und analysiert, inwieweit Martin diese Konventionen aufbricht.
- Abweichungen der Heldenfiguren in "Game of Thrones" vom Gattungsschema
- Analyse der ambivalenten Figuren und deren Positionierung zwischen Gut und Böse
- Vergleich von "Game of Thrones" mit etablierten Werken der High Fantasy (z.B. "Der Herr der Ringe")
- Definition und Einordnung von Fantasyliteratur
- Untersuchung der narrativen Techniken in "Game of Thrones"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt "Game of Thrones" als Werk, das die Stereotype der High Fantasy durchbricht. Sie benennt den Forschungsdefizit im Bereich der Fantasy-Literatur und formuliert die Forschungsfragen der Arbeit: Inwiefern weichen die Helden in "Game of Thrones" vom Gattungsschema ab? Inwieweit lassen sich die Figuren in "Game of Thrones" in Gut und Böse einteilen? Die Arbeit zielt darauf ab, die Figuren Martins mit dem gattungstypischen Schema zu vergleichen und Abweichungen aufzuzeigen. "Der Herr der Ringe" dient als Vergleichsobjekt.
Einordnung von Fantasyliteratur: Dieses Kapitel definiert Fantasyliteratur, wobei die Schwierigkeiten der Einordnung aufgrund der Überschreitung und Kombination von Kriterien hervorgehoben werden. Es charakterisiert Fantasy als fiktionale Erzählung mit übernatürlichen Elementen, die eine Konfrontation zwischen Gut und Böse darstellt. Ein männlicher Held begleitet den Leser durch eine imaginäre Welt, die sich von der realen Welt abgrenzt und einen vollständigen Weltentwurf darstellt, im Gegensatz zu Märchen. Magie ist ein selbstverständlicher Bestandteil, der bestimmten Regeln folgt.
Schlüsselwörter
Game of Thrones, George R. R. Martin, Fantasyliteratur, High Fantasy, Held, Archetyp, Gut und Böse, Schemaliteratur, narrative Technik, Charakteranalyse, Figurenzeichnung, Komplexität.
Game of Thrones Seminararbeit: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht, wie George R. R. Martins "Game of Thrones" von den typischen Schemata der Fantasyliteratur abweicht. Im Fokus steht der Vergleich der Figuren der Reihe mit den gängigen Helden- und Bösewicht-Archetypen der High Fantasy und die Analyse, inwieweit Martin diese Konventionen aufbricht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Abweichungen der Heldenfiguren von Gattungsschemata, Analyse ambivalenter Figuren und deren Positionierung zwischen Gut und Böse, Vergleich mit etablierten Werken der High Fantasy (z.B. "Der Herr der Ringe"), Definition und Einordnung von Fantasyliteratur sowie die Untersuchung der narrativen Techniken in "Game of Thrones".
Welche Figuren werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Figuren aus "Game of Thrones", darunter sowohl klassische "Helden" wie Eddard Stark, Jon Schnee und Daenerys Targaryen, als auch ambivalente Figuren wie Theon Graufreud und Jaime Lennister, um deren Positionierung zwischen Gut und Böse zu untersuchen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Einordnung der Fantasyliteratur, Kapitel zur Analyse der Heldenfiguren und ambivalenter Figuren, sowie ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit gestellt?
Die zentralen Forschungsfragen lauten: Inwiefern weichen die Helden in "Game of Thrones" vom Gattungsschema ab? Inwieweit lassen sich die Figuren in "Game of Thrones" in Gut und Böse einteilen?
Wie wird "Game of Thrones" in der Arbeit eingeordnet?
Die Arbeit betrachtet "Game of Thrones" als ein Werk, das die Stereotype der High Fantasy durchbricht. Es wird im Vergleich zu etablierten Werken der High Fantasy wie "Der Herr der Ringe" analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Game of Thrones, George R. R. Martin, Fantasyliteratur, High Fantasy, Held, Archetyp, Gut und Böse, Schemaliteratur, narrative Technik, Charakteranalyse, Figurenzeichnung, Komplexität.
Welche Definition von Fantasyliteratur wird verwendet?
Die Arbeit definiert Fantasyliteratur als fiktionale Erzählung mit übernatürlichen Elementen, die eine Konfrontation zwischen Gut und Böse darstellt. Ein männlicher Held begleitet den Leser durch eine imaginäre Welt, die sich von der realen Welt abgrenzt und einen vollständigen Weltentwurf darstellt. Magie ist ein selbstverständlicher Bestandteil mit bestimmten Regeln.
- Quote paper
- Kevin Lutter (Author), 2017, Game of Thrones als Schemaliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461953