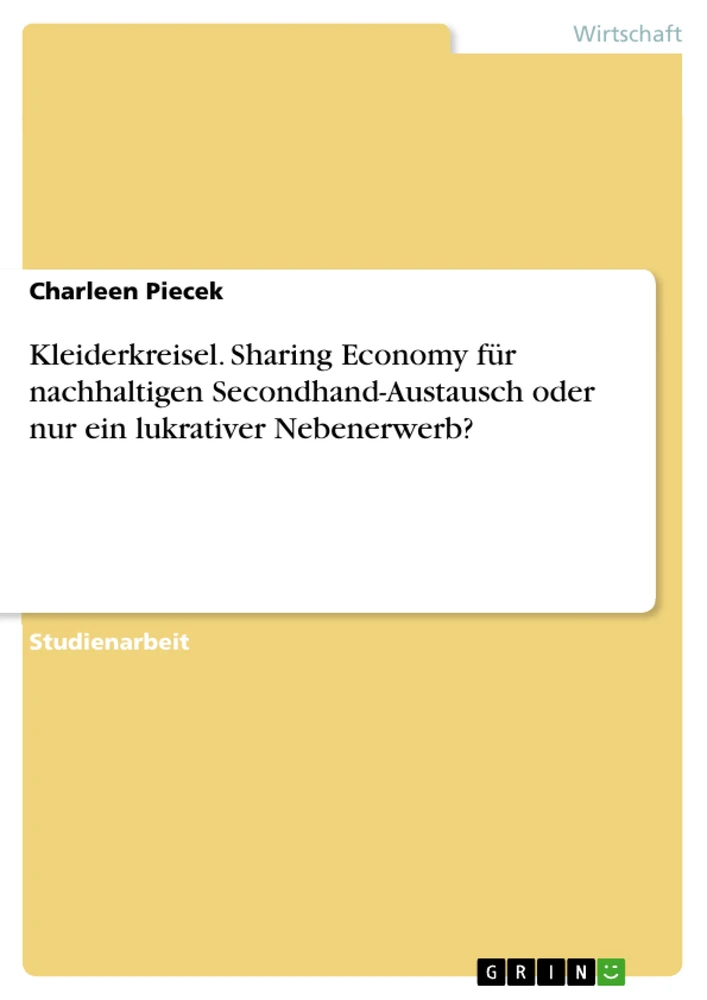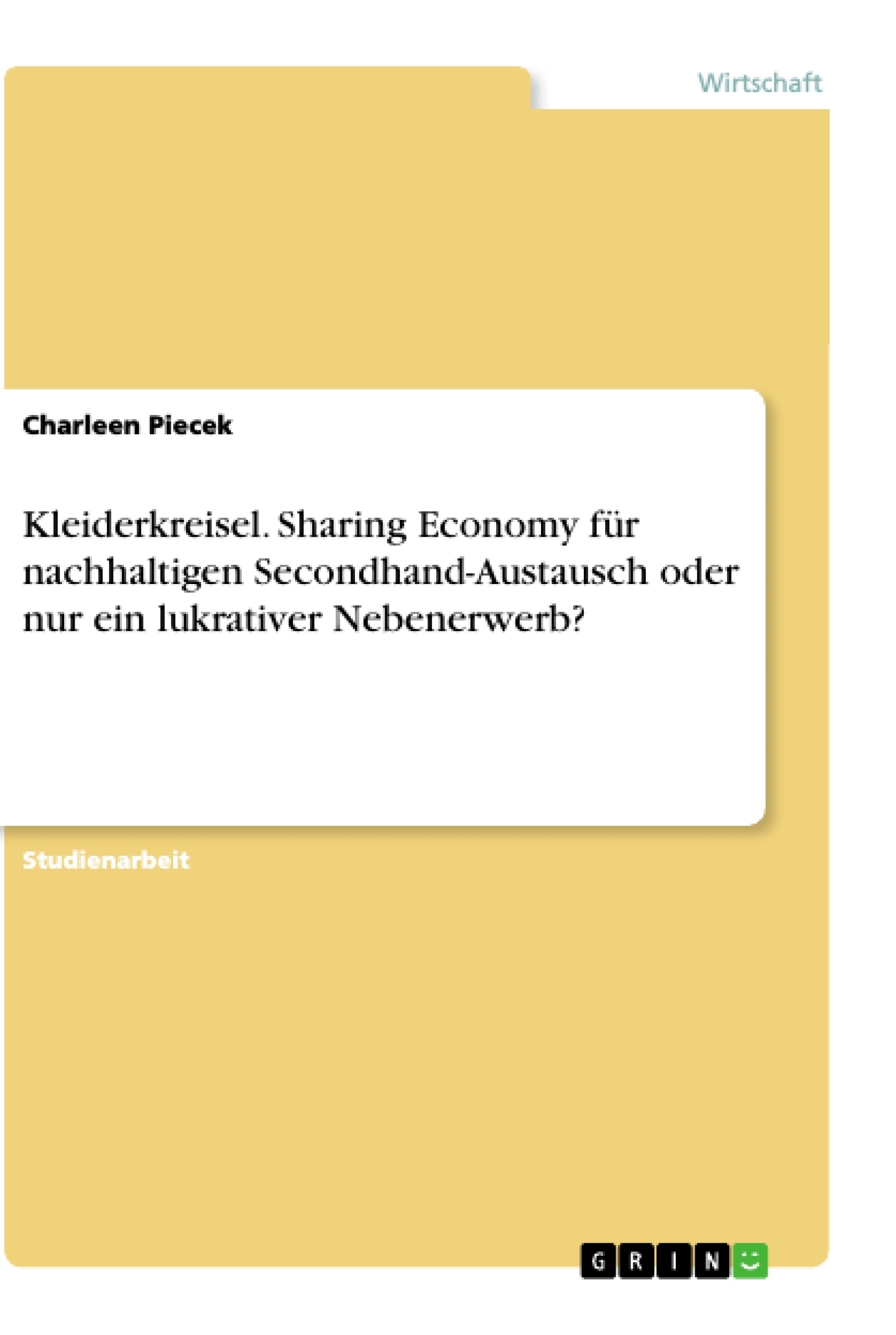Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem E-Business Geschäftsmodell des Unternehmens Kleiderkreisel GmbH und den Motiven der Nutzer. Zunächst werden theoretische Grundlagen geliefert, die die Analyse des Geschäftsmodells ermöglichen. Es werden daraufhin die für das Geschäftsmodell relevante Technologie sowie Wettbewerbsvorteile in Anbetracht der Wettbewerber auf dem Markt diskutiert. Abschließend folgt Kritik am Geschäftsmodell, das Erörtern der Nutzermotive, und das vermutete Potential des Geschäftsmodells.
Der Trend des geteilten Konsums begann im Alltagsleben bereits vor einer langen Zeit mit Allmenden, Bibliotheken und Videotheken. Durch die digitale Revolution entwickelten sich, angeknüpft an diese Grundidee des Teilens und Tauschens, Dienste wie Napster (File Sharing), Wikipedia und das „Kleiderkreiseln“.
Nach einer Befragung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC stehen 70 Prozent der deutschen Bürger den Angeboten der Sharing Economy positiver gegenüber als denen der klassischen Anbieter. Sind die Geschäfte der Sharing Economy, aus Anbieter- und Konsumentensicht, jedoch wirklich so sozial motiviert wie sie scheinen?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Sharing Economy – Die Ökonomie des Teilens
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Sharing Economy
- 2.2 Geschäftsmodelle im E-Business
- 2.2.1 Geschäftsmodell nach Osterwalder und Pigneur
- 2.2.2 Geschäftsmodell nach Wirtz
- 2.2.3 Geschäftsmodell nach Schallmo
- 2.2.4 Vergleich und Auswahl Geschäftsmodell
- 2.3 Wertschöpfung
- 2.3.1 Ressourcenorientierter Ansatz
- 2.3.2 Wissensorientierter Ansatz
- 3 Kleiderkreisel GmbH
- 3.1 Geschäftsmodellanalyse nach Osterwalder und Pigneur
- 3.2 Technische Umsetzung
- 3.2.1 Elektronischer Geschäftsprozess: Kauf eines Artikels
- 3.2.2 GPS App-Funktion
- 3.3 Wettbewerbsvorteile Kleiderkreisel
- 4 Fazit
- 4.1 Nutzermotive beim Kreiseln
- 4.2 Kritik am Geschäftsmodell
- 4.3 Potential für die Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das E-Business-Geschäftsmodell der Kleiderkreisel GmbH im Kontext der Sharing Economy. Ziel ist es, die Nutzermotive zu ergründen und das Geschäftsmodell kritisch zu beleuchten, seine Wettbewerbsvorteile zu identifizieren und das Zukunftspotential zu bewerten.
- Analyse des Kleiderkreisel-Geschäftsmodells im Kontext der Sharing Economy
- Untersuchung der Nutzermotivationen (Kauf, Verkauf, Tausch)
- Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit von Kleiderkreisel
- Kritische Auseinandersetzung mit den sozialen und wirtschaftlichen Aspekten des Modells
- Prognose des zukünftigen Potentials von Kleiderkreisel
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Sharing Economy – Die Ökonomie des Teilens: Die Einleitung führt in die Thematik der Sharing Economy ein und beleuchtet den Wandel vom Besitz zum Nutzen. Sie stellt die Kleiderkreisel GmbH als Fallbeispiel vor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der von theoretischen Grundlagen über die Geschäftsmodellanalyse bis hin zur Kritik und Zukunftsprognose reicht. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Nutzermotive und der Frage nach der tatsächlichen sozialen Motivation hinter der Plattform.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die Analyse des Kleiderkreisel-Geschäftsmodells. Es werden verschiedene Definitionen und Konzepte der Sharing Economy diskutiert, gefolgt von einer Erörterung verschiedener Geschäftsmodellansätze (Osterwalder/Pigneur, Wirtz, Schallmo), um ein geeignetes Modell für die spätere Analyse auszuwählen. Schließlich werden der ressourcenorientierte und der wissensorientierte Ansatz der Wertschöpfung vorgestellt.
3 Kleiderkreisel GmbH: Dieses Kapitel präsentiert die Kleiderkreisel GmbH, ihre Geschichte, Rechtsform und den Bezug zum Mutterunternehmen Vinted. Es wird die Plattform als Secondhand-Markt beschrieben und deren Mission erläutert. Der Hauptteil fokussiert sich auf die detaillierte Geschäftsmodellanalyse nach Osterwalder und Pigneur, unter Berücksichtigung der Einnahmequellen, Schlüsselressourcen, -aktivitäten und -partnerschaften. Die technische Umsetzung, insbesondere der Kaufprozess und die GPS-App-Funktion, werden ebenfalls erläutert. Abschließend werden die Wettbewerbsvorteile von Kleiderkreisel im Vergleich zu anderen Plattformen diskutiert.
Schlüsselwörter
Sharing Economy, Secondhand-Markt, Kleiderkreisel, Geschäftsmodellanalyse, Nutzermotive, Nachhaltigkeit, E-Business, Wettbewerbsvorteile, Osterwalder/Pigneur, Wertschöpfung, Ressourcenorientierter Ansatz, Wissensorientierter Ansatz, Peer-to-Peer, Community.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: "Kleiderkreisel GmbH: Geschäftsmodellanalyse im Kontext der Sharing Economy"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert das Geschäftsmodell der Kleiderkreisel GmbH im Kontext der Sharing Economy. Sie untersucht die Nutzermotive, die Wettbewerbsvorteile, die kritischen Aspekte des Modells und das Zukunftspotential der Plattform.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Definitionen und Konzepte der Sharing Economy. Es werden verschiedene Geschäftsmodellansätze nach Osterwalder/Pigneur, Wirtz und Schallmo erläutert und verglichen. Zusätzlich werden der ressourcenorientierte und der wissensorientierte Ansatz der Wertschöpfung betrachtet.
Wie wird das Geschäftsmodell von Kleiderkreisel analysiert?
Das Geschäftsmodell von Kleiderkreisel wird detailliert anhand des Business Model Canvas nach Osterwalder und Pigneur analysiert. Die Analyse umfasst Einnahmequellen, Schlüsselressourcen, -aktivitäten und -partnerschaften. Die technische Umsetzung, insbesondere der Kaufprozess und die GPS-App-Funktion, werden ebenfalls beschrieben.
Welche Nutzermotive werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Motive der Nutzer, die Kleiderkreisel zum Kauf, Verkauf oder Tausch von Kleidung nutzen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage nach der sozialen Motivation hinter der Nutzung der Plattform.
Welche Wettbewerbsvorteile hat Kleiderkreisel?
Die Hausarbeit identifiziert die Wettbewerbsvorteile von Kleiderkreisel im Vergleich zu anderen Plattformen. Diese werden im Kontext der Analyse des Geschäftsmodells diskutiert.
Welche Kritikpunkte werden an dem Geschäftsmodell geäußert?
Die Arbeit enthält eine kritische Auseinandersetzung mit dem Geschäftsmodell von Kleiderkreisel, unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte.
Wie wird das Zukunftspotential von Kleiderkreisel bewertet?
Die Hausarbeit beinhaltet eine Prognose des zukünftigen Potentials von Kleiderkreisel basierend auf den vorherigen Analysen und der Kritik des Geschäftsmodells.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, einem Kapitel zur Analyse von Kleiderkreisel, und einem Fazit, welches Nutzermotive, Kritikpunkte und Zukunftspotentiale umfasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sharing Economy, Secondhand-Markt, Kleiderkreisel, Geschäftsmodellanalyse, Nutzermotive, Nachhaltigkeit, E-Business, Wettbewerbsvorteile, Osterwalder/Pigneur, Wertschöpfung, Ressourcenorientierter Ansatz, Wissensorientierter Ansatz, Peer-to-Peer, Community.
- Quote paper
- Charleen Piecek (Author), 2018, Kleiderkreisel. Sharing Economy für nachhaltigen Secondhand-Austausch oder nur ein lukrativer Nebenerwerb?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461647