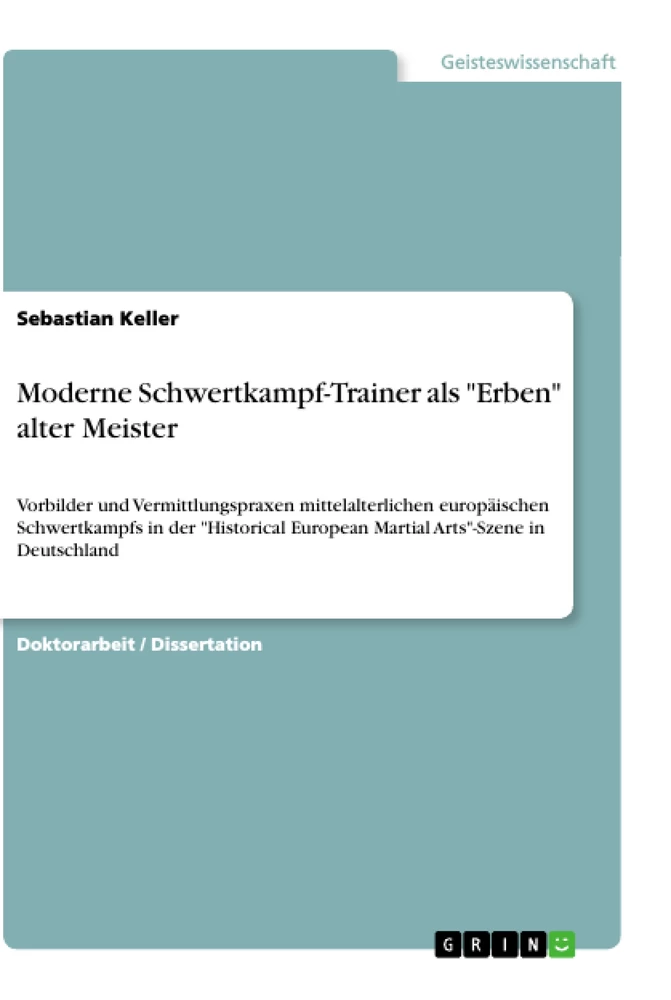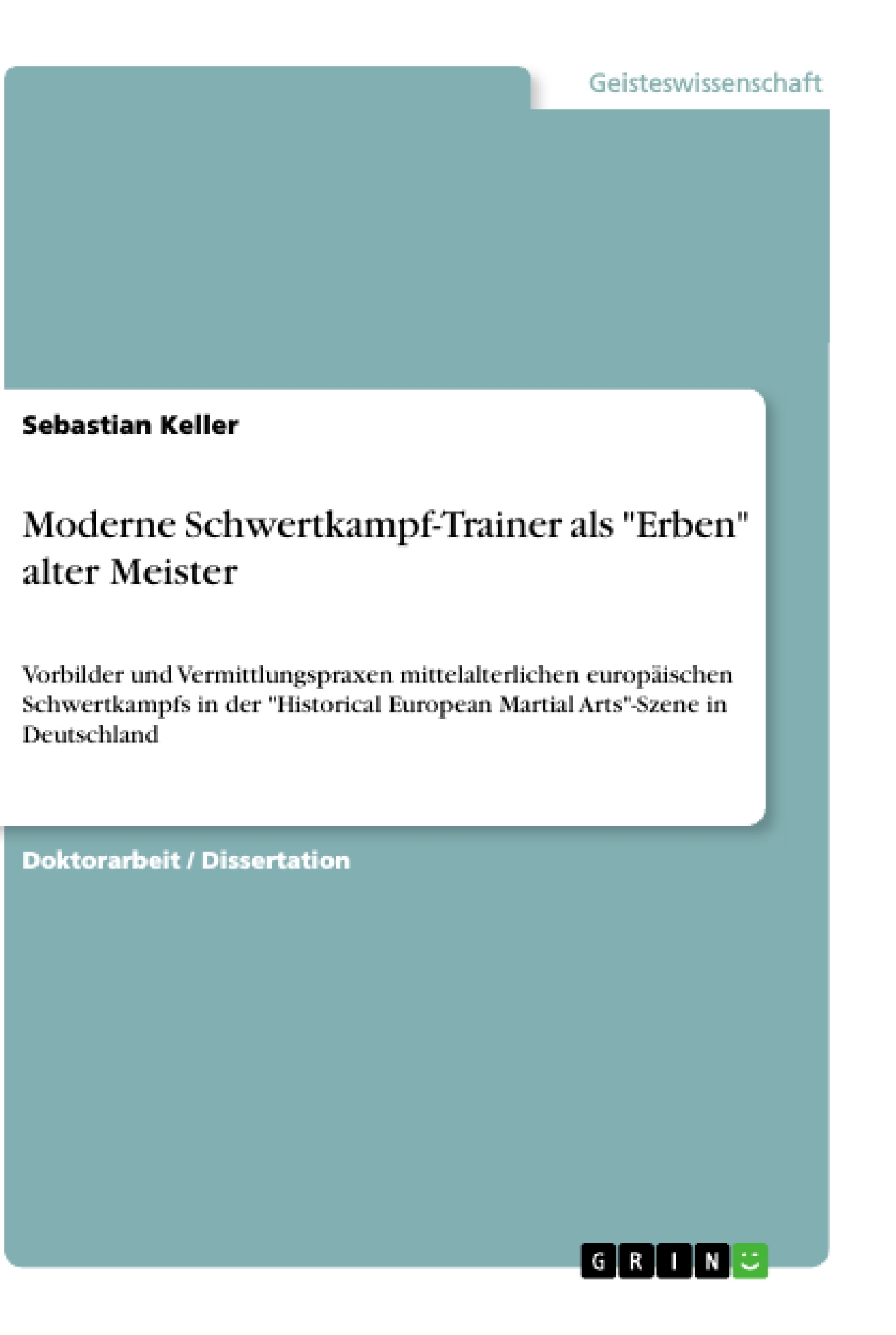Die Dissertation gibt einen Überblick über die Entstehung der modernen HEMA-Szene, die historischen Fechtbücher und Fechtergesellschaften, die heute als Vorbilder dienen können. Die Arbeit untersucht am Beispiel von Trainern in Deutschland, wie historische Quellen für eine ‚Invention of Tradition‘ (Hobsbawn und Ranger) genutzt werden.
Die wichtigsten Forschungsmethoden waren die Teilnehmende Beobachtung, Interviews mit Trainern und die Analyse der von ihnen verfassten Ratgeberliteratur. Dabei werden trotz lückenhafter Quellen die Unterschiede zu historischen Verfassern von Fechtbüchern und Fechtergesellschaften deutlich. Ein offensichtliches Beispiel ist die HEMA-Schutzausrüstung, die speziell entwickelt wird. Sie hat kein historisches Vorbild.
Der historische Teil der Dissertation weist nach, dass es während der Romantik im 19. Jahrhundert und um die Wende zum 20. Jahrhundert schon einmal Bemühungen um eine Renaissance der mittelalterlichen Kampfkünste gab, die allerdings im Vergleich zur HEMA-Szene kurzlebig und mit stark beschränkter Wirkung blieben. Auf die heutige Szene haben diese Vorbilder nur marginalen Einfluss.
Die zentralen Fragen der Arbeit sind: Was ist die Bedeutung eines Trainers in der HEMA-Szene? Ist er ein Meister, ‚Sensei‘, Anleiter, Unternehmer, Wissenschaftler oder (spirituelles) Vorbild? Wie werden Gender und Körperbilder konkretisiert? Welche Objektivationen lassen sich in HEMA finden und was sagen sie über das Verhältnis zum Mittelalter und zur heutigen Lebenswirklichkeit der Akteure aus? Wie lassen sich HEMA im Kontext von Kampfsport und Kampfkunst verorten?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Die Rückkehr der Schwertmeister?
- 1.1 Motivation, Fragestellung und Relevanz
- 1.2 Methoden, Vorgehensweise und Kritik
- 1.3 Nomenklatur
- 1.4 Forschungsgeschichte
- 1.4.1 Sport, Spektakel und Germanistik um 1900
- 1.4.2 Nationalstolz in Philologie, Rechts- und Geschichtswissenschaft (1762-1870)
- 1.4.3 Die Kontroverse der Fechter Wassmannsdorff (1821-1906) und Hergsell (1847-1914) zwischen 1870 und 1894
- 1.4.4 Forschungsstand ab 1935
- 2 Die historischen Vorbilder: Gerichtskämpfe, Sport und „ritterliche Kunst“
- 2.1 Fechtbücher und Fechter (ab 13. Jh.)
- 2.1.1 Die Gesellschaft Liechtenauers und die Fechtbruderschaften (14.–17. Jh.)
- 2.1.2 Die London Company of Maisters of the Science of Defence (16. Jh.)
- 2.1.3 Die Fechtmeister zwischen Katzenritter und Hofamt (16. Jh.)
- 2.1.4 Die Fechtschulen der Marxbrüder und Federfechter (16. - 17. Jh.)
- 2.1.5 Die universitären Fechtmeister (16.-18. Jh.)
- 2.2 Die erste Renaissance: Romantiker, Patrioten und Exoten (1839 – um 1900)
- 2.2.1 Das Eglinton Tournament (1839) und andere „Mittelalter-Veranstaltungen“
- 2.2.2 Bartitsu, Selbstverteidigung und Schaukämpfe (um 1900)
- 2.3 Hollywoods Fencing Master (ab ca. 1920) und Deutschland bis 1945
- 3 Die zweite Renaissance: Western Martial Arts / Historical European Martial Arts (ab den 1980ern - heute)
- 3.1 Ursprünge der Szene und ihrer Trainer
- 3.1.1 Der organisatorische Rahmen: Kampfsport
- 3.1.2 Die Kampferfahrung: Reenactment / Living History
- 3.1.3 Das Lebensgefühl: Mittelalterszene
- 3.1.4 Die Kreativität: Live Action Role Playing (LARP)
- 3.2 HEMA: Sport, Kampf(kunst), Handwerk, Traditionspflege
- 3.2.1 Die Szene: Entwicklung, Strukturen, Akteure und Aktivitäten
- 3.2.1.1 Entwicklung der Szene
- 3.2.1.2 Benennung: Historisches Fechten, WMA, HEMA
- 3.2.1.3 Größe, Zusammensetzung und internationale Verbreitung
- 3.2.1.4 Aktivitäten: Training, Seminare, Turniere
- 3.2.1.5 Spiritualität und Etikette
- 3.2.1.6 Strukturen und Zusammenschlüsse
- 3.2.1.7 Kommerzielle Aspekte: HEMA als Branche
- 3.2.2 Sachkultur und Disziplinen der Szene
- 3.2.2.1 Sportgeräte, Waffen und waffenlose Disziplinen
- 3.2.2.1.1 Schwert und Fechtfeder
- 3.2.2.1.2 Einhandwaffen
- 3.2.2.1.3 Andere Disziplinen
- 3.2.2.1.4 Materialien
- 3.2.2.2 (Schutz)ausrüstung
- 3.2.2.2.1 Fechtmasken
- 3.2.2.2.2 Fechtjacken, Gambesons und Brustschutz
- 3.2.2.2.3 Handschuhe
- 3.2.2.2.4 Weitere Ausrüstung und Bekleidung
- 3.2.3 Konkrete Beispiele: Schwertkampf als Breitensportart, spiritueller Weg und außerhalb der HEMA-Szene
- 3.2.3.1 Die Sportart „Moderne Schwertkunst“
- 3.2.3.1.1 Vom eklektizistischen System zum Breitensport nach dem Vorbild Karate
- 3.2.3.1.2 Emanzipation von den Quellen
- 3.2.3.2 Der Verein „Lebendige Schwertkunst“
- 3.2.3.2.1 Berufung zum Schwertkampf
- 3.2.3.2.2 Die Suche nach hermetischem Wissen
- 3.2.3.3 Außerhalb von HEMA: Battle of Nations, Unified Weapons Master und andere
- 3.3 Die Trainer: Experten, Lehrer, Coaches, Meister
- 3.3.1 Trainer als Forscher: Quellen interpretieren und produzieren
- 3.3.1.1 Die Trainer als (Amateur-)Wissenschaftler
- 3.3.1.2 Die Trainer als Autoren: moderne Fechtbücher
- 3.3.2 Trainer als Meister: Vermittlung, Mythen und Symbole
- 3.3.2.1 Vermittlungs-Modelle und Hierarchien
- 3.3.2.2 Das Schwert als Mythos
- 3.3.2.3 Der Krieger als Ideal
- 3.3.3 Trainer als Kämpfer: Körperlichkeit, Wettkämpfe und Gender
- 3.3.3.1 Der Körper als Zeichen: Verletzungen und Turniere
- 3.3.3.2 Der Körper als Identität: Gender und Körperbild
- 3.3.4 Trainer als Gestalter: Selbstdarstellung der Gruppen
- 3.3.4.1 Internetseiten
- 3.3.4.2 Wappen und Logos
- 4 Unschärfen des Schwerts: Invention of Tradition, Paradoxien und die Martial Arts Studies
- 4.1 Renaissance eines immateriellen europäischen Kulturguts?
- 4.2 Die Erben alter Meister?
- 4.3 Die Paradoxien der HEMA
- 4.4 HEMA und die Martial Arts Studies
- Historische Entwicklung des Schwertkampfs und seiner Rezeption
- Rolle der Trainer in der HEMA-Szene
- Vermittlung von Schwertkampftechniken und -traditionen
- HEMA als kulturelle Praxis und Identitätsbildung
- Die Paradoxien der HEMA-Szene
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht die moderne Schwertkampfszene in Deutschland, insbesondere die Rolle der Trainer und die Vermittlung mittelalterlichen europäischen Schwertkampfs im Kontext von „Historical European Martial Arts“ (HEMA). Die Arbeit analysiert die historischen Vorbilder, die Entwicklung der Szene und die verschiedenen Facetten des modernen Schwertkampfs als Sport, Kampfkunst und kulturelle Praxis.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Die Rückkehr der Schwertmeister?: Dieses Kapitel legt die Grundlagen der Arbeit, indem es die Motivation, die Forschungsfragen und die Relevanz der Studie darlegt. Es beschreibt die angewandten Methoden, die Vorgehensweise und die damit verbundenen kritischen Überlegungen. Weiterhin wird die Nomenklatur geklärt und ein Überblick über die Forschungsgeschichte zum Thema gegeben, wobei verschiedene Epochen und Perspektiven auf den Schwertkampf beleuchtet werden, von nationalistischen Tendenzen bis hin zu sportlichen und akademischen Ansätzen.
2 Die historischen Vorbilder: Gerichtskämpfe, Sport und „ritterliche Kunst“: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Vorbilder des modernen Schwertkampfs. Es untersucht Fechtbücher und Fechter aus verschiedenen Epochen, von den mittelalterlichen Fechtbruderschaften bis hin zu den universitären Fechtmeistern des 16. bis 18. Jahrhunderts. Besondere Aufmerksamkeit wird der Entwicklung des Schwertkampfs im Kontext gesellschaftlicher und kultureller Veränderungen gewidmet, einschließlich seiner Rolle in Gerichtskämpfen, im Sport und als Ausdruck „ritterlicher Kunst“. Die Kapitel analysiert verschiedene historische Phasen und deren Einfluss auf die heutige HEMA-Szene.
3 Die zweite Renaissance: Western Martial Arts / Historical European Martial Arts (ab den 1980ern - heute): Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung der modernen HEMA-Szene. Es untersucht die Ursprünge der Szene, ihre Strukturen, Akteure und Aktivitäten, beginnend mit den Wurzeln in Kampfsportarten, Reenactment und der Mittelalterszene. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von HEMA als Sportart, Kampfkunst, Handwerk und Traditionspflege, sowie auf der Analyse der Sachkultur (Waffen, Ausrüstung) und der unterschiedlichen Ausprägungen in der Szene (Breitensport, spiritueller Weg).
Schlüsselwörter
Historisches Fechten, HEMA, Schwertkampf, Mittelalter, Trainer, Vermittlungspraxen, Kampfkunst, Traditionspflege, Identität, Martial Arts Studies, Sport, Kulturgeschichte, Quelleninterpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Dissertation: Die Rückkehr der Schwertmeister?
Was ist das Thema der Dissertation?
Die Dissertation untersucht die moderne Schwertkampfszene in Deutschland, insbesondere die Rolle der Trainer und die Vermittlung mittelalterlichen europäischen Schwertkampfs im Kontext von „Historical European Martial Arts“ (HEMA). Sie analysiert die historischen Vorbilder, die Entwicklung der Szene und die verschiedenen Facetten des modernen Schwertkampfs als Sport, Kampfkunst und kulturelle Praxis.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die historische Entwicklung des Schwertkampfs und seiner Rezeption, die Rolle der Trainer in der HEMA-Szene, die Vermittlung von Schwertkampftechniken und -traditionen, HEMA als kulturelle Praxis und Identitätsbildung sowie die Paradoxien der HEMA-Szene.
Wie ist die Dissertation aufgebaut?
Die Dissertation ist in vier Kapitel gegliedert. Kapitel 1 legt die Grundlagen der Arbeit dar (Motivation, Methoden, Forschungsgeschichte). Kapitel 2 beleuchtet die historischen Vorbilder des modernen Schwertkampfs (Fechtbücher, Fechter, gesellschaftliche Kontexte). Kapitel 3 konzentriert sich auf die Entwicklung der modernen HEMA-Szene (Ursprünge, Strukturen, Akteure, Sachkultur). Kapitel 4 behandelt die Unschärfen des Schwerts, die Paradoxien der HEMA und deren Bezug zu den Martial Arts Studies.
Welche historischen Epochen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den Schwertkampf von seinen mittelalterlichen Anfängen (ab dem 13. Jahrhundert) über die Renaissance und die Romantik bis hin zur Gegenwart. Dabei werden verschiedene Phasen und deren Einfluss auf die heutige HEMA-Szene analysiert, einschließlich der Entwicklung im 16.-18. Jahrhundert, der Romantik um 1900, der Hollywood-Ära und der modernen HEMA-Bewegung ab den 1980er Jahren.
Welche Rolle spielen die Trainer in der HEMA-Szene?
Die Rolle der Trainer wird als zentraler Aspekt der Dissertation betrachtet. Die Arbeit analysiert die Trainer als Forscher, Meister, Kämpfer und Gestalter, beleuchtet ihre Vermittlungspraxen, die Mythen und Symbole, die sie verwenden, sowie ihre Selbstdarstellung und den Einfluss auf die Szene.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Dissertation?
Die konkreten Ergebnisse sind im Text nicht explizit zusammengefasst, sondern werden im Laufe der Dissertation erarbeitet. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der HEMA-Szene, die Rolle der Trainer, den Umgang mit Traditionen und die Paradoxien im modernen Schwertkampf. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Dissertation ein umfassendes Bild der HEMA-Szene in Deutschland liefert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Dissertation?
Historisches Fechten, HEMA, Schwertkampf, Mittelalter, Trainer, Vermittlungspraxen, Kampfkunst, Traditionspflege, Identität, Martial Arts Studies, Sport, Kulturgeschichte, Quelleninterpretation.
Für wen ist diese Dissertation relevant?
Die Dissertation ist relevant für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Kulturgeschichte, Sportgeschichte, Martial Arts Studies, Identitätsbildung und der Rezeption von Traditionen befassen. Sie bietet auch Einblicke für Praktikerinnen und Praktiker der HEMA-Szene und Interessierte an mittelalterlichen Kampfkünsten.
- Quote paper
- M.A. Sebastian Keller (Author), 2017, Moderne Schwertkampf-Trainer als "Erben" alter Meister, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461604