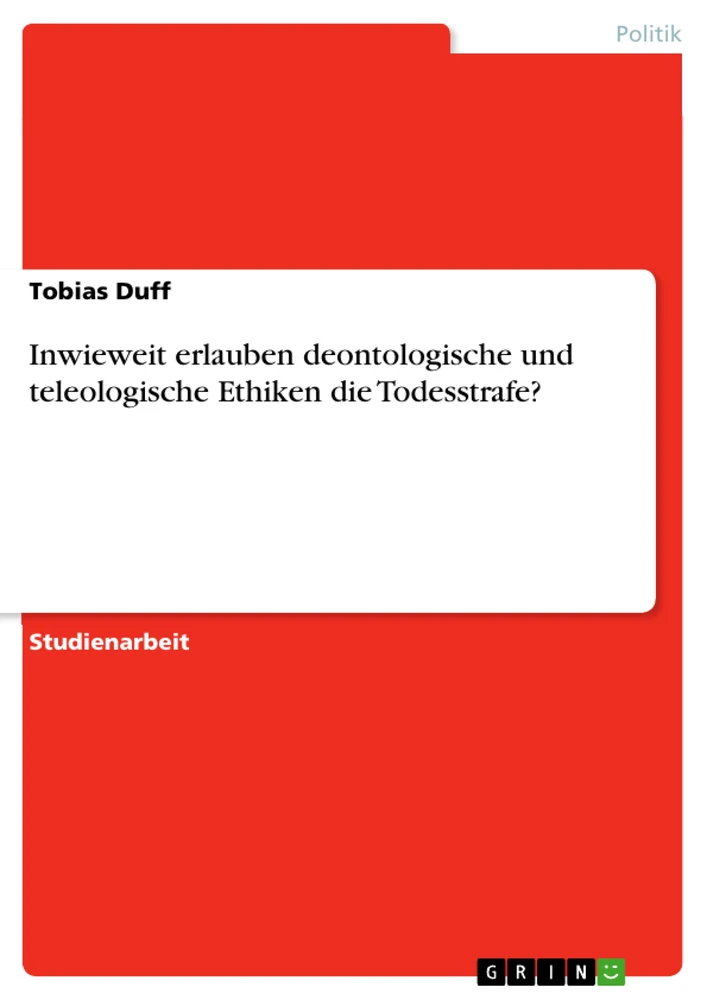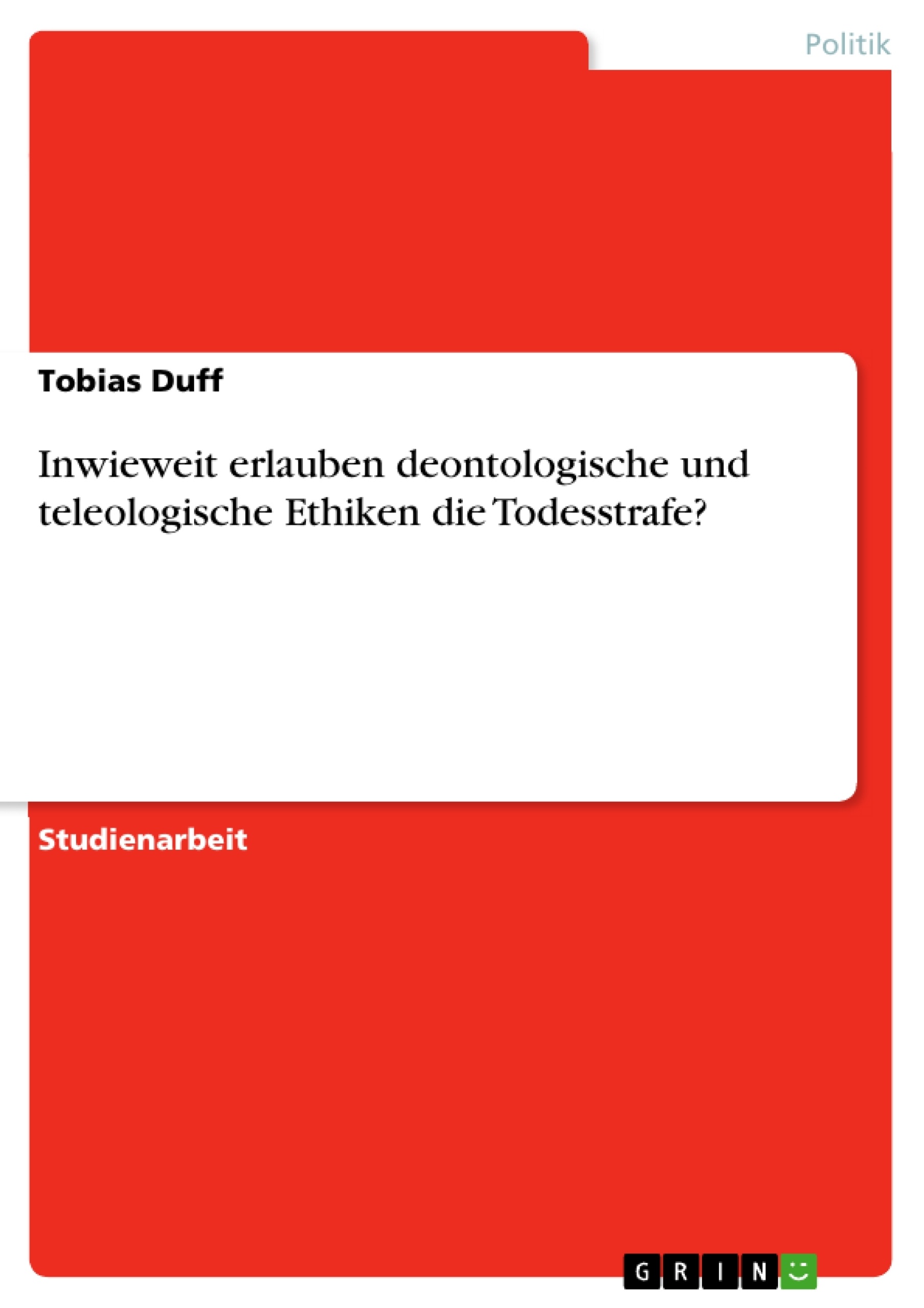In meiner folgenden Hausarbeit werde ich mich mit der Todesstrafe aus Sicht des Kantianismus und des Utilitarismus nach Mill auseinandersetzen. Die Basis für meine Arbeit wird der Text „Ethik – eine analytische Einführung“ von William K. Frankena bilden.
Diese beiden Theorien sind die Hauptversionen der deontologischen beziehungsweise der teleologischen Ethik. Diese beiden Ethiken setzen unterschiedliche Wertmaßstäbe und Argumentationsstränge bei dem, was man als „richtiges“ und „gutes“ Handeln bezeichnen würde. Auf diesen Aspekt gehe ich bei der jeweiligen Beschreibung der beiden Theorien genauer ein.
Folgend werde ich die Todesstrafe aus der Sicht der jeweiligen Ethiken analysieren. Am Ende wird eine kurze kritische Beleuchtung der beiden Argumentationsstränge und Positionen vorgenommen.
Im Weiteren werde ich kurz auf die Begriffe Ethik und Moral eingehen, um diese zu klären und von einem einheitlichen Standpunkt aus meine Arbeit nach der Einleitung fortzusetzen. Berufen werde ich mich dabei auf Frankena.
Der Begriff der Ethik ist dem Zweig der Philosophie zuzuordnen und befasst sich mit Überlegungen zur Moral sowie mit aus der Moral erwachsenen Handlungen, Problematiken und Urteilen.
Moral kann als System verstanden werden, dass die Beziehung der Individuen unter-einander regelt. Die Moral kann zudem als „Instrument der Gesellschaft“ bezeichnet werden, um (von außen) Forderungen an den Einzelnen heranzutragen. Nichtsdestotrotz ist es möglich, dass der Einzelne diesen Forderungen widerspricht, allerdings nur, wenn der Person selbst bereits ein anderer moralischer Wert zugeordnet werden kann, welcher ihm/ihr eingeprägt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Deontologische Ethik
- 2.1 Kantianismus
- 3. Teleologische Ethik
- 3.1 Utilitarismus
- 4. Todesstrafe
- 4.1 Todesstrafe nach deontologischer Ethik
- 4.1.1 Kritik der deontologischen Sichtweise
- 4.2 Todesstrafe nach teleologischer Ethik
- 4.2.1 Kritik der teleologischen Sichtweise
- 4.1 Todesstrafe nach deontologischer Ethik
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Zulässigkeit der Todesstrafe aus der Perspektive des Kantianismus und des Utilitarismus nach Mill. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Wertmaßstäbe und Argumentationslinien beider ethischer Theorien und wendet diese auf die Thematik der Todesstrafe an. Im Fokus steht der Vergleich der deontologischen und teleologischen Ethik und deren jeweilige Kritikpunkte.
- Deontologische vs. teleologische Ethik
- Kantianische Moralphilosophie und die Todesstrafe
- Utilitaristische Argumentation zur Todesstrafe
- Kritik der deontologischen und teleologischen Positionen
- Anwendung ethischer Prinzipien auf ein aktuelles Problem
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die Zielsetzung der Arbeit, die sich auf die Analyse der Todesstrafe aus kantianischer und utilitaristischer Perspektive konzentriert. Sie benennt den Text "Ethik – eine analytische Einführung" von William K. Frankena als Grundlage und erläutert die grundlegenden Unterschiede zwischen deontologischer und teleologischer Ethik hinsichtlich der Bestimmung von "richtigem" und "gutem" Handeln. Die Einleitung legt den Fokus auf die bevorstehende Analyse der Todesstrafe aus der Sicht beider ethischen Systeme und kündigt eine abschließende kritische Auseinandersetzung mit den Argumentationslinien an. Zudem werden die Begriffe "Ethik" und "Moral" kurz geklärt, wobei auf Frankenas Definitionen zurückgegriffen wird.
2. Deontologische Ethik: Dieses Kapitel führt in die deontologische Ethik ein, die im Gegensatz zur teleologischen Ethik Handlungen unabhängig von ihren Konsequenzen bewertet. Der Kantianismus wird als Hauptvertreter dieser Ethik vorgestellt, wobei der kategorische Imperativ als zentraler Leitfaden für moralisch richtiges Handeln hervorgehoben wird. Es wird erklärt, dass nach Kant eine Handlung nur dann moralisch richtig ist, wenn sie aus gutem Willen und nicht aus eigennützigen Motiven erfolgt. Die Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit moralischer Pflichten werden ebenfalls betont, wobei die Vernunft als Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Tier und als Grundlage für moralische Entscheidungen hervorgehoben wird.
3. Teleologische Ethik: Dieses Kapitel widmet sich der teleologischen Ethik, die im Gegensatz zur deontologischen Ethik die Folgen von Handlungen als entscheidendes Kriterium für deren moralische Bewertung betrachtet. Der Utilitarismus wird als Hauptvertreter der teleologischen Ethik eingeführt, wobei das Prinzip des größten Glücks für die größte Zahl an Menschen als zentraler Maßstab für moralisch richtiges Handeln genannt wird. Im Fokus steht die Frage, wie das Prinzip des größten Glücks auf die Todesstrafe angewendet werden kann und welche Folgen diese aus utilitaristischer Sicht hat.
4. Todesstrafe: Dieses Kapitel analysiert die Todesstrafe unter Berücksichtigung der zuvor dargestellten ethischen Theorien. Es untersucht, wie sowohl die deontologische als auch die teleologische Ethik die Todesstrafe bewerten und welche Argumente für und gegen die Todesstrafe vorgebracht werden. Dabei werden sowohl die Kantianische als auch die Utilitaristische Perspektive detailliert beleuchtet. Zudem wird eine kritische Reflexion der jeweiligen Argumentationslinien und Positionen vorgenommen, wobei potenzielle Schwächen und Grenzen der Anwendung beider Ethiken auf die Todesstrafe herausgearbeitet werden.
Schlüsselwörter
Todesstrafe, Deontologische Ethik, Teleologische Ethik, Kantianismus, Utilitarismus, Kategorischer Imperativ, Moral, Ethik, Folgenethik, Pflichtethik, Guter Wille, größtmögliches Glück.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Ethik und Todesstrafe
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Zulässigkeit der Todesstrafe aus der Perspektive des Kantianismus und des Utilitarismus. Sie vergleicht deontologische und teleologische Ethik und analysiert deren jeweilige Argumentationslinien und Kritikpunkte in Bezug auf die Todesstrafe.
Welche ethischen Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die deontologische Ethik, insbesondere den Kantianismus mit seinem kategorischen Imperativ, und die teleologische Ethik, insbesondere den Utilitarismus mit dem Prinzip des größten Glücks für die größte Zahl.
Wie wird die Todesstrafe aus deontologischer Sicht betrachtet?
Die Hausarbeit analysiert, ob die Todesstrafe mit dem kategorischen Imperativ Kants vereinbar ist, und untersucht kritisch die deontologische Argumentation für und gegen die Todesstrafe.
Wie wird die Todesstrafe aus teleologischer Sicht betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Folgen der Todesstrafe und bewertet sie anhand des utilitaristischen Prinzips des größten Glücks. Sie analysiert kritisch die utilitaristische Argumentation für und gegen die Todesstrafe.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur deontologischen und teleologischen Ethik, ein Kapitel zur Todesstrafe mit detaillierter Analyse aus beiden ethischen Perspektiven und einem Fazit. Jedes Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung der relevanten Theorien und deren Anwendung auf die Thematik der Todesstrafe.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Todesstrafe, Deontologische Ethik, Teleologische Ethik, Kantianismus, Utilitarismus, Kategorischer Imperativ, Moral, Ethik, Folgenethik, Pflichtethik, Guter Wille und größtmögliches Glück.
Welche Literatur wird verwendet?
Die Hausarbeit nennt "Ethik – eine analytische Einführung" von William K. Frankena als eine der Grundlagen.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die Todesstrafe aus zwei unterschiedlichen ethischen Perspektiven zu analysieren und die Stärken und Schwächen beider Ansätze kritisch zu bewerten. Der Vergleich der deontologischen und teleologischen Ethik steht dabei im Mittelpunkt.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Hausarbeit beinhaltet eine Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die wichtigsten Punkte und Argumente kurz und prägnant darstellt.
- Arbeit zitieren
- Tobias Duff (Autor:in), 2017, Inwieweit erlauben deontologische und teleologische Ethiken die Todesstrafe?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461281