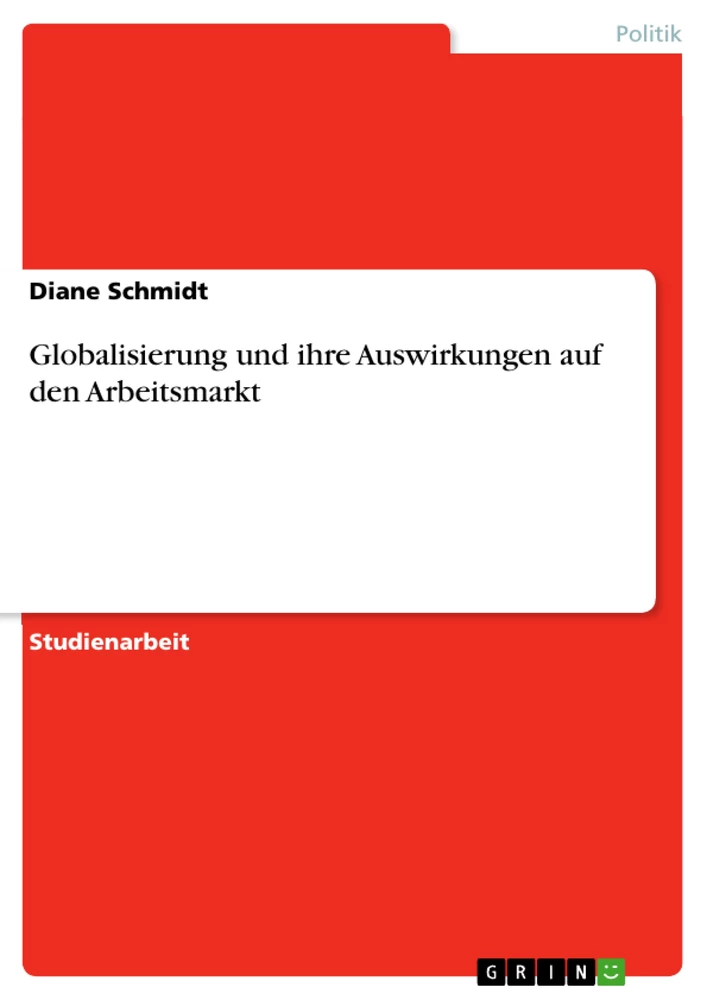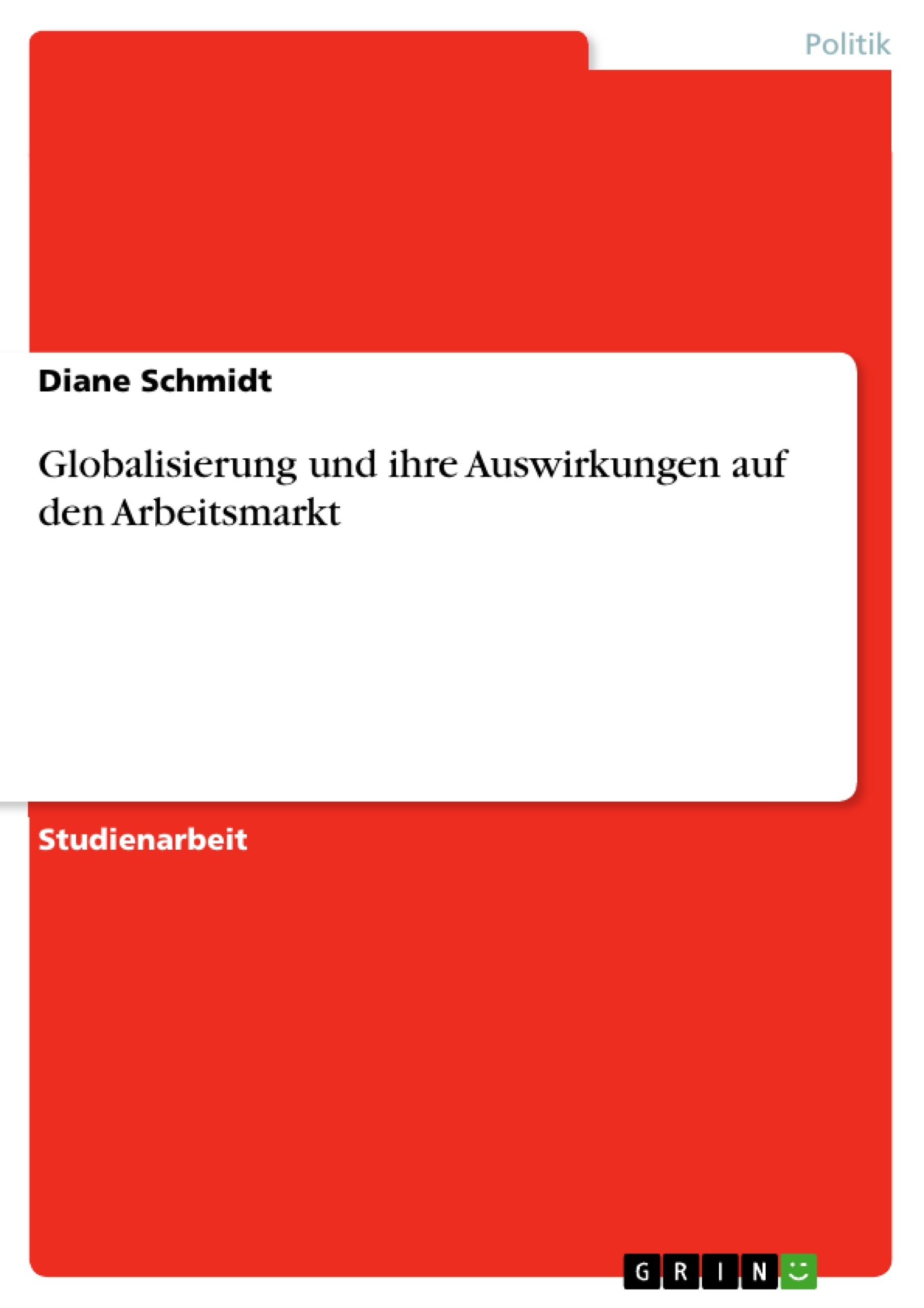Globalisierung ist eine Entwicklung, die bis in die Anfänge der Industrialisierung zurückreicht, also ein langwieriger Prozeß. Dieser verlief nicht immer gleichmäßig sondern eher schubweise aufgrund der unterschiedlich starken Triebkräfte. Im „Wörterbuch Staat und Politik“ wird Globalisierung als „räumliche Erweiterung von ökonomischen, kulturellen und politischen Beziehungen sowie die wechselseitige Verflechtung von Akteuren und Problemlagen“ auf der transnationalen Ebene bezeichnet.
Fritz Scharpf beschreibt Globalisierung als Entwicklung, bei der „die realen Problemzusammenhänge in immer mehr Bereichen die nationalen Grenzen überschreiten und sich dadurch der effektiven Selbstbestimmung in [den] Gemeinwesen entziehen“. Von der Globalisierung erfaßt sei vor allem die nationale Ökonomie, die immer stärker in die kapitalistische Weltwirtschaft eingebettet sei. Wie Scharpf sieht auch Ulrich Beck mit dem „Zeitalter der Globalisierung“ ein „Demokratiedilemma“ einhergehen. Entscheidungen von großer Reichweite würden zunehmend im transnationalen Rahmen bar jeder demokratischer Legitimation getroffen.
So begann man mit der Erfahrung, daß, wenn Staaten in einen offenen Austausch mit anderen Volkswirtschaften treten, sie davon profitieren und Wohlstandsgewinne erzielen. Dadurch wurden Märkte und Produktionen der verschiedenen Länder voneinander abhängig, denn nun begann der weltweite Güteraustausch, die Warenvielfalt, der weltweite Informationsaustausch und die unbegrenzten Reisemöglichkeiten.
Aber so verschärfte sich auch der internationale Wettbewerb um Marktanteile und Kapital. Dieser Wettbewerb zwischen den Staaten belief sich auf Steuern, Subventionen, Arbeitsplätze, Know-how und Investitionen. Dies geschah auch auf den gesellschaftlichen Ebenen, wobei auch der Wettstreit in Sachen Kunst, Medien und Wissenschaft ständig intensiver wurde. Es gilt als ein Austausch von Ideen, Konzeptionen und Wertehaltungen.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Globalisierung?
- Allgemeines
- Grundelemente der Globalisierung
- Merkmale der Globalisierung
- Mögliche Folgen der Globalisierung
- Globale Gefährdungen/Umweltschäden
- Globalisierung als Folge der Weltinformationsgesellschaft
- Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
- Sozialstaatliche Institutionen
- Gewerkschaften
- Fazit
- Souveränitätsverlust der Nationalstaaten
- Handlungsmöglichkeiten der Nationalstaaten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff der Globalisierung, ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die staatliche Souveränität. Sie analysiert die Entwicklung der Globalisierung, ihre Grundelemente und möglichen Folgen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, inwiefern die Globalisierung die Handlungsfähigkeit nationaler Staaten beeinträchtigt.
- Definition und Entwicklung der Globalisierung
- Auswirkungen der Globalisierung auf den Arbeitsmarkt
- Einfluss der Globalisierung auf die staatliche Souveränität
- Mögliche Folgen und Risiken der Globalisierung
- Reaktionsmöglichkeiten der Nationalstaaten auf die Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Was ist Globalisierung?: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in den Begriff der Globalisierung. Es beleuchtet die historische Entwicklung als langwierigen Prozess mit unterschiedlichen Triebkräften und definiert Globalisierung als räumliche Erweiterung ökonomischer, kultureller und politischer Beziehungen sowie die wechselseitige Verflechtung von Akteuren und Problemlagen auf transnationaler Ebene. Die Arbeit von Fritz Scharpf wird zitiert, der Globalisierung als Entwicklung beschreibt, bei der nationale Grenzen von Problemzusammenhängen überschritten werden und die Selbstbestimmung der Gemeinwesen beeinträchtigt wird. Ulrich Beck’s Konzept des „Demokratiedilemmas“ im Zeitalter der Globalisierung wird ebenfalls diskutiert, welches die Problematik transnationaler Entscheidungen ohne demokratische Legitimation hervorhebt. Der einleitende Teil legt den Grundstein für die weitere Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Globalisierung auf verschiedene Bereiche.
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: Dieses Kapitel analysiert die tiefgreifenden Auswirkungen der Globalisierung auf den Arbeitsmarkt. Es untersucht den Einfluss auf sozialstaatliche Institutionen und Gewerkschaften, beleuchtet die Herausforderungen für den Sozialstaat und die Rolle der Gewerkschaften in einem globalisierten Kontext. Der Text erörtert vermutlich die zunehmende Verlagerung von Arbeitsplätzen, den Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte und die Notwendigkeit von Anpassungsstrategien für Arbeitnehmer und Institutionen. Die Zusammenfassung der Subkapitel zu sozialstaatlichen Institutionen und Gewerkschaften wird hier in den Gesamtkontext des Einflusses der Globalisierung auf den Arbeitsmarkt eingebettet.
Souveränitätsverlust der Nationalstaaten: Das Kapitel konzentriert sich auf die Frage, inwieweit die Globalisierung die Souveränität und Handlungsfähigkeit von Nationalstaaten schwächt. Es analysiert, wie transnationale Prozesse und Akteure die Entscheidungsbefugnisse nationaler Regierungen beeinflussen und welche Handlungsspielräume den Staaten trotz der Globalisierung verbleiben. Die Diskussion konzentriert sich wahrscheinlich auf die Herausforderungen für die nationale Politikgestaltung in einem globalisierten Umfeld und auf mögliche Strategien, um die nationale Souveränität zu bewahren oder wiederherzustellen. Der Abschnitt über Handlungsmöglichkeiten der Nationalstaaten wird in die Gesamtbetrachtung des Souveränitätsverlustes integriert.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Arbeitsmarkt, Nationalstaat, Souveränität, Weltwirtschaft, Transnationalität, Sozialstaat, Gewerkschaften, Weltinformationsgesellschaft, ökonomische Beziehungen, kulturelle Beziehungen, politische Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Globalisierung, Arbeitsmarkt und staatliche Souveränität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Globalisierung, ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die staatliche Souveränität von Nationalstaaten. Sie analysiert die Entwicklung, die Grundelemente und die möglichen Folgen der Globalisierung und konzentriert sich insbesondere auf die Frage, wie die Globalisierung die Handlungsfähigkeit nationaler Staaten beeinflusst.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Entwicklung der Globalisierung, Auswirkungen der Globalisierung auf den Arbeitsmarkt (einschließlich der Rolle von Sozialstaat und Gewerkschaften), Einfluss der Globalisierung auf die staatliche Souveränität, mögliche Folgen und Risiken der Globalisierung sowie Reaktionsmöglichkeiten der Nationalstaaten auf die Globalisierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die sich mit der Definition von Globalisierung, ihren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und dem Souveränitätsverlust der Nationalstaaten befassen. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und analysiert die jeweiligen Themen im Detail. Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffe.
Was wird unter Globalisierung verstanden?
Die Arbeit definiert Globalisierung als räumliche Erweiterung ökonomischer, kultureller und politischer Beziehungen und die wechselseitige Verflechtung von Akteuren und Problemlagen auf transnationaler Ebene. Sie wird als ein langwieriger Prozess mit unterschiedlichen Triebkräften dargestellt. Die Arbeit bezieht sich auf relevante Theorien von Autoren wie Fritz Scharpf (Überschreitung nationaler Grenzen von Problemzusammenhängen) und Ulrich Beck (Demokratiedilemma im Zeitalter der Globalisierung).
Wie wirkt sich die Globalisierung auf den Arbeitsmarkt aus?
Das Kapitel zu den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt analysiert den Einfluss der Globalisierung auf sozialstaatliche Institutionen und Gewerkschaften. Es beleuchtet die Herausforderungen für den Sozialstaat und die Rolle der Gewerkschaften in einem globalisierten Kontext. Wahrscheinlich werden Themen wie Arbeitsplatzverlagerung, Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte und Anpassungsstrategien für Arbeitnehmer und Institutionen diskutiert.
Wie beeinflusst die Globalisierung die staatliche Souveränität?
Dieses Kapitel untersucht, wie die Globalisierung die Souveränität und Handlungsfähigkeit von Nationalstaaten schwächt. Es analysiert den Einfluss transnationaler Prozesse und Akteure auf die Entscheidungsbefugnisse nationaler Regierungen und beleuchtet gleichzeitig die verbleibenden Handlungsspielräume der Staaten. Die Herausforderungen für die nationale Politikgestaltung in einem globalisierten Umfeld und mögliche Strategien zum Erhalt oder zur Wiederherstellung nationaler Souveränität werden wahrscheinlich erörtert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Globalisierung, Arbeitsmarkt, Nationalstaat, Souveränität, Weltwirtschaft, Transnationalität, Sozialstaat, Gewerkschaften, Weltinformationsgesellschaft, ökonomische Beziehungen, kulturelle Beziehungen und politische Beziehungen.
- Citation du texte
- Diane Schmidt (Auteur), 2002, Globalisierung und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4611