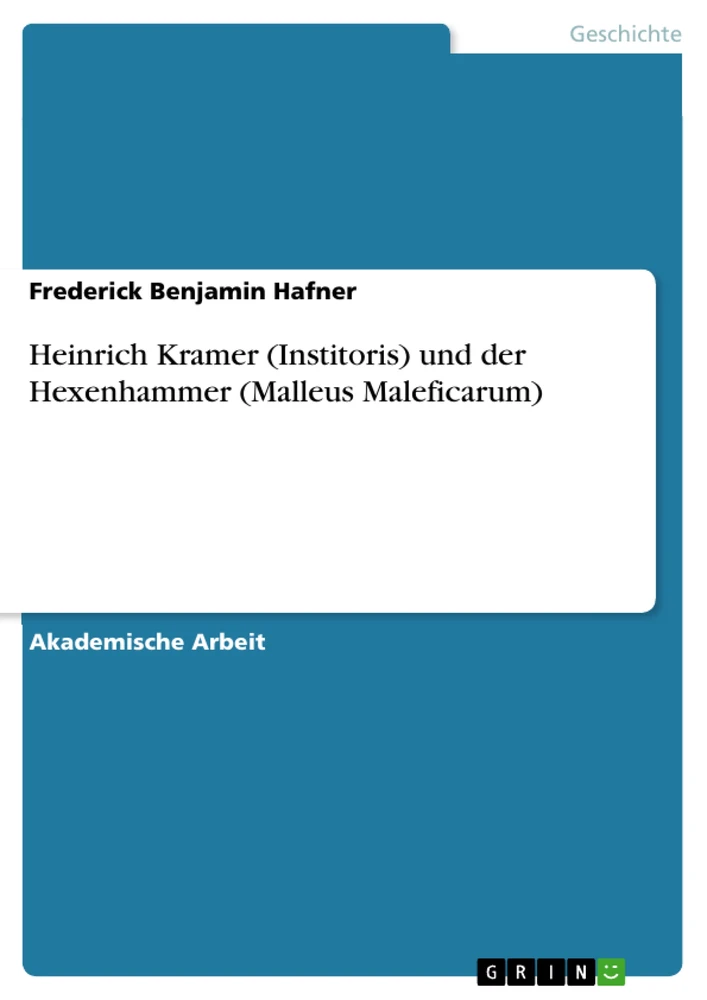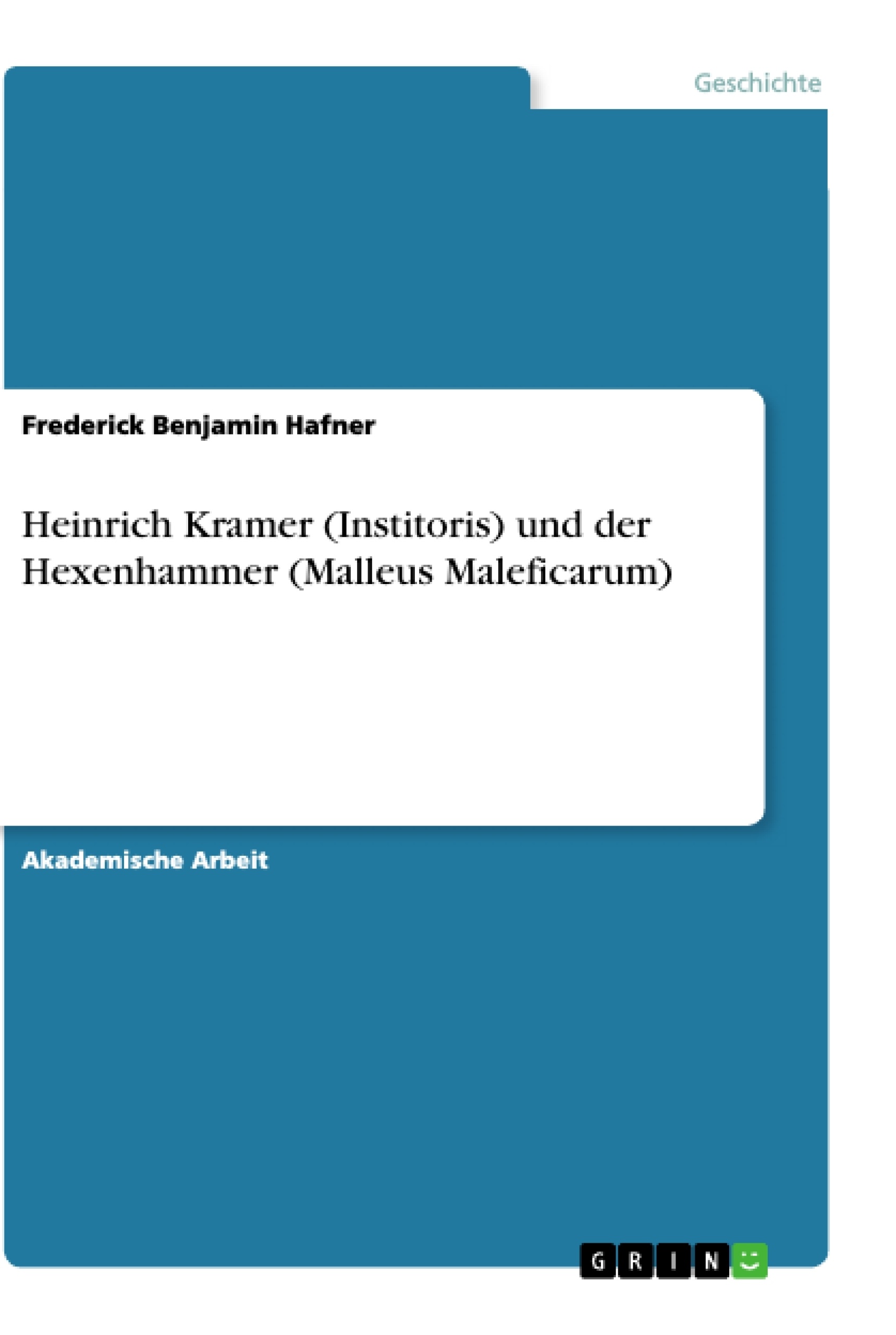Diese Proseminararbeit soll die Autorenschaft des Hexenhammers klären. Auf die Frage nach dem Autor / den Autoren wurden nämlich in den letzten Jahrzehnten verschiedene Antworten in der Geschichtswissenschaft gegeben. In zahlreichen Ausgaben des Hexenhammers wurde eine Co-Autorenschaft von Jakob Sprenger, neben Heinrich Kramer (latinisiert: Institoris), angeführt, diese ist jedoch in Frage zu stellen. Warum diese Zusammenarbeit als unwahrscheinlich gilt, soll in diesem Abschnitt dargelegt werden.
Der Hexenhammer (lat. Originaltitel: „Malleus Maleficarum“) ist zweifelsfrei eines der zentralsten, zeitgenössischen Bücher des späten Mittelalters zu den beginnenden Hexenverfolgungen. Solche Hetzjagden gab es zwar bereits vor der Erstveröffentlichung des Werkes, zum Beispiel in Nordspanien, Südfrankreich, Oberitalien, Burgund sowie im Elsaß und im Herzogtum Lothringen, nichtsdestotrotz sollte dieses Traktat erhebliche Auswirkungen auf die Praxis der Ketzerverfolgungen, welche ihren Höhepunkt erst in der frühen Neuzeit erreichten, haben. Sowohl in den bereits erwähnten Gebieten als auch in Zentraleuropa, wo man den Hexenvorstellungen noch ablehnend gegenüberstand, hatte der „Malleus Malficarum“ Einfluss auf die Anwendung der Hexenprozesse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Klärung der Autorenschaft
- 3. Der Autor
- 4. Entstehung des Hexenhammers
- 4.1 Motivation des Autors
- 4.2 Abfassung des Hexenhammers
- 5. Titel, Inhalt und Aufbau des Hexenhammers
- 6. Rezeption
- 7. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und das Umfeld des "Hexenhammers" (Malleus Maleficarum). Die Zielsetzung ist es, die Autorenschaft zu klären, die Motivation des Autors zu beleuchten und den Inhalt sowie die Rezeption des Werkes zu analysieren. Die Arbeit vermeidet eine umfassende Wertung des Textes, konzentriert sich aber auf die Darstellung der historischen und kontextuellen Umstände.
- Klärung der Autorenschaft des Hexenhammers
- Motivation und Entstehung des Werkes
- Inhalt und Aufbau des "Hexenhammers"
- Rezeption und Wirkung des Buches
- Der historische Kontext der Hexenverfolgung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt den "Hexenhammer" als zentrales Werk der beginnenden Hexenverfolgung im späten Mittelalter vor. Sie hebt die Bedeutung des Traktats für die Entwicklung der Hexenprozesse in verschiedenen europäischen Regionen hervor und kündigt die Struktur der Arbeit an, die sich zunächst der Klärung der Autorenschaft widmet.
2. Klärung der Autorenschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit der umstrittenen Frage nach der Autorenschaft des "Hexenhammers". Es diskutiert die lange Zeit angenommene Co-Autorenschaft von Jakob Sprenger und Heinrich Kramer und präsentiert Argumente, die diese Annahme in Frage stellen. Der Fokus liegt auf der Analyse unterschiedlicher Ausgaben und der Untersuchung der jeweiligen Interessen der beteiligten Personen, um die Wahrscheinlichkeit einer Zusammenarbeit zu bewerten. Die unterschiedlichen Angaben in verschiedenen Ausgaben des Werkes werden analysiert und verglichen, um zu einem Schlussfolgerung zu kommen.
3. Der Autor: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Leben Heinrich Kramers, des mutmaßlichen alleinigen Autors des "Hexenhammers". Obwohl nur begrenzte Informationen verfügbar sind, skizziert es die wichtigsten Stationen seines Lebens. Besonderes Augenmerk liegt auf den gescheiterten Hexenprozessen in Innsbruck im Jahr 1485, die als entscheidender Impuls für die Abfassung des "Hexenhammers" betrachtet werden.
4. Entstehung des Hexenhammers: Dieses Kapitel ist in zwei Unterkapitel gegliedert, die sich separat mit der Motivation und der Abfassung des "Hexenhammers" befassen. Das Unterkapitel 4.1 "Motivation des Autors" analysiert die gescheiterten Innsbrucker Prozesse als zentralen Anstoß für Kramers Werk. Unterkapitel 4.2 "Abfassung des Hexenhammers" beleuchtet den Entstehungsprozess des Buches, wobei die Einleitung von Behringer und Jerouschek als Hauptquelle dient. Diese Einleitung wird verwendet, um die zeitliche Einordnung und den Entstehungsprozess plausibel zu erklären.
5. Titel, Inhalt und Aufbau des Werkes: Dieses Kapitel erklärt den lateinischen Originaltitel "Malleus Maleficarum" und analysiert dessen Aussagekraft hinsichtlich des Inhalts des Werkes. Es skizziert den Inhalt und den Aufbau des "Hexenhammers" und liefert somit eine strukturelle Übersicht über den Text.
6. Rezeption: Das Kapitel untersucht die Rezeption des "Hexenhammers" nach seiner Veröffentlichung. Es analysiert, ob das Buch Aufmerksamkeit erregte und inwieweit es auf Zustimmung oder Ablehnung stieß.
Schlüsselwörter
Hexenhammer (Malleus Maleficarum), Heinrich Kramer (Institoris), Jakob Sprenger, Hexenverfolgung, Mittelalter, Inquisition, Autorenschaft, Innsbrucker Hexenprozesse, Rezeption, magische Praktiken.
Malleus Maleficarum: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wer sind die Autoren des Hexenhammers?
Die Autorenschaft des „Hexenhammers“ (Malleus Maleficarum) ist umstritten. Lange Zeit ging man von einer gemeinsamen Autorenschaft von Heinrich Kramer und Jakob Sprenger aus. Die Arbeit analysiert jedoch Argumente, die diese Annahme in Frage stellen und konzentriert sich auf Heinrich Kramer als mutmaßlichen alleinigen Autor.
Wann und warum wurde der Hexenhammer geschrieben?
Der „Hexenhammer“ entstand im späten Mittelalter. Die Arbeit untersucht die gescheiterten Hexenprozesse in Innsbruck im Jahr 1485 als zentralen Anstoß für die Abfassung des Werkes durch Kramer. Die Motivation des Autors und der genaue Entstehungsprozess werden detailliert beleuchtet.
Worum geht es im Hexenhammer?
Der „Hexenhammer“ ist ein Traktat über Hexen und Hexerei. Die Arbeit skizziert den Inhalt und den Aufbau des Werkes, erklärt den lateinischen Originaltitel „Malleus Maleficarum“ und bietet eine strukturelle Übersicht über den Text. Der Fokus liegt auf der Darstellung der historischen und kontextuellen Umstände.
Wie wurde der Hexenhammer aufgenommen?
Die Arbeit analysiert die Rezeption des „Hexenhammers“ nach seiner Veröffentlichung. Es wird untersucht, ob das Buch Aufmerksamkeit erregte und inwieweit es auf Zustimmung oder Ablehnung stieß.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Klärung der Autorenschaft, die Motivation und Entstehung des Werkes, den Inhalt und Aufbau des „Hexenhammers“, die Rezeption und Wirkung des Buches sowie den historischen Kontext der Hexenverfolgung im späten Mittelalter. Die Arbeit vermeidet eine umfassende Wertung des Textes.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Ausgaben des „Hexenhammers“ und nutzt die Einleitung von Behringer und Jerouschek als Hauptquelle für die Klärung des Entstehungsprozesses des Buches.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Hexenhammer (Malleus Maleficarum), Heinrich Kramer (Institoris), Jakob Sprenger, Hexenverfolgung, Mittelalter, Inquisition, Autorenschaft, Innsbrucker Hexenprozesse, Rezeption, magische Praktiken.
- Quote paper
- Frederick Benjamin Hafner (Author), 2015, Heinrich Kramer (Institoris) und der Hexenhammer (Malleus Maleficarum), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/460893