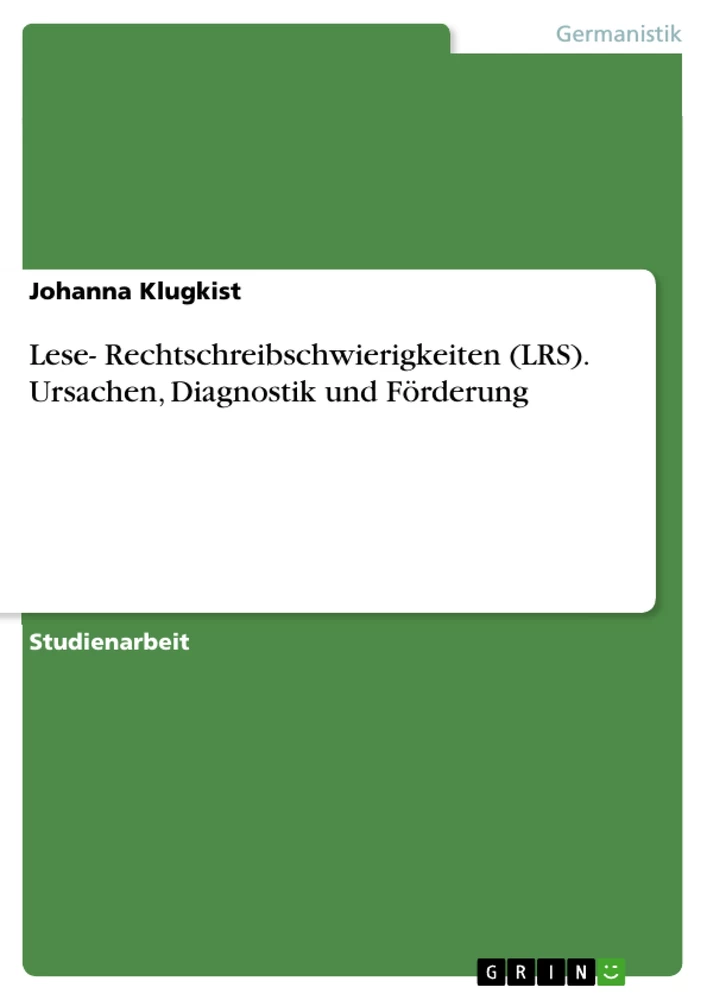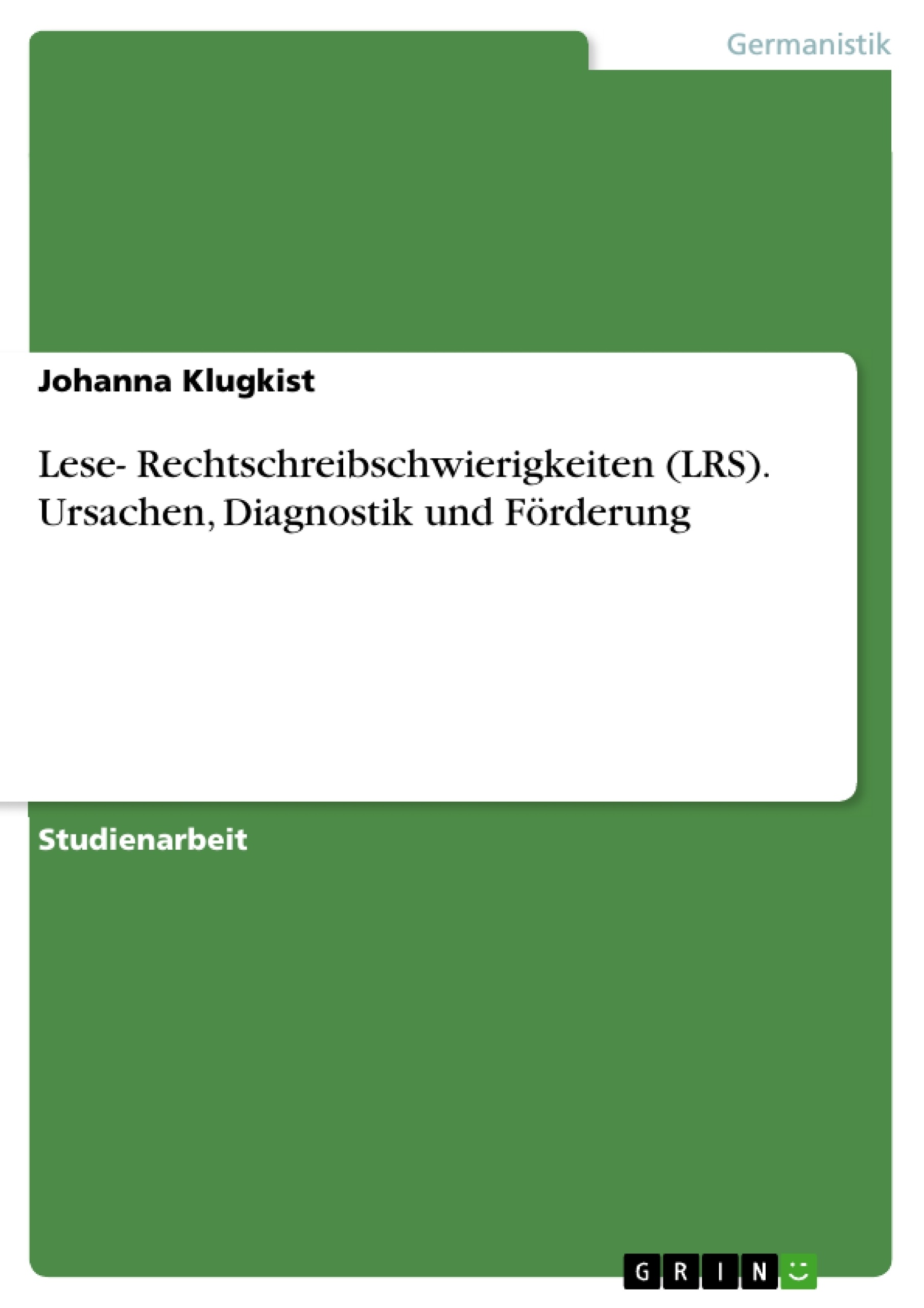Eine der wichtigsten Kulturtechniken, die Kinder erlernen müssen, ist die Sprache in Schrift und Wort. Die Schule ist dafür verantwortlich, dies zu vermitteln und zu festigen. Einige Kinder haben jedoch große Schwierigkeiten, diese Kulturtechnik zu erlernen. Der Grund ist oft eine Leserechtschreibschwäche (LRS). Seit vielen Jahren beschäftigt man sich mit den Symptomen, Ursachen und Fördermaßnahmen von LRS, und trotzdem kommt man immer wieder zu neuen Erkenntnissen; die Forschungsarbeiten sind noch lange nicht abgeschlossen.
„Konzentrier dich doch mal!“, „Pass doch mal auf!“, „Streng dich an!“ – diese Forderungen bekommen Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche oft zu hören. Doch ist es richtig, dass diese Kinder sich nicht konzentrieren, nicht anstrengen oder gar nicht aufpassen? Dieser Fragestellung möchte ich in diesem Buch unter anderem auf den Grund gehen.
In dieser Ausarbeitung werde ich anfangs die Begriffe und die Ursachen der „Legasthenie und Leserechtschreibschwäche“ definieren und den möglichen Unterschied herausarbeiten. Um die LRS genauer zu illustrieren, werde ich auf die Ursachen, Symptomatik und Erscheinungsbilder einer LRS eingehen sowie mögliche Diagnoseverfahren aufzeigen. Anschließend daran werde ich unterschiedliche Fördermöglichkeiten für Schüler mit einer Leserechtschreibschwäche sowie allgemeine Lesefördermöglichkeiten vorstellen. In dem abschließenden Resümee die Ausarbeitung reflektieren und einen Ausblick in die Praxis und in die Durchführbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse zu dieser Thematik wagen.
In dieser Ausarbeitung wird nicht auf den Teilaspekt der Rechtschreibung eingegangen, sondern Probleme, Förderung etc. des Lesens isoliert betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Leserechtschreibschwäche / Legasthenie?
- Symptome
- Ursachen der LRS aus Sicht der Pädagogik
- Phonologische Bewusstheit - Was ist das?
- Störungen in der Entwicklung der phonologischen Bewusstheit
- Lesediagnostik
- Das Bielefelder Screening-Verfahren
- Knuspels Leseaufgaben
- Leseförderung
- Förderung der phonologischen Bewusstheit
- Frühe Prävention – Warum?
- Das Würzburger Trainingsprogramm Hören, lauschen, lernen
- Allgemeine Leseförderung
- Fazit und Ausblick auf den eigenen Unterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die Leserechtschreibschwäche (LRS), ihre Ursachen und mögliche Fördermaßnahmen. Sie beleuchtet den Unterschied zwischen den Begriffen LRS und Legasthenie und analysiert verschiedene diagnostische Verfahren. Der Fokus liegt auf der Leseförderung, inklusive präventiver Maßnahmen und konkreter Förderprogramme.
- Definition und Abgrenzung von LRS und Legasthenie
- Ursachen der LRS aus pädagogischer Sicht
- Diagnostik von Leseschwierigkeiten
- Methoden der Leseförderung
- Frühe Prävention von LRS
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Leserechtschreibschwäche (LRS) ein und erläutert die Bedeutung des Schriftspracherwerbs. Sie beschreibt die Herausforderungen, denen Kinder mit LRS begegnen, und hebt die Notwendigkeit umfassender Forschung und effektiver Fördermaßnahmen hervor. Die Autorin skizziert den Aufbau ihrer Arbeit und betont ihren persönlichen Bezug zum Thema sowie die Grenzen der im Rahmen des Seminars möglichen Detailtiefe.
Was ist Leserechtschreibschwäche / Legasthenie?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung der Begriffe „Legasthenie“ und „Leserechtschreibschwäche (LRS)“. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven der Medizin, Psychologie und Pädagogik auf diese Thematik und diskutiert die Vor- und Nachteile der Verwendung beider Begriffe. Es werden verschiedene Auffassungen über die Ursachen von LRS dargestellt, von anlagebedingten neurologischen Defiziten bis hin zu einem dynamischen Zusammenspiel individueller, familiärer und schulischer Faktoren. Die Autorin erklärt ihre Entscheidung, im weiteren Verlauf den Begriff LRS zu verwenden.
Symptome: Das Kapitel beschreibt die typischen Symptome einer Leserechtschreibschwäche. Es wird erläutert, wie sich diese Schwierigkeiten im Leseprozess manifestieren, z.B. durch Stocken, niedrige Lesegeschwindigkeit, Zeilenverlust und Fehler beim Erkennen und Reproduzieren von Wörtern, Silben und Buchstaben. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Problemen beim sinnentnehmenden Lesen und der daraus resultierenden Schwierigkeiten beim Textverständnis und der Wiedergabe des Gelesenen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Lesen als strategischer Informationsverarbeitungsprozess.
Ursachen der LRS aus Sicht der Pädagogik: Dieses Kapitel behandelt die vielschichtigen Ursachen von LRS. Es wird betont, dass es keine einzelne Ursache gibt, sondern ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Es werden unterschiedliche Theorien und Forschungsansätze dargestellt, die die Rolle visueller Defizite, phonologischer Bewusstheit und anderer kognitiver Fähigkeiten beleuchten. Das Kapitel betont den komplexen und noch nicht vollständig erforschten Charakter der Entstehung von LRS.
Schlüsselwörter
Leserechtschreibschwäche (LRS), Legasthenie, Leseförderung, Lesediagnostik, phonologische Bewusstheit, frühe Prävention, Förderprogramme, Lesemethoden, Diagnoseverfahren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Ausarbeitung: Leserechtschreibschwäche (LRS)
Was ist der Inhalt dieser Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung befasst sich umfassend mit dem Thema Leserechtschreibschwäche (LRS). Sie beinhaltet eine Einleitung, ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen, und Schlüsselwörter. Die Arbeit untersucht die LRS, ihre Ursachen und mögliche Fördermaßnahmen, beleuchtet den Unterschied zwischen LRS und Legasthenie und analysiert verschiedene diagnostische Verfahren. Der Fokus liegt auf der Leseförderung, inklusive präventiver Maßnahmen und konkreter Förderprogramme.
Was wird unter dem Begriff "Leserechtschreibschwäche (LRS)" verstanden und wie unterscheidet sie sich von Legasthenie?
Die Ausarbeitung definiert und grenzt die Begriffe „Legasthenie“ und „Leserechtschreibschwäche (LRS)“ voneinander ab. Sie beleuchtet unterschiedliche Perspektiven aus Medizin, Psychologie und Pädagogik und diskutiert die Vor- und Nachteile der Verwendung beider Begriffe. Die Autorin erläutert ihre Entscheidung, im weiteren Verlauf den Begriff LRS zu verwenden.
Welche Symptome sind typisch für eine LRS?
Die Ausarbeitung beschreibt typische Symptome einer LRS, wie z.B. Stocken beim Lesen, niedrige Lesegeschwindigkeit, Zeilenverlust und Fehler beim Erkennen und Reproduzieren von Wörtern, Silben und Buchstaben. Besonderes Augenmerk liegt auf Problemen beim sinnentnehmenden Lesen und den daraus resultierenden Schwierigkeiten beim Textverständnis.
Welche Ursachen werden für LRS aus pädagogischer Sicht genannt?
Die Ausarbeitung behandelt die vielschichtigen Ursachen von LRS und betont, dass es kein einzelnes Ursache gibt, sondern ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Es werden verschiedene Theorien und Forschungsansätze dargestellt, die die Rolle visueller Defizite, phonologischer Bewusstheit und anderer kognitiver Fähigkeiten beleuchten. Der komplexe und noch nicht vollständig erforschte Charakter der Entstehung von LRS wird hervorgehoben.
Welche diagnostischen Verfahren werden behandelt?
Die Ausarbeitung analysiert verschiedene diagnostische Verfahren zur Erkennung von Leseschwierigkeiten. Genannt werden beispielsweise das Bielefelder Screening-Verfahren und Knuspels Leseaufgaben.
Welche Fördermaßnahmen und präventiven Strategien werden vorgestellt?
Die Ausarbeitung beschreibt verschiedene Methoden der Leseförderung, inklusive präventiver Maßnahmen. Konkrete Förderprogramme wie das Würzburger Trainingsprogramm „Hören, lauschen, lernen“ werden vorgestellt. Ein wichtiger Aspekt ist die Förderung der phonologischen Bewusstheit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis der Ausarbeitung?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Leserechtschreibschwäche (LRS), Legasthenie, Leseförderung, Lesediagnostik, phonologische Bewusstheit, frühe Prävention, Förderprogramme, Lesemethoden und Diagnoseverfahren.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Ausarbeitung enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse jedes Kapitels kurz und prägnant wiedergeben.
- Arbeit zitieren
- Johanna Klugkist (Autor:in), 2005, Lese- Rechtschreibschwierigkeiten (LRS). Ursachen, Diagnostik und Förderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46010