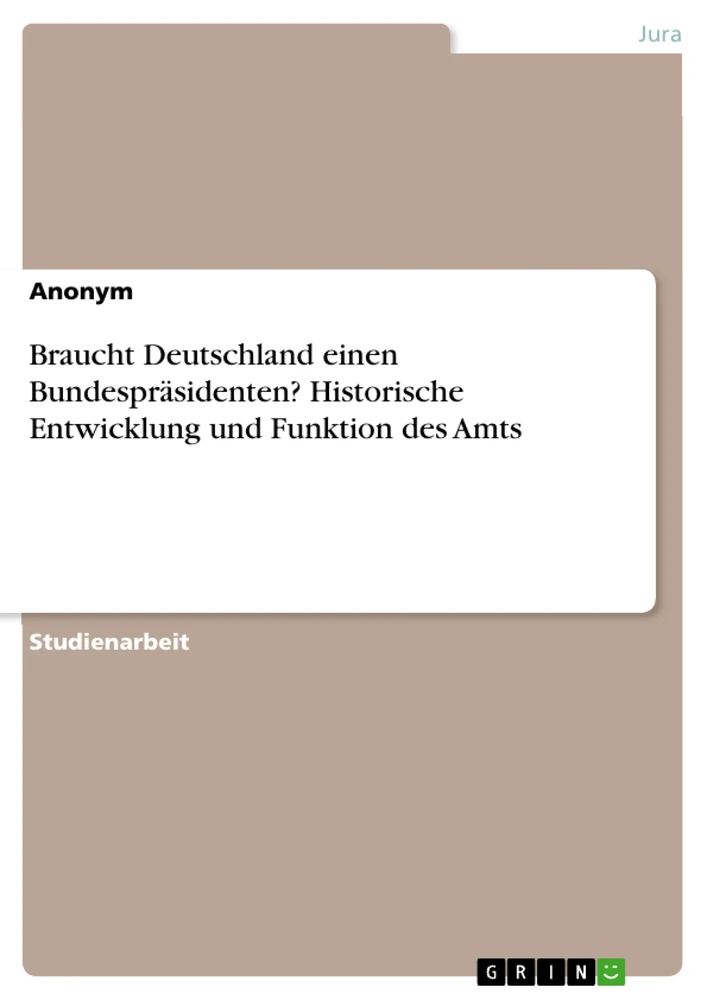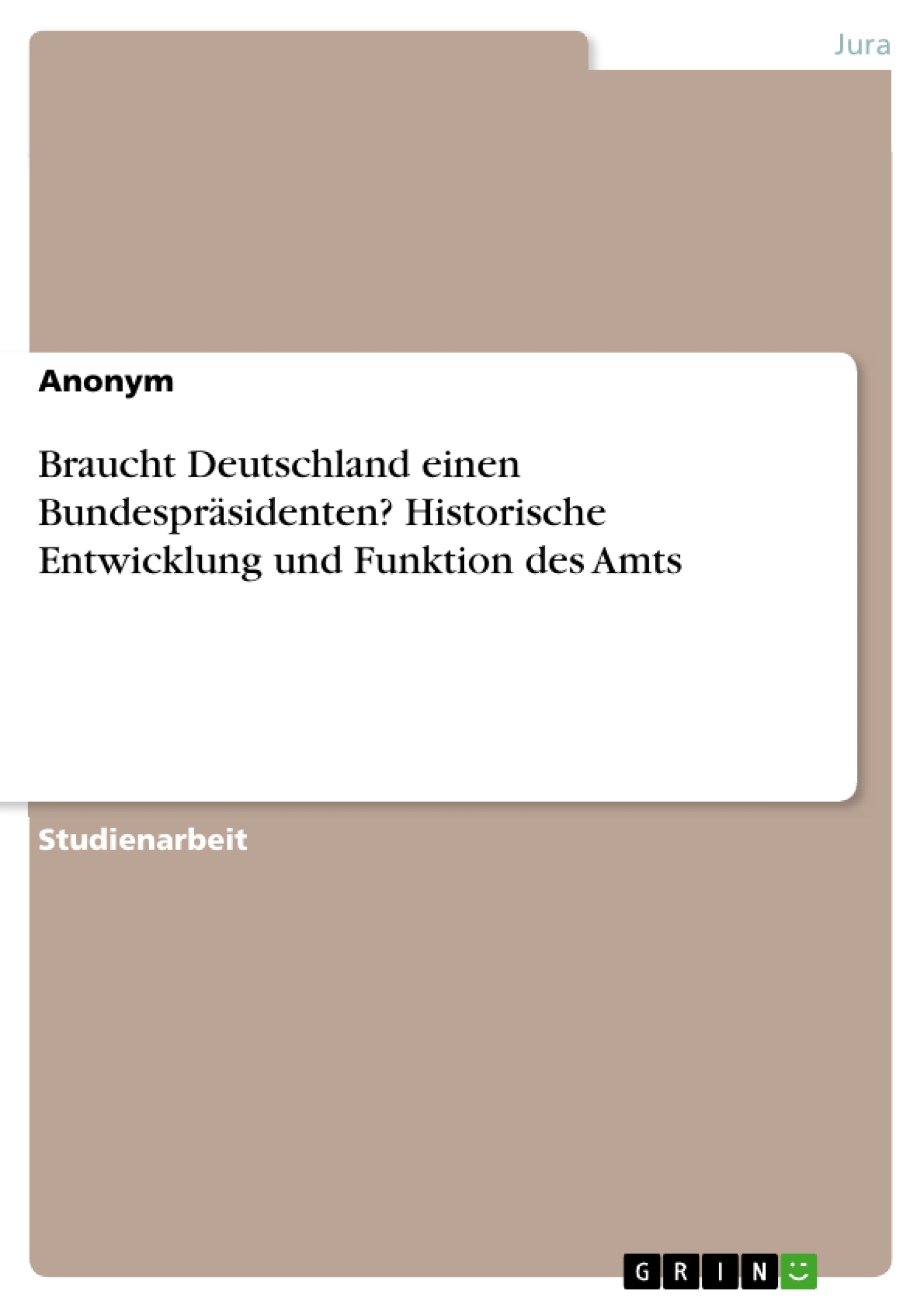Braucht Deutschland einen Bundespräsidenten? Diese Frage stellte man sich in der Geschichte der BRD von Anfang an. Ganz besonders dann, wenn ein amtierender Bundespräsident eine schwache Persönlichkeit war oder gar das von ihm vertretene Land durch seine Handlungen öffentlich blamierte. Nicht umsonst nannte das kriegsgeschundene Volk den ersten Präsidenten, Theodor Heuss, der mit seiner bewusst bürgerlichen Haltung einen willkommenen Gegenpol zum Krieg und dem Terrorregime der Nazis darstellte, liebevoll „Papa Heuss“.
Kein anderer Präsident erfreute sich größerer Beliebtheit als Walter Scheel, keiner setzte mehr politische Akzente als Richard von Weizsäcker. Während aber die Existenz des Kanzleramtes bei einem wenig charismatischen Kanzler nie in Frage gestellt wird, wird bei einer schwachen Präsidentenpersönlichkeit sofort die Abschaffung des Amtes gefordert.
Deshalb stellt diese Arbeit zunächst die geschichtlichen Hintergründe des Amtes, gefolgt von einer Zusammenfassung der wichtigsten Aufgaben des Staatsoberhauptes, dar. Danach soll der Frage nachgegangen werden, welche Möglichkeiten der Präsidenten hat, um gestalterisch auf die Politik einzuwirken. In der Folge geht es darum, welchem Spannungsverhältnis der Bundespräsident bei politischen Äußerungen unterliegt. Anschließend soll die Notwendigkeit von Reformen des Amtes diskutiert werden, um schließlich die anfangs aufgeworfene Frage zu beantworten, ob das Amt des Bundespräsidenten entbehrlich ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung
- Der Weimarer Reichspräsident
- Die Nationalsozialistische Diktatur
- Abkehr von Weimar
- Die Stellung des Bundespräsidenten im Staatsgefüge
- Repräsentations-, Integrations- und Reservefunktion
- Aufgaben
- Der politische Einfluss des Bundespräsidenten
- Gesetzesprüfungsrecht
- Formelles Prüfungsrecht
- Materielles Prüfungsrecht
- Einschränkungen
- Gesetzesausfertigung in der Staatspraxis
- Der Einfluss des Präsidenten bei der Auflösung des Bundestages
- Die These von der Machtlosigkeit des Präsidenten
- Ergebnis
- Gesetzesprüfungsrecht
- Politische Äußerungen des Bundespräsidenten
- Organklage der NPD gegen Bundespräsident Joachim Gauck
- Sachverhalt
- Problem
- Entscheidung des BVerfG
- Spannungsverhältnis und Grenzen der Äußerungsbefugnis
- Auswirkung auf die Praxis
- Organklage der NPD gegen Bundespräsident Joachim Gauck
- Reform des Bundespräsidentenamtes
- Volkswahl des Bundespräsidenten
- Wahlverfahren
- Amtszeit
- Verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer Direktwahl
- Verfassungspolitische Zweckmäßigkeit einer Direktwahl
- Ergebnis
- Verzicht auf das Amt
- Volkswahl des Bundespräsidenten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Bundespräsidenten in der Bundesrepublik Deutschland. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Amtes, seine Stellung im Staatsgefüge und den politischen Einfluss des Präsidenten. Darüber hinaus werden die Grenzen seiner Äußerungsbefugnis und die Notwendigkeit von Reformen diskutiert.
- Historische Entwicklung des Bundespräsidentenamtes
- Verfassungsmäßige Aufgaben und Befugnisse des Bundespräsidenten
- Politischer Einfluss und Grenzen der Macht des Bundespräsidenten
- Diskussion um Reformen des Amtes
- Bewertung der Notwendigkeit des Amtes des Bundespräsidenten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung wirft die Frage nach der Notwendigkeit des Bundespräsidentenamtes auf und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie verweist auf die unterschiedliche Wahrnehmung des Amtes in Abhängigkeit von der Persönlichkeit des jeweiligen Präsidenten und kündigt die Auseinandersetzung mit der historischen Entwicklung, den Aufgaben, dem politischen Einfluss und möglichen Reformen an.
Historische Entwicklung: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Amtes des Staatsoberhauptes, beginnend mit dem Weimarer Reichspräsidenten und seinen weitreichenden Kompetenzen, die maßgeblich zum Scheitern der Weimarer Republik beitrugen. Es beschreibt die Instrumentalisierung des Amtes während der NS-Diktatur und die anschließende bewusste Reduzierung der Machtfülle des Bundespräsidenten in der Bundesrepublik Deutschland aus der Lehre der Weimarer Erfahrungen. Der Fokus liegt auf der Abkehr vom präsidialen System der Weimarer Republik hin zu einem repräsentativen Amt in der Bundesrepublik.
Die Stellung des Bundespräsidenten im Staatsgefüge: Dieser Abschnitt erläutert die Stellung des Bundespräsidenten im deutschen Staatsgefüge. Er wird keiner der drei Gewalten zugeordnet, sondern nimmt Aufgaben aus allen drei Bereichen wahr, sowohl legislative, exekutive als auch judikative. Seine Funktionen werden als Repräsentations-, Integrations- und Reservefunktion beschrieben, wobei die Bedeutung seiner überparteilichen Stellung und die Grenzen seiner Entscheidungsbefugnis betont werden.
Der politische Einfluss des Bundespräsidenten: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem tatsächlichen politischen Einfluss des Bundespräsidenten. Es analysiert sein Gesetzesprüfungsrecht, den Einfluss bei der Auflösung des Bundestages und diskutiert die häufig geäußerte These von der Machtlosigkeit des Präsidenten. Die Analyse berücksichtigt sowohl formale als auch informelle Einflussmöglichkeiten und deren praktische Relevanz.
Politische Äußerungen des Bundespräsidenten: Das Kapitel untersucht das Spannungsverhältnis zwischen der Neutralitätspflicht des Bundespräsidenten und seiner Möglichkeit zu politischen Äußerungen. Am Beispiel der Organklage der NPD gegen Joachim Gauck wird die Rechtslage und die damit verbundenen Herausforderungen diskutiert. Die Auswirkung der möglichen Äußerungen auf die politische Praxis wird beleuchtet.
Reform des Bundespräsidentenamtes: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Diskussion um mögliche Reformen des Bundespräsidentenamtes. Schwerpunkt ist die Frage der Volkswahl des Bundespräsidenten, inklusive einer detaillierten Untersuchung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit und der verfassungspolitischen Zweckmäßigkeit. Die Problematik eines möglichen Verzichts auf das Amt wird ebenfalls erörtert.
Schlüsselwörter
Bundespräsident, Bundesrepublik Deutschland, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Verfassung, Repräsentation, Integration, Reservefunktion, politischer Einfluss, Gesetzesprüfungsrecht, Äußerungsfreiheit, Reformen, Direktwahl.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Rolle des Bundespräsidenten in der Bundesrepublik Deutschland
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert umfassend die Rolle des Bundespräsidenten in der Bundesrepublik Deutschland. Es untersucht die historische Entwicklung des Amtes, seine verfassungsmäßigen Aufgaben und Befugnisse, seinen politischen Einfluss und die Diskussion um mögliche Reformen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: die historische Entwicklung des Amtes (Weimarer Republik, NS-Zeit, Bundesrepublik), die Stellung des Bundespräsidenten im Staatsgefüge (Repräsentations-, Integrations- und Reservefunktion), seinen politischen Einfluss (Gesetzesprüfungsrecht, Auflösung des Bundestages), die Grenzen seiner Äußerungsfreiheit (am Beispiel der NPD-Klage gegen Gauck), und die Diskussion um Reformen (insbesondere die Volkswahl).
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einem Inhaltsverzeichnis, gefolgt von Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und abschließenden Schlüsselwörtern. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Rolle des Bundespräsidenten im Detail.
Welche historischen Entwicklungen werden betrachtet?
Die historische Entwicklung umfasst die Betrachtung des Amtes des Reichspräsidenten in der Weimarer Republik mit seinen weitreichenden Kompetenzen und dem daraus resultierenden Scheitern der Republik, die Instrumentalisierung des Amtes während der NS-Diktatur und die bewusste Reduzierung der Machtfülle des Bundespräsidenten in der Bundesrepublik als Lehre aus den Weimarer Erfahrungen.
Welche Aufgaben und Befugnisse hat der Bundespräsident?
Der Bundespräsident hat Repräsentations-, Integrations- und Reservefunktionen. Seine Aufgaben umfassen die Gesetzesprüfungsrecht, die Beteiligung an der Auflösung des Bundestages, aber auch die politische Meinungsäußerung. Das Dokument betont jedoch auch die Grenzen seiner Entscheidungsbefugnisse.
Welchen politischen Einfluss hat der Bundespräsident?
Der politische Einfluss des Bundespräsidenten wird kritisch beleuchtet. Das Dokument untersucht sein formelles und informelles Einflusspotenzial, diskutiert die These von seiner Machtlosigkeit und analysiert seine Rolle bei der Gesetzesprüfung und der Auflösung des Bundestages. Die praktische Relevanz seines Einflusses wird ebenfalls thematisiert.
Wie wird die Äußerungsfreiheit des Bundespräsidenten behandelt?
Das Dokument behandelt das Spannungsverhältnis zwischen der Neutralitätspflicht des Bundespräsidenten und seiner Möglichkeit zu politischen Äußerungen. Die Organklage der NPD gegen Bundespräsident Gauck dient als Beispiel, um die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Herausforderungen zu diskutieren.
Welche Reformen des Amtes werden diskutiert?
Die Diskussion um Reformen konzentriert sich vor allem auf die Frage der Volkswahl des Bundespräsidenten. Das Dokument untersucht die verfassungsrechtliche Zulässigkeit und die verfassungspolitische Zweckmäßigkeit einer solchen Reform. Ein möglicher Verzicht auf das Amt wird ebenfalls erörtert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Bundespräsident, Bundesrepublik Deutschland, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Verfassung, Repräsentation, Integration, Reservefunktion, politischer Einfluss, Gesetzesprüfungsrecht, Äußerungsfreiheit, Reformen, Direktwahl.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Das Dokument ist für alle gedacht, die sich wissenschaftlich mit der Rolle des Bundespräsidenten in der Bundesrepublik Deutschland befassen möchten. Es eignet sich insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse politischer Themen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Braucht Deutschland einen Bundespräsidenten? Historische Entwicklung und Funktion des Amts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459809