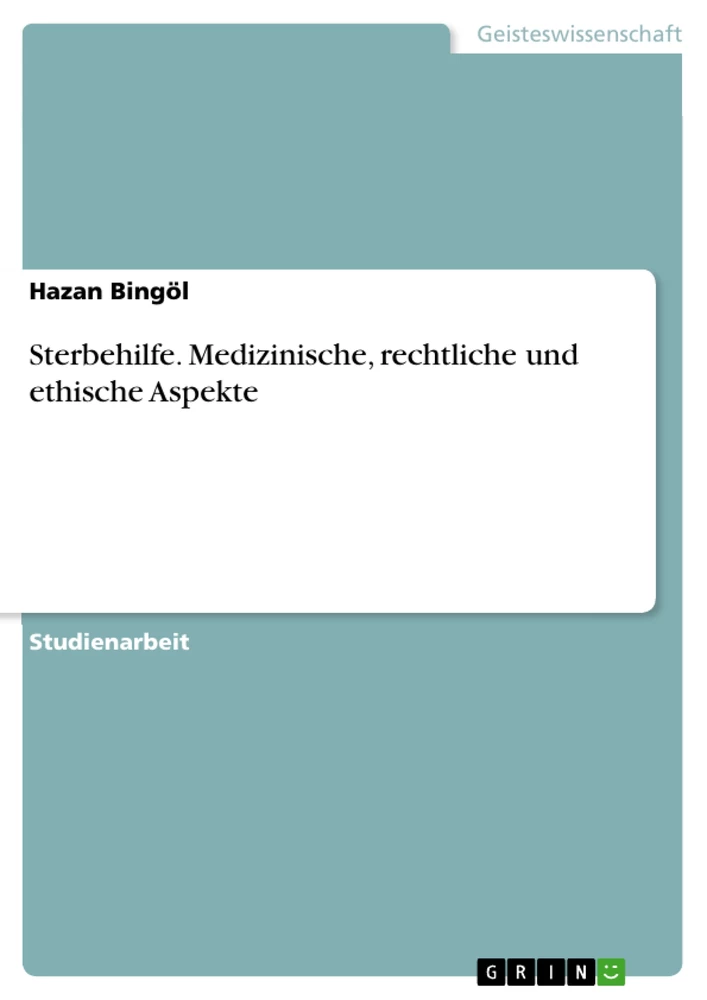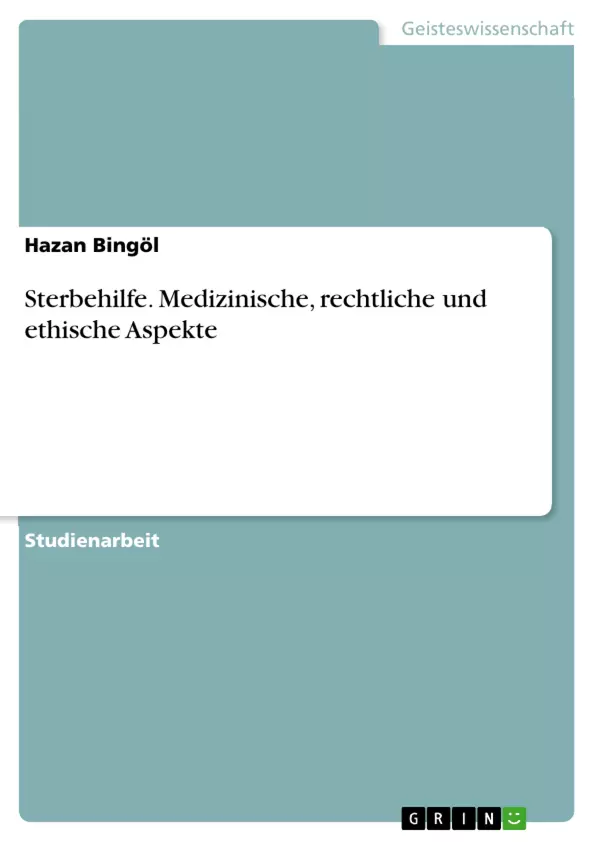Das Thema Sterbehilfe ist seit vielen Jahren ein Teil der Medizin, aber dennoch gibt es gespaltene Meinungen hierzu. Demnach hat das Thema ein hohes Diskussionspotential und wird in den Medien aufgegriffen. Alleine durch das eingeben des Begriffes „Sterbehilfe“, bietet uns die Suchmaschine Google, innerhalb von wenigen Sekunden circa 1.530.00 Treffer an. Jedoch ist diese hohe Summe nicht verwunderlich, da es viele verschiedene Ansichtsweisen zu diesem Thema gibt. Eines der bekanntesten Ansichten zu diesem Thema ist die Meinung des deutschen Arztes Christoph Wilhelm Hufeland († 25.08.1836 Berlin): „Das Leben des Menschen zu erhalten und womöglich zu verlängern, das das höchste Ziel der Heilkunst. Jeder Arzt hat geschworen, nichts zutun, wodurch das Leben eines Menschen verkürzt werden könnte. Wenn ein Kranker von unheilbarem übel gepeinigt wird, wenn er sich selbst den Tod wünscht, wenn Schwangerschaft Krankheit und Lebensgefahr erzeugt, wie leicht kann da selbst in der Seele des Besseren der Gedanke aufsteigen: Sollte es nicht erlaubt sein, ja sogar Pflicht sein, jenen Elenden etwas früher von seiner Bürde zu befreien? Ob das Leben des Menschen Glück oder Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, dies geht den Arzt nichts an!“. Er war davon überzeugt, dass es die höchste ärztliche Pflicht ist, das Leben eines Menschen so lange es ging zu erhalten und keine Maßnahmen zu ergreifen, welche das Leben des Menschen verkürzen oder sogar beenden könnten. Hierbei sollte die Einstellung des Patienten zum Leben keine Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitungskapitel
- 1.1 Einleitung und Problemstellung
- 1.2 Ziel der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 1.4 Methodisches Vorgehen
- 2. Definitionen und Grundlagen
- 2.1 Definition Sterbehilfe
- 3. Formen der Sterbehilfe
- 3.1 Aktive Sterbehilfe
- 3.2 Passive Sterbehilfe
- 3.3 Indirekte Sterbehilfe
- 3.4 Assistierte Suizid
- 4. Rechtliche Reglungen zur Sterbehilfe
- 4.1 Die Rechtslage in Deutschland
- 5. Die vier Prinzipien des ethischen Handelns
- 5.1 Autonomiprinzip
- 5.2 Prinzip der Schadensvermeidung (Nichtschadensprinzip)
- 5.3 Fürsorgeprinzip
- 5.4 Gerechtigkeitsprinzip
- 6. Sterbehilfe ethisch vertretbar?
- 6.1 Eigene Entscheidungsmöglichkeit des Menschen
- 6.2 Menschenwürdiges Sterben
- 7. Fallbeispiel
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit zielt darauf ab, die Relevanz der Sterbehilfe zu beleuchten und verschiedene ethische, medizinische sowie rechtliche Aspekte zu untersuchen. Die Arbeit betrachtet die Debatte um Sterbehilfe aus einer umfassenden Perspektive, wobei die Frage nach Gerechtigkeit und Moral im Mittelpunkt steht.
- Definition und Formen der Sterbehilfe
- Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland
- Ethische Prinzipien im Zusammenhang mit Sterbehilfe
- Autonomie und Menschenwürde im Kontext der Sterbehilfe
- Gesellschaftliche Relevanz und kontroverse Debatten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dient als Einstieg und behandelt die Einleitung und Problemstellung der Sterbehilfe sowie das Ziel, den Aufbau und das methodische Vorgehen der Arbeit. Kapitel 2 definiert den Begriff Sterbehilfe, während Kapitel 3 verschiedene Formen der Sterbehilfe wie aktive, passive, indirekte Sterbehilfe und assistierten Suizid erläutert. Die rechtlichen Reglungen in Deutschland werden in Kapitel 4 beleuchtet. Kapitel 5 beschäftigt sich mit den vier Prinzipien des ethischen Handelns. Das sechste Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, ob Sterbehilfe ethisch vertretbar ist, wobei die Aspekte der Selbstbestimmung und des menschenwürdigen Sterbens betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Sterbehilfe, Recht, Ethik, Medizin, Autonomie, Menschenwürde, Gerechtigkeit und gesellschaftliche Debatte. Die Diskussion um Sterbehilfe basiert auf den vier Prinzipien des ethischen Handelns, welche in der Arbeit detailliert behandelt werden.
- Quote paper
- Hazan Bingöl (Author), 2019, Sterbehilfe. Medizinische, rechtliche und ethische Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459680