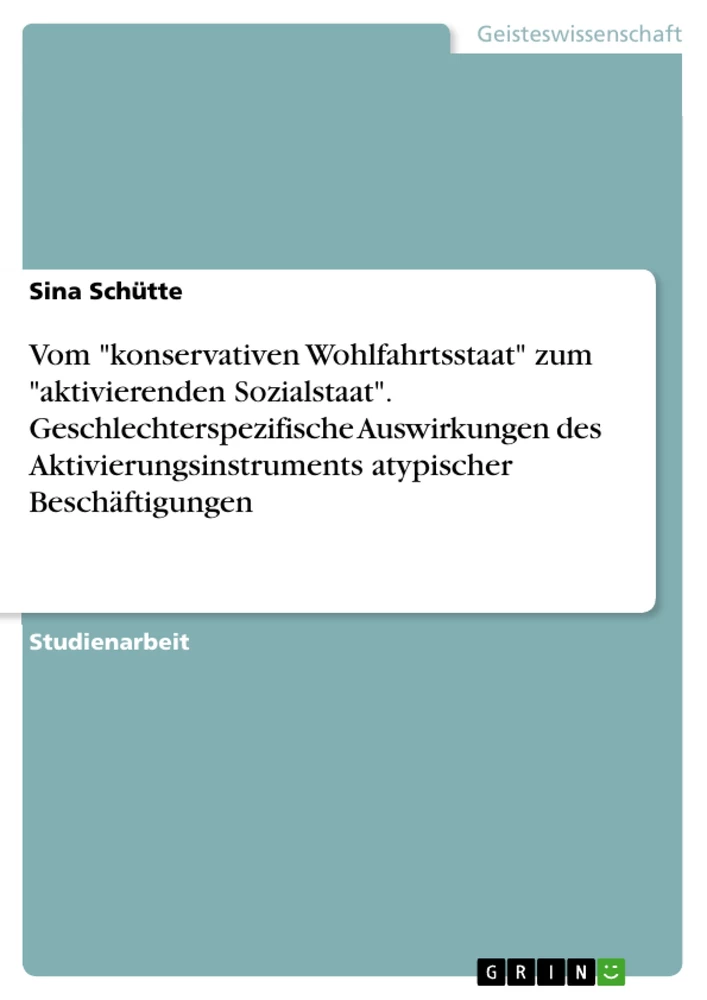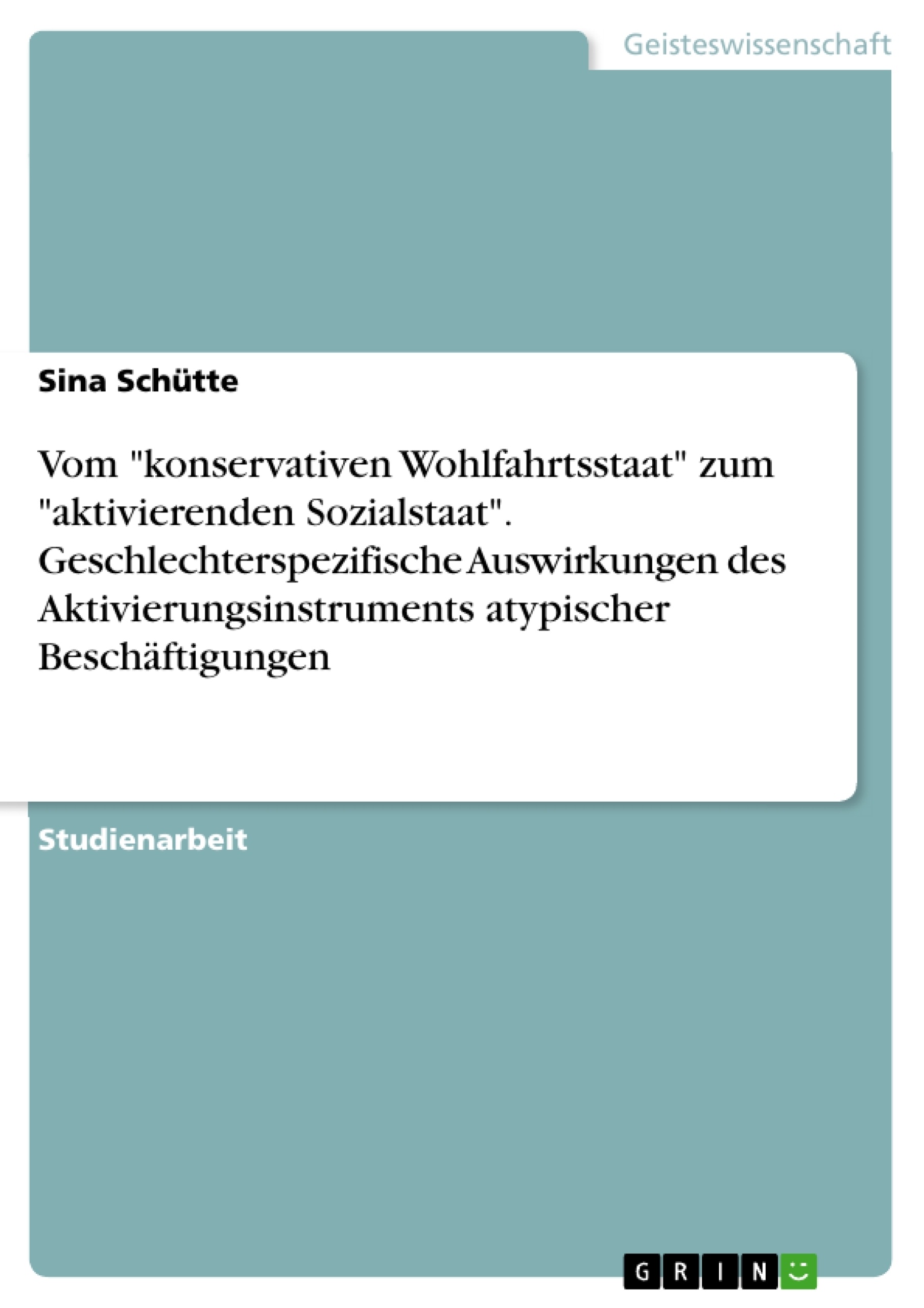Inwieweit trägt der aktivierende Arbeitsmarkt zu einer Veränderung des Geschlechterverhältnisses am Beispiel atypischer Beschäftigungsverhältnisse bei?
Um ein grundlegendes Verständnis zu verschaffen, wird zu Beginn eine schemenhafte Darstellung der Prämissen des Paradigmenwechsels gegeben, gefolgt von den wesentlichen Konzeptinhalten des „aktivierendes Sozialstaates“.
Da im Mittelpunkt der aktivierenden Sozialpolitik die Universalisierung der Arbeitsmarktteilhabe steht, wird im Anschluss grob aufgezeigt, welche Veränderungen sich unter dem Schlagwort „aktivierender Arbeitsmarkt“ vollzogen haben. Darüber hinaus wird sich der Fragestellung angenähert, in dem gleichstellungspolitische Veränderungen innerhalb des Aktivierungsdiskurses aufgezeigt und folglich die Regelungen der Sozialgesetzbücher auf ihre Geschlechtsneutralität geprüft werden. Um der Frage eine präzise Beantwortung zu ermöglichen, wird sich im weiteren Verlauf dem Aktivierungsinstrument atypischer Beschäftigungsverhältnisse angenommen. Grundlage dessen ergibt sich aus der Annahme, dass die aus den aktivierenden Arbeitsmarktprinzipien resultierenden, atypischen Erwerbsformen die Relation der Geschlechter erheblich prägen.
Im nächsten Kapitel werden dessen Auswirkungen auf die Geschlechterdifferenzen herausgearbeitet, woraufhin schlussendlich die Forschungsfrage innerhalb des Fazits Beantwortung findet
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vom „konservativen Wohlfahrtsstaat“ zum „aktivierenden Sozialstaat“
- Konzept des aktivierenden Sozialstaates
- Konzept des aktivierenden Arbeitsmarktes
- Gleichstellungspolitik innerhalb des Aktivierungsdiskurses
- Das sozialpolitische Instrument der atypischen Beschäftigung
- Auswirkungen atypischer Beschäftigung auf das Geschlechterverhältnis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Wandel vom „konservativen Wohlfahrtsstaat“ zum „aktivierenden Sozialstaat“ und untersucht die geschlechterspezifischen Auswirkungen des Aktivierungsinstruments atypischer Beschäftigungen.
- Der Paradigmenwechsel vom „versorgenden Wohlfahrtsstaat“ zum „aktivierenden Sozialstaat“
- Die Bedeutung der Aktivierung im Arbeitsmarkt und die Reformierung des Staatsverständnisses
- Die Rolle der Gleichstellungspolitik im Aktivierungsdiskurs
- Die Auswirkungen atypischer Beschäftigungsverhältnisse auf das Geschlechterverhältnis
- Die Frage, inwieweit der aktivierende Arbeitsmarkt zu einer Veränderung des Geschlechterverhältnisses am Beispiel atypischer Beschäftigungsverhältnisse beiträgt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage: Inwieweit trägt der aktivierende Arbeitsmarkt zu einer Veränderung des Geschlechterverhältnisses am Beispiel atypischer Beschäftigungsverhältnisse bei?
Das zweite Kapitel beleuchtet den Wandel vom „konservativen Wohlfahrtsstaat“ zum „aktivierenden Sozialstaat“, wobei die Konzepte des aktivierenden Sozialstaates und des aktivierenden Arbeitsmarktes im Detail vorgestellt werden.
Im dritten Kapitel wird die Gleichstellungspolitik innerhalb des Aktivierungsdiskurses betrachtet. Hier werden das sozialpolitische Instrument der atypischen Beschäftigung und dessen Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis analysiert.
Schlüsselwörter
Aktivierender Sozialstaat, atypische Beschäftigung, Geschlechterverhältnis, Gleichstellungspolitik, Arbeitsmarkt, Sozialpolitik, feministische Emanzipationsbewegungen, Staatsverständnis, Verantwortungsübertragung, Subjektivierung, „Hartz“-Gesetze, „Agenda 2010“
- Quote paper
- Sina Schütte (Author), 2018, Vom "konservativen Wohlfahrtsstaat" zum "aktivierenden Sozialstaat". Geschlechterspezifische Auswirkungen des Aktivierungsinstruments atypischer Beschäftigungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459650