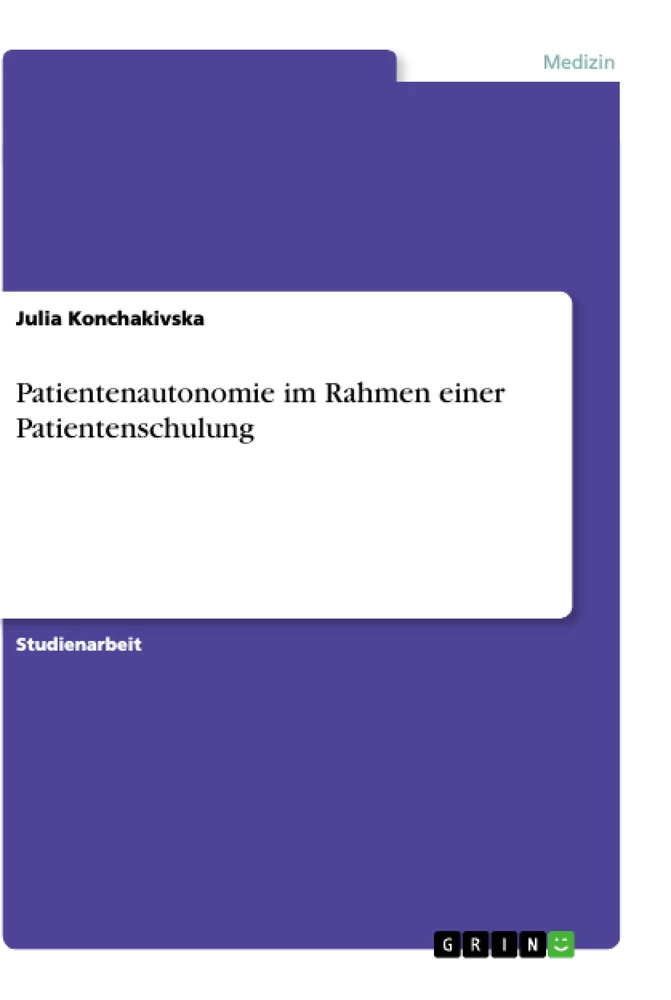Unter dem medizinethischen Begriff der Patientenautonomie wird das Recht des Patienten verstanden, über jeglichen diagnostischen und therapeutischen Eingriff durch Zustimmung oder Ablehnung selbst zu entscheiden. Neben
Patientenkompetenz bzw. Gesundheitskompetenz, Patientenorientierung, Teilhabe und Empowerment gehört partizipative Entscheidungsfindung (aus dem Englischen „Shared Decision Making“, bzw. SDM) zu den Bestandteilen der Patientenautonomie.
Es ist eine relativ neue Wendung in der Medizin, die Patienten im Rahmen ihrer Behandlung immer mehr in den Prozess des Entscheidungstreffens miteinzubeziehen. Eine paternalistisch geprägte medizinische Versorgung, die noch vor ca. 30 Jahren
vorherrschend war, ist durch eine asymmetrische Kommunikation zwischen Arzt und Patienten gekennzeichnet. Im Rahmen des paternalistischen Modells verfügt der Arzt über die autoritäre Entscheidungsmacht, was die Behandlung des Patienten betrifft, jedoch übernimmt auch die volle Verantwortung für die getroffene Entscheidung. Der Patient spielt dabei eine passive Rolle.
1. Theoretische Fundierung zum Thema Patientenautonomie
Unter dem medizinethischen Begriff der Patientenautonomie wird das Recht des Patienten verstanden, über jeglichen diagnostischen und therapeutischen Eingriff durch Zustimmung oder Ablehnung selbst zu entscheiden (Schöne-Seifert, 2007). Neben Patientenkompetenz bzw. Gesundheitskompetenz, Patientenorientierung, Teilhabe und Empowerment gehört partizipative Entscheidungsfindung (aus dem Englischen „ Shared Decision Making“, bzw. SDM ) zu den Bestandteilen der Patientenautonomie.
Es ist eine relativ neue Wendung in der Medizin, die Patienten1 im Rahmen ihrer Behandlung immer mehr in den Prozess des Entscheidungstreffens miteinzubeziehen. Eine paternalistisch geprägte medizinische Versorgung, die noch vor ca. 30 Jahren vorherrschend war, ist durch eine asymmetrische Kommunikation zwischen Arzt und Patienten gekennzeichnet. Im Rah-men des paternalistischen Modells verfügt der Arzt über die autoritäre Entscheidungsmacht, was die Behandlung des Patienten betrifft, jedoch übernimmt auch die volle Verantwortung für die getroffene Entscheidung. Der Patient spielt dabei eine passive Rolle. Im Gegensatz dazu werden Arzt und Patient in dem Modell der partizipativen Entscheidungsfindung (PEF) als gleichwertige Partner angesehen und die zentrale Rolle in der Behandlung wird den Interessen des Patienten verliehen (Vogel, Helmes & Bengel, 2006).
Die Paradigma Wechsel in der Arzt-Patient-Beziehung kann laut Bergelt und Härter (2010) durch folgende Aspekte begründet werden:
- Verbesserung des Zugangs bei Patienten zu den Fachinformationen über ihre Erkrankungen und derer Behandlung
- Erweiterung der Behandlungsoptionen, die vergleichbar gleiche Effekte erzielen, wodurch Patient die Rolle der „letzten Instanz“ bei dem Entscheidungstreffen übernimmt
- Die Verpflichtung der Ärzte (aufgrund von Patientenrechten), Patienten über alle Chancen und Risiken verschiedener Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären.
Laut Härter (2004) verläuft die partizipative Entscheidungsfindung als Interaktionsprozess, der durch gleichberechtigte aktive Beteiligung von Arzt und Patient und auf Basis geteilter Information zu einer Einigung führen soll, für welche die beiden Beteiligten die Verantwortung tragen. Ein anderes relevantes Merkmal dieses Modells ist der Fluss der Information, welcher in beiden Richtungen stattfindet: Vom Arzt zu Patient und von Patient zu Arzt. Dabei stellt der Arzt die medizinische Information zur Verfügung und der Patient berichtet über eigene Wünsche und für die Behandlung wichtige persönliche Lebensumstände (Bergelt & Härter, 2010).
Von Charles, Gafni und Whelan (1999) wurden für die Charakterisierung von SDM folgende Merkmale beschrieben:
- mindestens zwei Personen (Arzt und Patient) sind an dem Entscheidungstreffen betei-ligt
- es werden von beiden Parteien Schritte im Prozess der Entscheidungsfindung unternommen
- das Teilen von Informationen ist eine wichtige Voraussetzung für das
Entscheidungstreffen
- die Zustimmung zu der ausgewählten Behandlung wird von beiden Seiten gegeben.
(Warum) ist das Modell der partizipativen Entscheidungsfindung überhaupt wichtig? Wie es schon bereits erwähnt wurde, ist der Zugang zu medizinischen Fachinformationen heutzutage sehr leicht. Das führt dazu, dass Patienten sich selbstständig über ihre Erkrankungen und de- ren Behandlungsoptionen informieren (können). Dementsprechend gelten Patienten in Bezug auf ihre Krankheiten als „Experte“, mit derer Meinung im Behandlungsprozess gerechnet werden soll. Hölzel, Kriston und Härter (2013) fanden in ihrer Studie zur Shared Decision Making heraus, dass die Steigerung der Beteiligung von Patienten an dem Behandlungsprozess zu der Reduktion des Entscheidungskonflikts führt. Die hohe Beteiligung und der niedrige Entscheidungskonflikt führen bei Patienten dementsprechend zu höherer Zufriedenheit mit ihrem Arzt, was bei vielen Patienten, vor allem bei chronisch Erkrankten von großer Relevanz ist.
Jedoch sind nicht alle Patienten dafür bereit, an dem Behandlungsprozess aktiv teilzunehmen. So wurde es anhand von etlichen Studien festgestellt, dass bestimmte Eigenschaften bzw. Merkmale eine höhere bzw. niedrigere Bereitschaft für die SDM vorhersagen können. Hölzel, Kriston und Härter (2013) fanden beispielsweise heraus, dass jüngere Patienten mit höherem Bildungsniveau eher zu der partizipativen Entscheidungsfindung neigen. Die Studie von Aurora und McHorney (2000) zeigte außerdem, dass weibliches Geschlecht und ein geringe- rer Schweregrad der Krankheit mit der größeren Bereitschaft für Shared Decision Making zusammenhängen.
Obwohl es sich viele positive Wirkungen von PEF beweisen lassen, ist jedoch die gemeinsame Entscheidungsfindung nicht immer für Patienten von Vorteil. Laut Müller- Engelmann et al. (2010) ist die PEF in Krisen- und Notfallsituationen und bei Patienten, die sich dadurch überfordert fühlen, eher zu vermeiden. Darüberhinaus wird die Entscheidung alleine durch den Arzt auch dann getroffen, wenn es eine eindeutige Evidenz zugunsten einer einzigen Behandlungsoption gibt oder wenn die Bedeutsamkeit der Erkrankung für den Patienten gering ist (Bergelt & Härter, 2010).
Vor allem bei chronischen Krankheiten wie Krebs, wo viele Behandlungsoptionen zur Verfü- gung stehen, kann die PEF sowohl für Patienten als auch für Ärzte von großem Vorteil sein. Eine allgemeine Wirkung von der Partizipation der Krebserkrankten an der Entscheidungsfin- dung wurde von Hack, Degner, Watson und Sinha (2006) untersucht. An der Studie nahmen 205 Frauen teil, bei denen Brustkrebs diagnostiziert wurde. Die Variablen, die untersucht wurden, waren der Partizipationsgrad der Patienten bei dem Entscheidungstreffen bezüglich der ausgewählten Behandlung und die Lebensqualität. Die Ergebnisse zeigten, dass die Frauen, die sich in der Zeit der Erkrankung für eine aktive Teilnahme an der Entscheidungsfindung entschieden, zeigten in der Nachsorge weniger Fatigue- Merkmale, bessere Lebensqualität, besseren physischen Zustand und waren besser in das soziale Leben eingebunden.
Ernst, Schwarz und Krauß (2004) interessierten sich dafür, bei welchen Aspekten Tumorpatienten am häufigsten mitentscheiden wollen. So stellten sie in ihrer Studie zu SDM fest, dass Tumorpatienten vor allem bei der Therapiewahl, den Rahmenbedingungen der ausgewählten Therapie (Ort, Zeitpunkt) und bei der Frage, ob Familienmitglieder an dem Behandlungsprozess teilnehmen sollen, mitbestimmen wollen. Leider kann vor allem der Wunsch, bei der Therapiewahl mitzuentscheiden, bei manchen Erkrankten nicht erfüllt werden. Häufig ist die ungenügende Informiertheit der Patienten der Grund dafür. So fanden Fallowfield, Ford und Lewis (1995) in ihrer Studie heraus, dass Ärzte nicht selten dazu neigen, die Informationen von Patienten über ihre Krankheiten vorzuenthalten, wenn diese Informationen zu komplex oder negativ konnotiert sind. Es ist vor allem dann der Fall, wenn Ärzte einen Mangel an Kompetenzen im Umgang mit Patientenreaktionen aufweisen. Im Gegensatz dazu gab die Mehrheit (94%) von Krebserkrankten an, so viel Information wie möglich über ihre Diagnose, Prognose, Behandlungsoptionen und deren Nebenwirkungen, vom Arzt bekommen zu wollen.
Jones et al. (1999), Stewart (1995), Fallowfield, Ford und Lewis (1995) beschäftigten sich mit der Frage der ungenügenden Informiertheit bei Krebspatienten und deren Folgen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Krebserkrankten, die sich mangelhaft über ihre Erkrankungen informiert fühlten, empfanden sich allgemein unsicherer und schlechter, zeigten eher Merkmale von Ängstlichkeit und Depression und neigten eher dazu, „ungünstige“ Entscheidungen zu treffen. Im Gegensatz dazu zeigten Mills und Sullivan (1999), Street und Voigt (1997), dass ausreichende Informiertheit bei Krebspatienten bzw. derer subjektives Gefühl mit besserer Lebensqualität, höherer Zufriedenheit, besserer Krankheitsbewältigung und besserer Compliance zusammenhängen.
Im Rahmen der PEF wird heutzutage oft darüber diskutiert, wie dieser Prozess von beiden beteiligten Seiten verbessert werden kann. Es werden beispielsweise unterschiedliche Weiter- und Fortbildungen für Ärzte verschiedener Fachrichtungen angeboten, um ihre kommunikati- ven Fähigkeiten zu optimieren (Bergelt & Härter, 2010). Es werden auch bestimmte Anforderungen an Ärzten im Rahmen der PEF gestellt: Empathie dem Patienten gegenüber, erschöpfende Diagnoseaufklärung, Erläuterung von Behandlungsoptionen bzw. deren Risiken und Chancen, Eingehen auf Wünsche, Erwartungen, Ängste und Präferenzen des Patienten (Härter, 2004). Bergelt und Härter (2010) betonen, dass für eine erfolgreiche partizipative Entscheidungsfindung auch auf Patientenebene bestimmte Voraussetzungen erfüllt und spezifische Kompetenzen vorhanden sein müssen. Die erste Voraussetzung besteht in der Fähigkeit, eigene Gesundheitsprobleme, Gefühle, Einstellungen und Erwartungen wahrnehmen zu können und darüber dem Arzt zu berichten. Als zweites wird es von Patienten erwartet, dass sie Informationen aufnehmen und bewerten können. Außerdem müssen Patienten bei der Entscheidungsfindung entstehende Konflikte besprechen können. Letztendlich müssen Patienten in der Lage sein, nach der gegenseitigen Einigung hinsichtlich des Handlungsplans ihn auch umzusetzen.
Um Patientenrechte auf der Makroebene zu verstärken wurde im Jahr 2013 das neue Patientenrechtegesetz verabschiedet. Nichtdestotrotz lässt sich immer wieder beobachten, dass Patienten sich nicht trauen und/oder sich unsicher und gehemmt fühlen, Ärzten zusätzliche Fragen zu stellen, eigene Präferenzen zu äußern usw. Deshalb ist es sehr relevant, Patientenschulungen durchzuführen, um eine stärkere Beteiligung von Patienten am medizini- schen Entscheidungsprozess zu fördern.
2. Patientenschulung zum Thema Patientenautonomie bei Patienten mit Brustkrebs
Das Patientenschulungsmodul umfasst 90 Minuten und wird bei Patienten mit der Diagnose „Brustkrebs“ durchgeführt. Dieses Modul findet nach dem ersten „Kennenlernen“ Modul statt, in dem sich die Teilnehmenden kennenlernten und sich über eigene Geschichten, Wünsche, Erwartungen usw. in Bezug auf die Patientenschulung austauschten. Im Rahmen des aktuellen Moduls wird der Schwerpunkt auf die Verstärkung der Partizipation von Patienten im Entscheidungsfindungsprozess durch bessere Informiertheit gelegt. Das sollte vor allem durch das Trainieren kommunikativer Fertigkeiten und sichereres Auftreten beim Patient-Arzt-Gespräch erfolgen.
Ziel 1. Vermittlung des Wissens über das paternalistische Modell und das Modell der partizipativen Entscheidungsfindung. Nicht selten erleben Patienten im Rahmen der Arzt- Patient-Kommunikation nur das paternalistische Modell. Deswegen ist es wichtig, die Patienten über die Alternativen diesbezüglich zu informieren und somit die Basis für das Verhalten im Rahmen der PEF zu erschaffen.
[...]
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde stets die männliche Schreibform gewählt, diese wird stellvertretend für die Bezeichnung beider Geschlechter verwendet.)
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Patientenautonomie?
Patientenautonomie ist das Recht des Patienten, über diagnostische und therapeutische Eingriffe nach umfassender Aufklärung selbst zu entscheiden.
Was ist „Shared Decision Making“ (SDM)?
Es handelt sich um eine partizipative Entscheidungsfindung, bei der Arzt und Patient als gleichwertige Partner auf Basis geteilter Informationen gemeinsam über die Behandlung entscheiden.
Warum hat sich das Paternalismus-Modell in der Medizin geändert?
Gründe sind der bessere Zugang der Patienten zu Fachinformationen, erweiterte Behandlungsoptionen und gesetzliche Verpflichtungen der Ärzte zur Aufklärung.
Welche Vorteile bietet die Beteiligung für Krebspatienten?
Studien zeigen, dass aktive Teilnahme an Entscheidungen zu einer besseren Lebensqualität, weniger Fatigue und einer besseren Krankheitsbewältigung führt.
Gibt es Situationen, in denen Shared Decision Making ungeeignet ist?
Ja, in akuten Notfällen, bei Überforderung des Patienten oder wenn es nur eine einzige medizinisch sinnvolle Behandlungsoption gibt, ist das Modell weniger anwendbar.
- Quote paper
- Julia Konchakivska (Author), 2018, Patientenautonomie im Rahmen einer Patientenschulung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459503