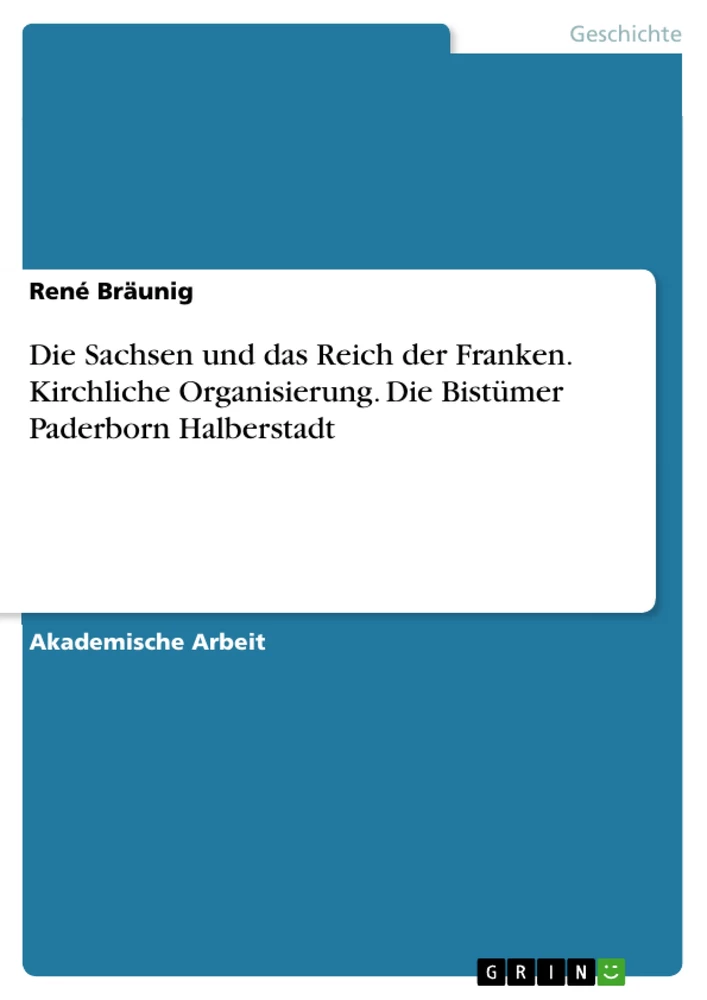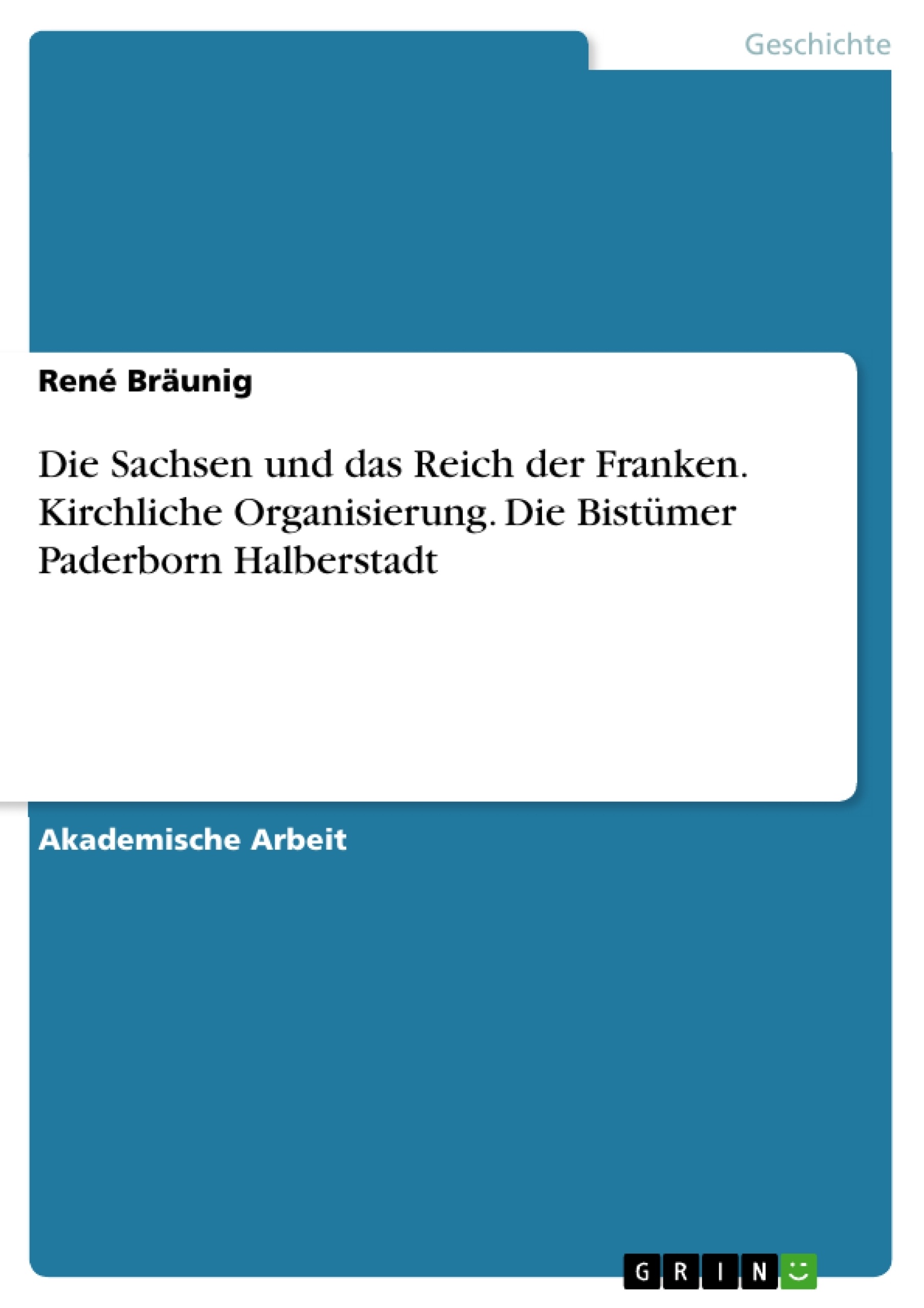Ziel dieser Arbeit soll es sein, an den Beispielen der Bistumsgründungen von Paderborn und Halberstadt die Rolle des Bistums bei der Festigung der fränkischen Herrschaft im sächsischen Stammesgebiet zu klären.
Die gesellschaftliche Ordnung der Franken ruhte in der Karolingerzeit auf den Säulen Königtum, Grafschaft und Bistum.
An die Stelle der sächsischen Gaue waren von der fränkischen Verwaltung im Zuge der Eroberung neue raumpolitische Organisationen gesetzt worden: im kirchlichen Bereich das Bistum und das Kirchspiel der Taufkirche (Urpfarr- bzw. Mutterkirche) und der daraus entwickelte Dekanat bzw. Archdiakonat, im Bereich der Rechtsprechung und der fiskalischen Verwaltung der Komitat, die Grafschaft, die auch für das militärische Aufgebot zuständig war. Darüber stand, zunächst als rein militärische Institution, das Herzogtum.
Das Bistum war der Gerichts- und Verwaltungsbezirk des Bischofs, gleichbedeutend mit der Diözese. Mehrere Bistümer sind in der Regel zusammengefaßt zu einer Kirchenprovinz unter der Oberleitung eines Metropoliten, des Vorstehers des Erzbistums.
Diese Herrschaftsgebiete sind im Zuge der Institutionalisierung der katholischen Kirche bereits im 4. Jahrhundert genauer abgegrenzt. Zentrum war eine civitas (römische Stadt).
„Die bischöfliche Gewalt umfaßte Priesterweihe, kirchliche Aufsicht über die Pfarreien, Visitationspflicht in allen Klöstern und Rechtsprechung. Zumal sie (die Bischöfe, der Verfasser) aus den mächtigsten Familien eines Reiches kamen, waren sie keineswegs nur geistliche Instanzen, sondern Feudalherren, die auch weltliche Macht ausübten, über ihre Bischofsstadt, ihre Territorien (Hochstifte), ihre königlichen Lehen, als Reichsverweser, als Mitglied des Kronrates, als Kurfürsten usw.“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Auswahl der Bischofssitze
- Frühe Missionsversuche
- 3. DIE QUELLEN ÜBER DIE SACHSENKRIEGE UND DIE MISSIONIERUNG
- a.) Zeitgenössische Quellen
- 1.) Die Briefliteratur
- 2.) Karolingische Annalen
- b.) Quellen bis zum 10. Jahrhundert
- 1.) Abhängige Werke
- 2.) Selbständige Darstellungen
- a.) Zeitgenössische Quellen
- 4. SYNODEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER MISSIONIERUNG DER SACHSEN
- 5. DIE FRÄNKISCHE KIRCHE UND DIE HEIDNISCHE RELIGION
- a.) Der Weg der Christianisierung
- b.) Veränderung im Recht der Sachsen
- c.) Die dänische Rolle beim sächsischen Widerstand
- 6. PADERBORN
- a.) Die Wahl des Ortes
- b.) Die Dombauten in Sachsen
- c.) Die Pfalz und die Bischofsstadt
- d.) Zum Begriff der Grundherrschaft
- e.) Der Papstbesuch 799
- f.) Die kirchliche Organisierung
- 7. HALBERSTADT
- a.) Die Vorbesiedlung des Halberstädter Raums
- b.) Die Gründung des Bistums Halberstadt
- c.) Die Bauten dse Bischofssitzes in der Frühphase
- d.) Die Ausbauten zur Domkirche
- e.) Der Dom von 859
- f.) Die Stadtanlage
- g.) Die ersten Bischöfe des Bistums Halberstadt
- h.) Die Grenzen des Bistums Halberstadt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, an den Beispielen der Bistumsgründungen von Paderborn und Halberstadt die Rolle des Bistums bei der Festigung der fränkischen Herrschaft im sächsischen Stammesgebiet zu klären.
- Die Entstehung und Entwicklung der Bistümer Paderborn und Halberstadt
- Die Bedeutung der Bischöfe für die fränkische Herrschaft in Sachsen
- Die Rolle der Kirche bei der Christianisierung der Sachsen
- Die Organisation und Struktur der fränkischen Kirche in Sachsen
- Die Interaktion zwischen fränkischer Herrschaft und sächsischer Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die gesellschaftliche Ordnung der Franken in der Karolingerzeit vor, die auf den Säulen Königtum, Grafschaft und Bistum beruhte. Die fränkische Verwaltung hatte nach der Eroberung neue raumpolitische Organisationen im sächsischen Gebiet etabliert, darunter das Bistum im kirchlichen Bereich und die Grafschaft im Bereich der Rechtsprechung und Verwaltung. Der Aufbau von Bistümern spielte eine wichtige Rolle für die dauerhafte Beherrschung der neu hinzugekommenen Gebiete. Das zweite Kapitel beleuchtet die Auswahl der Bischofssitze und die frühen Missionsversuche. Bereits unter Bonifatius wurden Kompromisse bei der Auswahl der Bischofssitze eingegangen, da der Osten des Frankenreiches keine alten Städte wie Köln oder Mainz aufwies. Die Wahl fiel auf Orte mit geographischen oder fortifikatorischen Besonderheiten. Der Schwerpunkt liegt auf der angelsächsischen Mission, die eine wichtige Rolle bei der Christianisierung der Sachsen spielte.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen dieser Arbeit sind: Bistumsgründung, fränkische Herrschaft, Sachsen, Christianisierung, Kirche, Organisation, Gesellschaft, Raumpolitik, Verwaltung, Missionsversuche, angelsächsische Mission, Bonifatius, Paderborn, Halberstadt.
- Quote paper
- Diplomkaufmann, Magister Artium René Bräunig (Author), 2003, Die Sachsen und das Reich der Franken. Kirchliche Organisierung. Die Bistümer Paderborn Halberstadt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459100