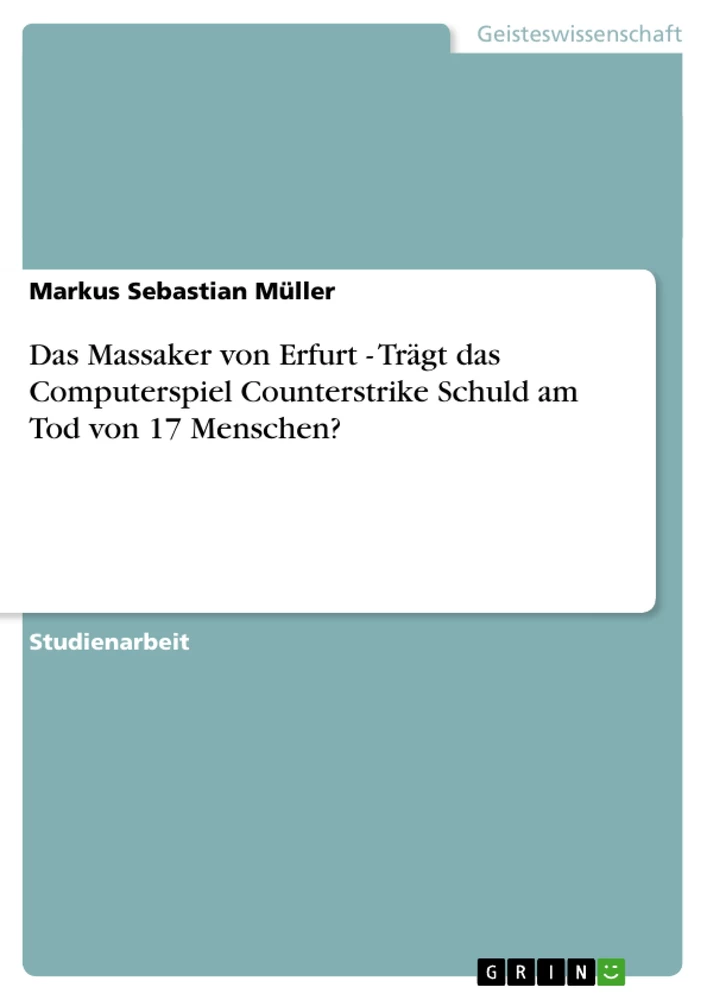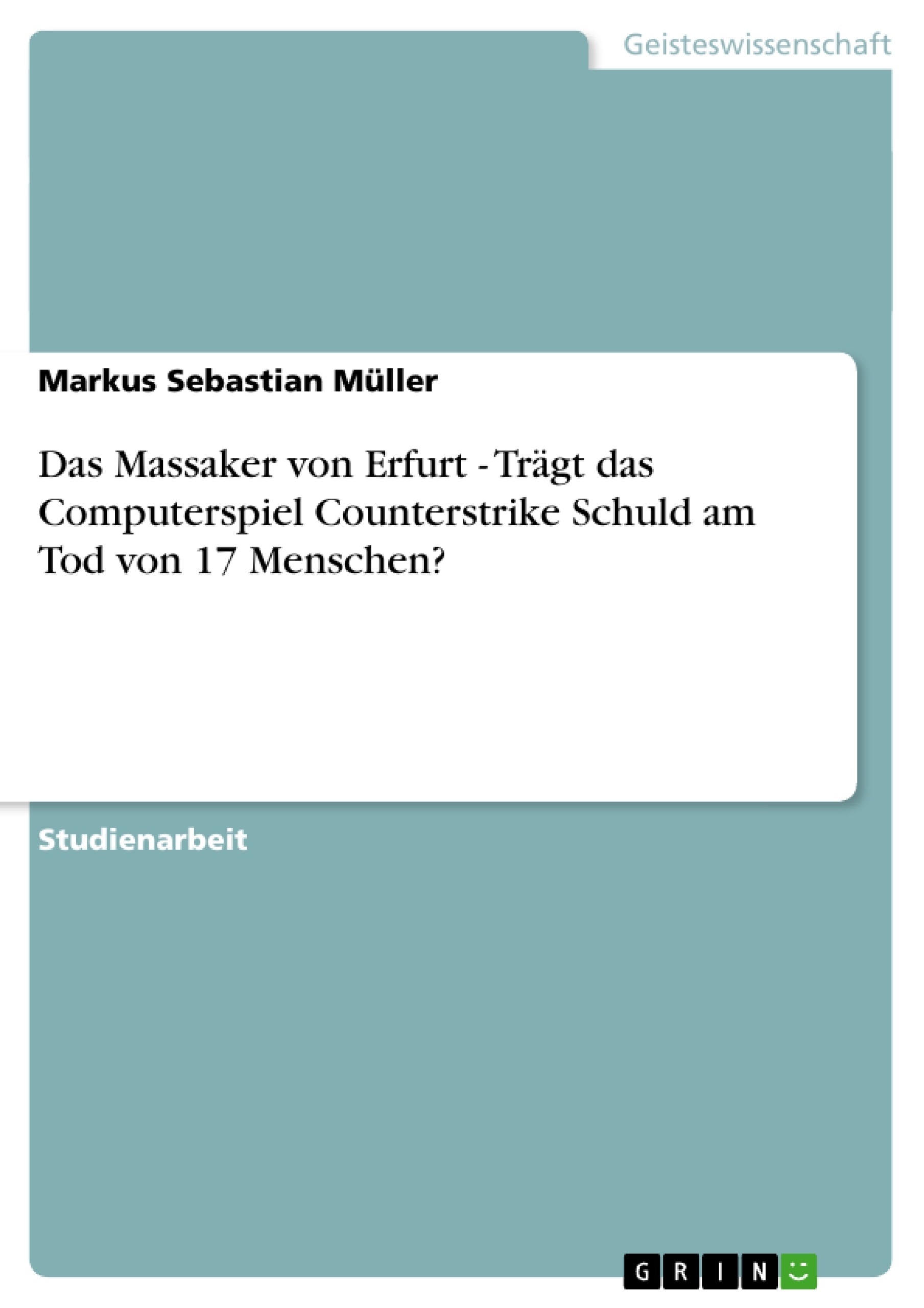„Mehr als das Gold hat das Blei die Welt verändert“. Diese Äußerung des Schriftstellers Georg Christoph Lichtenberg1 sollte den Erfinder des Buchdrucks, Johannes Gutenberg, ehren. Doch am 26. April vergangenen Jahres erhielt dieser Satz auf tragische Weise eine neue Bedeutung.
Die Stunden ab 11 Uhr an jenem Freitag wird Deutschland ebenso wenig vergessen wie die USA den 11. September. Denn am 26. April 2002 stürmte der 19-jährige Robert Steinhäuser seine ehemalige Schule, das Johannes-Gutenberg-Gymnasium in Erfurt. Was sich daraufhin im Gebäude abspielte, ist bis heute für viele Menschen unfassbar: Steinhäuser erschoss zwölf Lehrer, eine Sekretärin, eine 14-jährige Schülerin, einen 15-jährigen Schüler sowie einen Polizisten. Anschließend nahm er sich selbst das Leben.
In der darauffolgenden ausführlichen und langfristigen Berichterstattung wurde in den Medien häufig der Begriff „Amoklauf“ verwendet. Für die Beschreibung der Ereignisse in Erfurt ist dieser Begriff jedoch unzutreffend, denn ein Amokläufer handelt im Affekt und schießt wie von Sinnen wild um sich. Dies war bei Steinhäuser nicht der Fall: Er hatte das Massaker genauestens vorbereitet, ging nach einem akribisch ausgearbeiteten Plan vor und setzte seine Waffe gezielt ein.
Bei seinen Vorbereitungen kam nach Ansicht vieler Experten und Medien dem Computerspiel „Counterstrike“ eine tragende Rolle zu. Robert Steinhäuser spielte es nach Aussagen seiner Mitschüler tage- und nächtelang. Bereits wenige Stunden nach bekannt werden der Ereignisse in Erfurt und der Tatsache, dass sich Steinhäuser in seiner Freizeit oft und gern mit „Counterstrike“ beschäftigte, stellten einige Experten einen Zusammenhang zwischen dem Computerspiel und dem Massaker her. Am folgenden Tag forderten u.a. Bayerns Ministerpräsident, der damalige Kanzlerkandidat Edmund Stoiber (CSU), sein Innenminister Günther Beckstein (CSU) sowie der damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement (SPD), gewalthaltige Computerspiele zu verbieten. Der renommierte Münchner Rechtsanwalt Michael Witti gab bekannt, den Spieleproduzenten verklagen und Schadensersatz für die Angehörigen der Opfer fordern zu wollen.
Kann „Counterstrike“ tatsächlich als die vorrangige Ursache der Morde von Erfurt angesehen werden? Und trägt somit die Unterhaltungsindustrie Mitschuld am Tod von 17 Menschen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Massaker von Erfurt - trägt das Computerspiel „Counterstrike" Schuld am Tod von 17 Menschen?
- Aggressions- und Aggressivitätsforschung
- Klärung des Aggressions- und Aggressivitätsbegriffs
- Ansätze zur Erklärung von Aggressionen
- Der triebtheoretische Ansatz
- Die Frustrations-Aggressions-Hypothese
- Der motivationstheoretische Ansatz
- Das Motiv der Aggressionsvermeidung
- Das Spiel „Counterstrike"
- Thesen zur möglichen Wirkung von Gewalt in Computerspielen auf Jugendliche und speziell auf Robert Steinhäuser
- Die Katharsisthese
- Die Inhibitionsthese
- Die Habitualisierungsthese
- Die Imitationsthese
- Einwände gegen die Imitationsthese
- Weitere für die Ursachenforschung und Aufklärung des Massakers relevante Aspekte
- Der Schulverweis
- Der Musikkonsum
- Fehlende soziale Kontakte
- Die Schützenvereine
- Das familiäre Umfeld
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Massaker von Erfurt, das sich am 26. April 2002 ereignete, und analysiert die mögliche Rolle des Computerspiels „Counterstrike" bei dieser Tragödie. Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen Faktoren, die zu dem Ereignis geführt haben könnten, zu beleuchten und die Frage zu untersuchen, ob und inwieweit das Spiel eine ursächliche Rolle gespielt haben könnte.
- Analyse des Begriffs „Aggression“ und der unterschiedlichen Theorien zur Erklärung von aggressivem Verhalten.
- Untersuchung des Computerspiels „Counterstrike“ und seiner potenziellen Auswirkungen auf Jugendliche.
- Beurteilung verschiedener Thesen zur Wirkung von Gewalt in Computerspielen, wie der Katharsis-, Inhibition-, Habitualisierungs- und Imitationsthese.
- Diskussion weiterer relevanter Faktoren, die zum Massaker von Erfurt beigetragen haben könnten, wie z.B. der Schulverweis, der Musikkonsum und das familiäre Umfeld.
- Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet eine einführende Darstellung des Massakers von Erfurt und seiner Folgen. Es wird die Debatte über die mögliche Rolle von „Counterstrike“ beleuchtet und der Begriff „Amoklauf“ im Kontext der Ereignisse in Erfurt diskutiert.
Im zweiten Kapitel wird zunächst die Aggressions- und Aggressivitätsforschung beleuchtet. Der Begriff „Aggression“ wird definiert und verschiedene Theorien zur Erklärung von aggressivem Verhalten werden vorgestellt, darunter der triebtheoretische Ansatz, die Frustrations-Aggressions-Hypothese und der motivationstheoretische Ansatz.
Kapitel 2 widmet sich dann dem Computerspiel „Counterstrike“ und seinen potenziellen Auswirkungen auf Jugendliche. Verschiedene Thesen zur Wirkung von Gewalt in Computerspielen werden analysiert, darunter die Katharsisthese, die Inhibitionsthese, die Habitualisierungsthese und die Imitationsthese. Die Arbeit beleuchtet auch Einwände gegen die Imitationsthese.
Abschließend werden im dritten Kapitel weitere relevante Aspekte für die Ursachenforschung und Aufklärung des Massakers von Erfurt behandelt, wie der Schulverweis, der Musikkonsum, fehlende soziale Kontakte, die Schützenvereine und das familiäre Umfeld.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Aggression, Aggressivität, Computerspiele, Gewalt, „Counterstrike“, Massaker, Amoklauf, Katharsis, Inhibition, Habitualisierung, Imitation, Ursachenforschung, und die Tragödie von Erfurt. Die Arbeit beleuchtet das komplexe Zusammenspiel von individuellen Faktoren, gesellschaftlichen Einflüssen und medialen Inhalten, die zur Entstehung von Gewalt beitragen können.
- Quote paper
- Markus Sebastian Müller (Author), 2003, Das Massaker von Erfurt - Trägt das Computerspiel Counterstrike Schuld am Tod von 17 Menschen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45909