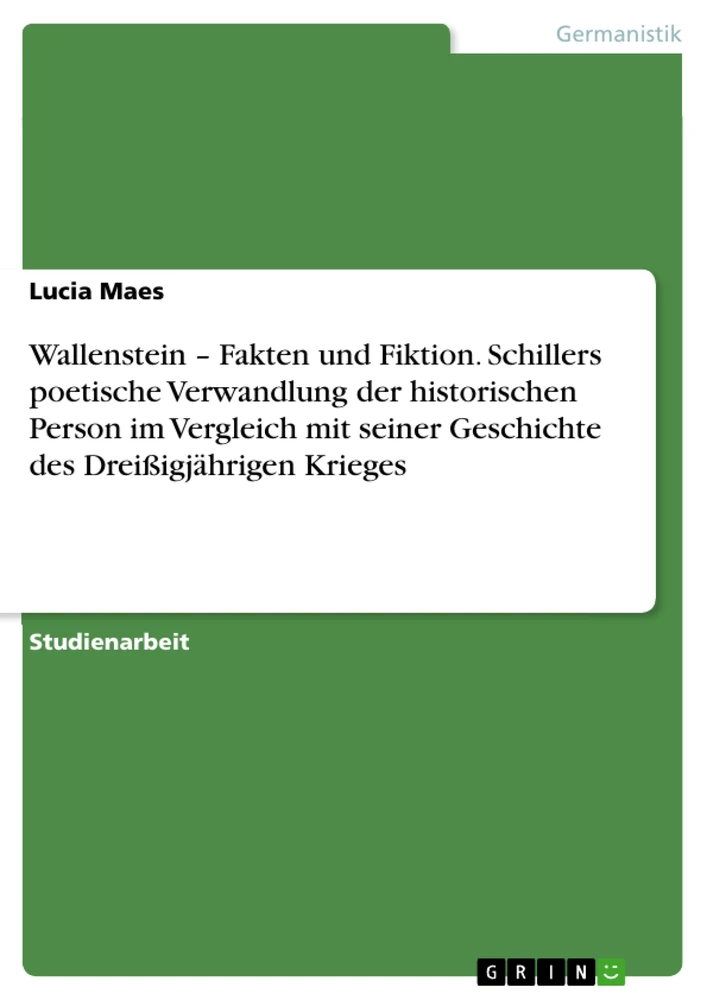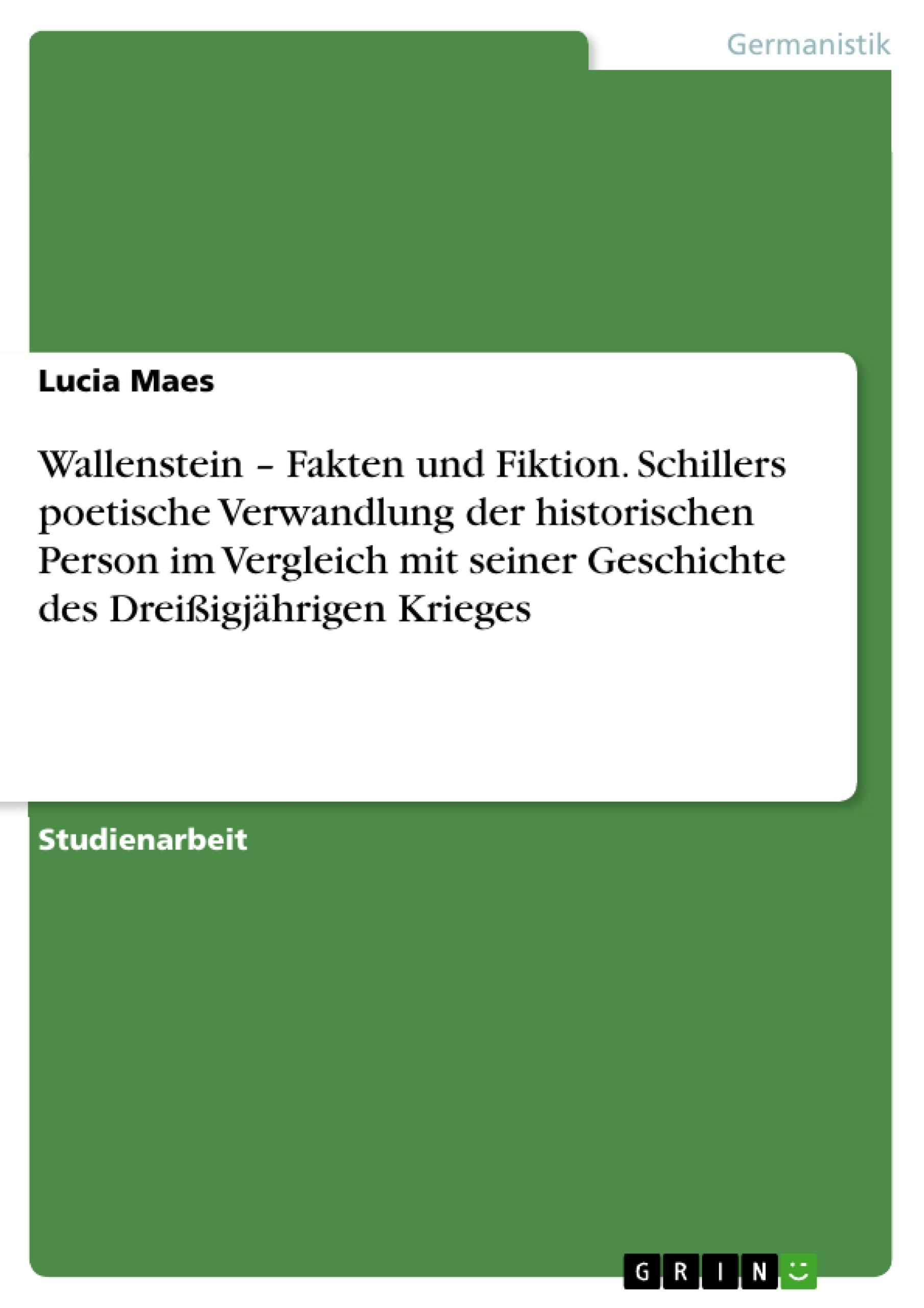Der Wallenstein des Dramas ist nicht der historische Wallenstein? Schiller, der sich aus finanziellen Gründen dazu überreden ließ, die Geschichte des dreißigjährigen Krieges zu verfassen, schrieb daraufhin ein Drama über eine der wichtigsten und Aufsehen erregendsten Persönlichkeiten eben dieses Krieges. Ein geschichtliches Werk steht neben einem poetischem Drama, beide verbindet dasselbe Sujet, der Titelheld des Dramas, und dieselbe Hand, die sie niederschrieb. Schiller, der an der Jenaer Universität Geschichte lehrte, kannte die historischen Fakten.
Worin unterscheidet sich also der Wallenstein des Dramas von dem Wallenstein, über den Schiller in der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges schrieb? Und wie groß ist Schillers Wallenstein? Hat der Dichter, der sich jahrelang mit der Historie auseinander setzen musste, den Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee schließlich noch größer gemacht als er tatsächlich war? Dafür muss festgestellt werden, wie Schiller Wallenstein in der Geschichte des dreißigjährigen Krieges dargestellt hat und inwieweit sich diese Darstellung von der Figur in der Dramentrilogie Wallenstein unterscheidet. Welche historischen Fakten, wie Schiller sie kannte, sind auf das poetische Werk übertragen, welche verändert und welche vollkommen neu erfunden worden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Wallensteinbild
- Die Darstellung von Wallenstein in der Geschichte des dreißigjährigen Krieges
- Schillers Modellierung des Titelhelden in der Dramentrilogie „Wallenstein“
- Die erfundenen Hauptcharaktere des Dramas
- Max Piccolomini als Sinnbild des Ideals
- Thekla als Verkörperung der Tragik
- Buttler als Multiplikator der Dramatik
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen Schillers historischer Darstellung Wallensteins in seiner „Geschichte des Dreißigjährigen Krieges“ und seiner poetischen Gestaltung des Generals in der gleichnamigen Dramentrilogie. Ziel ist es, Schillers literarische Freiheit und die Transformation der historischen Figur im Vergleich beider Werke zu analysieren.
- Schillers literarische Bearbeitung historischer Fakten
- Vergleich der historischen und der dramatischen Figur Wallensteins
- Analyse der erfundenen Charaktere im Drama und ihrer Funktion
- Schillers Intentionen bei der Gestaltung des Wallenstein-Bildes
- Die Rolle von Fiktion und Realität in Schillers Werk
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Unterschieden zwischen Schillers historischer und dramatischer Darstellung Wallensteins. Sie betont die Notwendigkeit eines Vergleichs beider Werke, um Schillers literarische Umsetzung historischer Fakten zu analysieren und das Ausmaß seiner künstlerischen Freiheit zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Schiller die historische Persönlichkeit Wallensteins in seinem Drama transformierte und ob er dessen Bedeutung vergrößerte oder veränderte.
2. Das Wallensteinbild: Dieses Kapitel teilt sich in zwei Unterkapitel auf. Das erste Unterkapitel analysiert Schillers Darstellung Wallensteins in der „Geschichte des Dreißigjährigen Krieges“. Es beschreibt Wallenstein als versierten Offizier und reichen Edelmann, der dem Kaiser eine Armee auf eigene Kosten anbietet. Schiller präsentiert ihn zunächst als ambitionierten, aber auch skrupellosen Machthaber, der durch seine Erfolge und Eroberungen, aber auch durch seine Grausamkeit, auffällt. Das zweite Unterkapitel wird sich mit Schillers Dramatisierung der Figur befassen, welche im folgenden Kapitel näher erläutert wird. Die ersten Eindrücke von Wallenstein sind ambivalent, geprägt von Bewunderung und Kritik zugleich. Schiller präsentiert eine facettenreiche Persönlichkeit, die sowohl bewundernswerte als auch verwerfliche Eigenschaften besitzt.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Wallenstein, Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, Dramentrilogie, historische Figur, literarische Gestaltung, Fiktion, Realität, Vergleich, Charakteranalyse, Ambivalenz, Macht, Ambition, Skrupellosigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Schiller's Wallenstein - Eine literaturwissenschaftliche Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Unterschiede zwischen Schillers historischer Darstellung Wallensteins in seiner „Geschichte des Dreißigjährigen Krieges“ und seiner poetischen Gestaltung in der gleichnamigen Dramentrilogie. Der Fokus liegt auf dem Vergleich beider Werke, um Schillers literarische Freiheit und die Transformation der historischen Figur Wallenstein zu untersuchen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Schillers literarische Bearbeitung historischer Fakten; den Vergleich der historischen und dramatischen Figur Wallensteins; die Analyse der erfundenen Charaktere im Drama und deren Funktion; Schillers Intentionen bei der Gestaltung des Wallenstein-Bildes; und die Rolle von Fiktion und Realität in Schillers Werk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Das Wallensteinbild (mit den Unterkapiteln: Darstellung Wallensteins in der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges und Schillers Modellierung Wallensteins in der Dramentrilogie), Die erfundenen Hauptcharaktere des Dramas (mit den Unterkapiteln zu Max Piccolomini, Thekla und Buttler), und Schluss.
Wie wird Wallenstein in der „Geschichte des Dreißigjährigen Krieges“ dargestellt?
In der „Geschichte des Dreißigjährigen Krieges“ wird Wallenstein als versierter Offizier und reicher Edelmann beschrieben, der dem Kaiser eine Armee auf eigene Kosten anbietet. Schiller präsentiert ihn als ambitionierten, aber auch skrupellosen Machthaber, dessen Erfolge und Eroberungen, aber auch seine Grausamkeit, auffallen. Die Darstellung ist ambivalent, geprägt von Bewunderung und Kritik.
Wie unterscheidet sich die Darstellung Wallensteins im Drama von der Darstellung in der Geschichte?
Die Arbeit untersucht genau diesen Unterschied. Es wird analysiert, wie Schiller die historische Persönlichkeit Wallensteins in seinem Drama transformiert und ob er dessen Bedeutung vergrößerte oder veränderte. Der Vergleich der beiden Darstellungen ist zentral für die Arbeit.
Welche Rolle spielen die erfundenen Charaktere im Drama?
Die Arbeit analysiert die erfundenen Charaktere Max Piccolomini, Thekla und Buttler und untersucht ihre Funktion innerhalb des Dramas. Max Piccolomini wird als Sinnbild des Ideals, Thekla als Verkörperung der Tragik und Buttler als Multiplikator der Dramatik betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Wallenstein, Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, Dramentrilogie, historische Figur, literarische Gestaltung, Fiktion, Realität, Vergleich, Charakteranalyse, Ambivalenz, Macht, Ambition, Skrupellosigkeit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Analyse der Unterschiede zwischen Schillers historischer und dramatischer Darstellung Wallensteins. Es soll untersucht werden, wie Schiller seine literarische Freiheit nutzte und die historische Figur im Drama umformte.
- Quote paper
- Lucia Maes (Author), 2017, Wallenstein – Fakten und Fiktion. Schillers poetische Verwandlung der historischen Person im Vergleich mit seiner Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459035