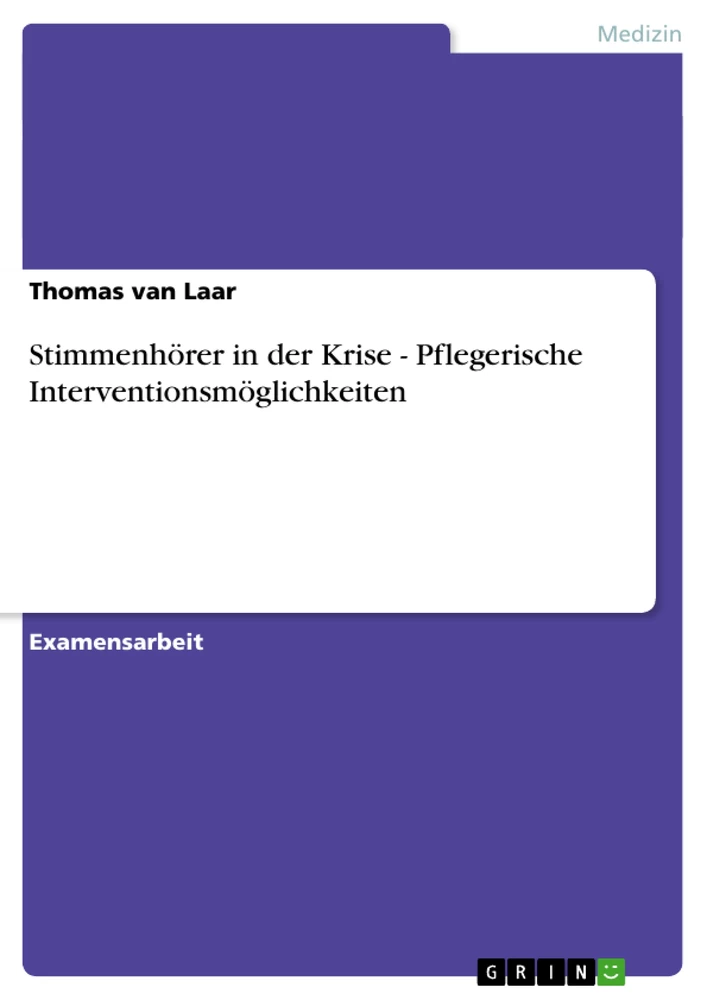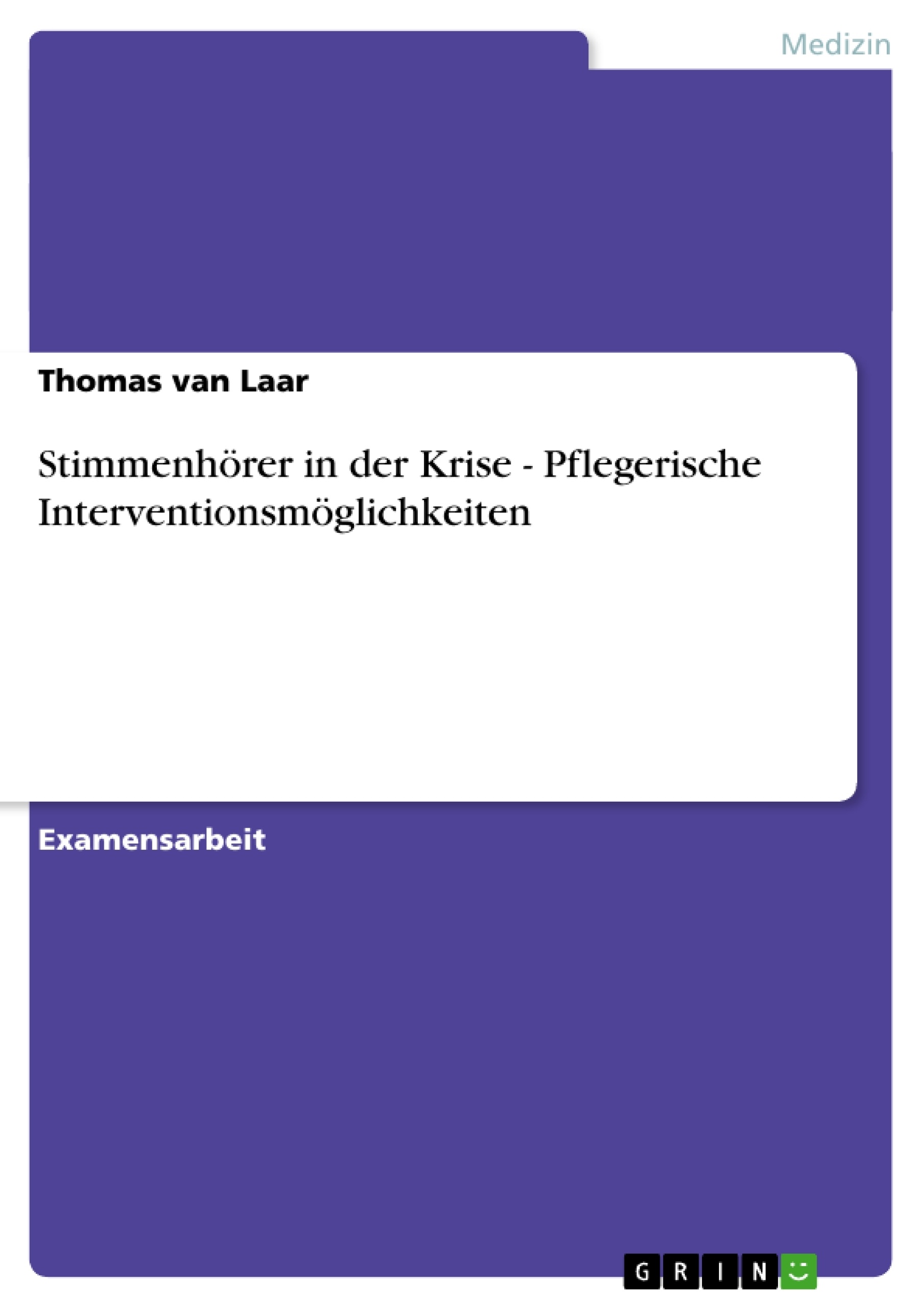„Der Alltag lehrt die Menschen viele Methoden, mit Angst umzugehen und Stress abzubauen. Die Entwicklung ganzer Lebensstiele geschieht auf der Grundlage von Reaktionsmustern, die dazu dienen, belastende Situationen zu bewältigen. Die Lebensstiele sind von Mensch zu Mensch außerordentlich unterschiedlich, gerade in ihrer Verschiedenheit aber unbedingt notwendig, um das seelische Gleichgewicht zu bewahren.“ (Aguilera D., (2000) S.77)
Jeder Mensch muss für sich die richtige Methode wählen um mit belastenden Situationen umzugehen. Reichen diese Methoden jedoch nicht mehr aus und die Belastung wird zu groß, gerät man in eine Krise. Im chinesischen setzt sich das Wort für Krise –weiji- aus den Charakteren für Gefahr –wei- und für Chance –ji- zusammen und weist so auf die zwei möglichen Ausgänge dieser Lebenssituation hin (siehe auch Deckblatt). In der heutigen Gesellschaft sieht man in einer Krise häufig nur die Gefahr, doch besteht darin auch die Möglichkeit etwas zu verändern. Ein Tiefpunkt kann zur Kehrtwende genutzt werden und man lernt und wächst aus den Erfahrungen die man macht wenn man sie überstanden hat. Diese Erfahrungen können einen dann vor der nächsten Krise bewahren, weil man eventuell um Mechanismen weiß dieser vorzubeugen.
In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit dem Thema „Stimmenhörer in der Krise“. Doch was genau sind Stimmenhörer? Hören sie vielleicht auch Stimmen, die ansonsten keiner hört? Natürlich nicht, werden Sie sagen. Stimmen zu hören ist ein Zeichen dafür, dass man den Verstand verliert, das weiß doch jeder! Aber was ist, wenn dem nicht so wäre? Das Phänomen des Stimmenhörens geht bis auf ca. 10.000 Jahre vor Christus zurück. Viele bekannte Persönlichkeiten der Geschichte haben Stimmen gehört und galten keineswegs als „verrückt“. Der Dichter Rainer Maria Rilke und der Prophet Moses, die Äbtissin Hildegard von Bingen und die französische Nationalheldin Jeanne d’Arc. Was ist wenn die Stimmen für einen selbst, einen wichtigen Grund haben oder sogar angenehm sind? Muss das hören von Stimmen direkt krankhaft sein? Also noch einmal: „Hören Sie Stimmen?“
Ich will das Stimmenhören nicht beschönigen. Ich will nur deutlich machen, dass es immer wieder Menschen gibt die mit ihren Stimmen gut leben können und diese nicht als belastend empfinden. Das sind jedoch nicht die Menschen, mit denen ich mich in meiner Arbeit befasse.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Krise
- 2. Krisenintervention
- 2.1 Methodik - Der generelle und der individuelle Ansatz in der Krisenintervention
- 2.1.1 Prinzipien der Krisenintervention
- 2.2 Die drei Ausgleichsfaktoren
- 3. Schizophrenie
- 3.1 Ursachen und Entstehung
- 3.2 Symptomatik
- 3.3 Therapie
- 3.4 Verlauf
- 4. Stimmenhören
- 4.1 Stimmenhörer verstehen
- 4.2 Stimmenhörer - Netzwerk
- 5. Pflegerische Interventionsmöglichkeiten beim Stimmenhören
- 5.1 Umgang mit gefährlichen Stimmen - Krisenintervention
- 5.2 Gruppenarbeit mit Stimmenhörern
- 5.3 Eigene Interventionsmöglichkeiten
- Resümee
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Situation von Stimmenhörern in Krisensituationen und mögliche pflegerische Interventionsansätze. Das Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Herausforderungen dieser Patientengruppe zu entwickeln und Handlungsempfehlungen für die Praxis zu formulieren.
- Definition und Charakterisierung von Krisen im Kontext des Stimmenhörens
- Möglichkeiten der Krisenintervention bei Stimmenhörern
- Der Zusammenhang zwischen Schizophrenie und Stimmenhören
- Das Phänomen des Stimmenhörens aus der Perspektive der Betroffenen
- Pflegerische Interventionsstrategien und deren Wirksamkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Krise: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Krise" anhand verschiedener theoretischer Ansätze und differenziert zwischen Krisen im Reifungsprozess, situativen Krisen und außergewöhnlichen Krisen. Es wird betont, dass eine Krise ein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen einer Situation und den verfügbaren Ressourcen zur Bewältigung darstellt. Im Kontext der Arbeit werden vor allem situative Krisen im Zusammenhang mit dem Stimmenhören betrachtet, wobei sowohl physische als auch psychische Symptome im Vordergrund stehen. Die Definition von Caplan (1964) und Ciompi (1993) werden als Grundlage verwendet und die verschiedenen Krisetypen werden anhand von Beispielen verdeutlicht. Der Fokus liegt auf der Beschreibung von Krisen, die durch das Erleben von Stimmen ausgelöst werden und zu einer Überforderung der Betroffenen führen.
2. Krisenintervention: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Ansätzen der Krisenintervention. Es werden sowohl der generelle als auch der individuelle Ansatz vorgestellt und die Prinzipien der Krisenintervention erläutert. Drei ausgleichende Faktoren im Problemlösungsprozess werden benannt und diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Methodik und den praktischen Aspekten der Intervention, um Betroffene in Krisensituationen zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre Ressourcen zu mobilisieren. Die Kapitel beschreibt verschiedene Interventionsmethoden und deren Anwendung in der Praxis, wobei die Bedeutung von Verständnis und Einfühlungsvermögen hervorgehoben wird.
3. Schizophrenie: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Erkrankung Schizophrenie, da viele Stimmenhörer diese Diagnose erhalten. Es werden Ursachen, Symptome, Therapiemöglichkeiten und der Krankheitsverlauf kurz dargestellt. Der Fokus liegt darauf, den Zusammenhang zwischen Schizophrenie und dem Stimmenhören zu beleuchten und das Stimmenhören als ein mögliches Symptom dieser Erkrankung zu positionieren. Das Kapitel dient als Grundlage für das Verständnis der Erkrankung im Kontext des Themas "Stimmenhörer in der Krise".
4. Stimmenhören: Dieses Kapitel widmet sich dem Phänomen des Stimmenhörens selbst. Es wird erklärt, wie diese Erfahrung von Betroffenen erlebt und verstanden wird, wobei auch verschiedene Beispiele und die Perspektive der Betroffenen berücksichtigt werden. Das Kapitel zielt darauf ab, das Stigma rund um das Stimmenhören zu reduzieren und das Phänomen als komplexes individuelles Erleben darzustellen. Die historischen Beispiele bekannter Persönlichkeiten dienen dazu, die Vielschichtigkeit der Erfahrung zu verdeutlichen und Vorurteile abzubauen.
5. Pflegerische Interventionsmöglichkeiten beim Stimmenhören: Dieser Abschnitt stellt verschiedene pflegerische Interventionsmöglichkeiten beim Stimmenhören vor und zeigt Handlungsoptionen in Krisensituationen auf. Neben dem Umgang mit gefährlichen Stimmen und der Gruppenarbeit mit Stimmenhörern werden auch persönliche und präventive Interventionsmaßnahmen erläutert. Der Fokus liegt darauf, verschiedene Strategien und deren praktische Anwendung in der Pflege darzustellen und aufzeigt, wie wichtig es ist, auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten einzugehen. Die Bedeutung von Verständnis, Einfühlungsvermögen und der Vermeidung von Standardlösungen wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Stimmenhören, Krise, Krisenintervention, Schizophrenie, psychiatrische Pflege, Interventionsmöglichkeiten, psychische Erkrankung, Ressourcen, Coping, Suggestibilität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Krisenintervention bei Stimmenhörern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Situation von Stimmenhörern in Krisensituationen und mögliche pflegerische Interventionsansätze. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Herausforderungen dieser Patientengruppe zu entwickeln und Handlungsempfehlungen für die Praxis zu formulieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Charakterisierung von Krisen im Kontext des Stimmenhörens, Möglichkeiten der Krisenintervention bei Stimmenhörern, den Zusammenhang zwischen Schizophrenie und Stimmenhören, das Phänomen des Stimmenhörens aus der Perspektive der Betroffenen und pflegerische Interventionsstrategien und deren Wirksamkeit.
Wie wird der Begriff "Krise" definiert?
Das Kapitel "Krise" definiert den Begriff anhand verschiedener theoretischer Ansätze und differenziert zwischen Krisen im Reifungsprozess, situativen Krisen und außergewöhnlichen Krisen. Eine Krise wird als Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen einer Situation und den verfügbaren Ressourcen zur Bewältigung dargestellt. Der Fokus liegt auf situativen Krisen im Zusammenhang mit dem Stimmenhören, sowohl physische als auch psychische Symptome werden betrachtet. Die Definitionen von Caplan (1964) und Ciompi (1993) dienen als Grundlage.
Welche Ansätze der Krisenintervention werden vorgestellt?
Das Kapitel "Krisenintervention" stellt den generellen und den individuellen Ansatz vor und erläutert die Prinzipien der Krisenintervention. Drei ausgleichende Faktoren im Problemlösungsprozess werden benannt und diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf Methodik und praktischen Aspekten der Intervention zur Unterstützung Betroffener und zur Mobilisierung ihrer Ressourcen. Verschiedene Interventionsmethoden und deren Anwendung werden beschrieben.
Welchen Stellenwert hat die Schizophrenie in der Arbeit?
Das Kapitel "Schizophrenie" gibt einen Überblick über die Erkrankung, da viele Stimmenhörer diese Diagnose erhalten. Es werden Ursachen, Symptome, Therapiemöglichkeiten und der Krankheitsverlauf kurz dargestellt. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Schizophrenie und Stimmenhören, wobei Stimmenhören als mögliches Symptom positioniert wird. Das Kapitel dient als Grundlage für das Verständnis der Erkrankung im Kontext des Themas.
Wie wird das Phänomen des Stimmenhörens dargestellt?
Das Kapitel "Stimmenhören" widmet sich dem Phänomen selbst. Es wird erklärt, wie diese Erfahrung von Betroffenen erlebt und verstanden wird, unter Berücksichtigung verschiedener Beispiele und der Perspektive der Betroffenen. Ziel ist es, das Stigma zu reduzieren und das Phänomen als komplexes individuelles Erleben darzustellen. Historische Beispiele bekannter Persönlichkeiten verdeutlichen die Vielschichtigkeit und bauen Vorurteile ab.
Welche pflegerischen Interventionsmöglichkeiten werden beschrieben?
Das Kapitel "Pflegerische Interventionsmöglichkeiten beim Stimmenhören" stellt verschiedene pflegerische Interventionsmöglichkeiten vor und zeigt Handlungsoptionen in Krisensituationen auf. Es werden der Umgang mit gefährlichen Stimmen, die Gruppenarbeit mit Stimmenhörern und persönliche/präventive Maßnahmen erläutert. Der Fokus liegt auf verschiedenen Strategien und deren praktischer Anwendung, wobei die Bedeutung des individuellen Bedürfnisses der Patienten und die Vermeidung von Standardlösungen hervorgehoben werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stimmenhören, Krise, Krisenintervention, Schizophrenie, psychiatrische Pflege, Interventionsmöglichkeiten, psychische Erkrankung, Ressourcen, Coping, Suggestibilität.
- Quote paper
- Thomas van Laar (Author), 2005, Stimmenhörer in der Krise - Pflegerische Interventionsmöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45866