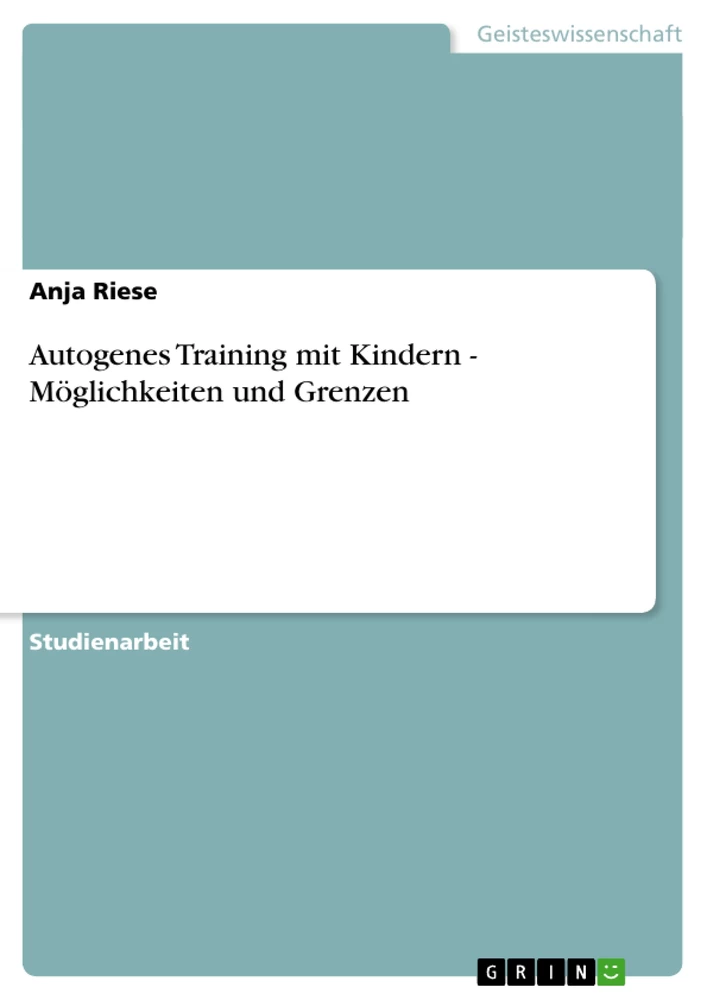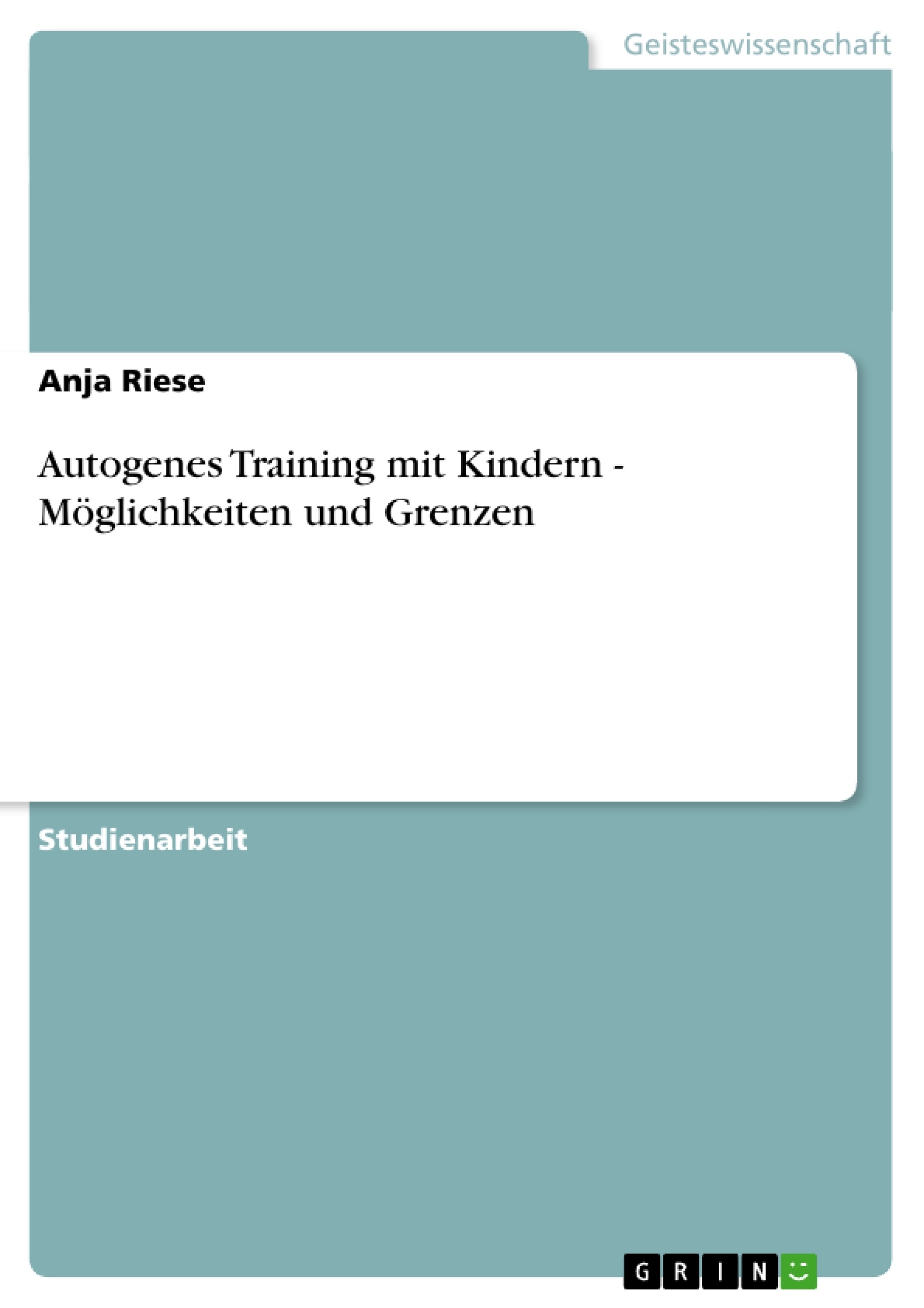Die Schule war sicher zu keiner Zeit ein Ort des reinen Vergnügens, wie E. Müller (1990) treffend feststellt. Doch in den letzten Jahrzehnten haben sich auch die Erwartungen der Eltern und Lehrer an die Kinder verändert. Die Sorgen der Eltern um den Arbeitsplatz und das zukünftige Wohlergehen machen auch vor den Kindern nicht halt. Um ihnen später gute berufliche Perspektiven zu ermöglichen, verlangen viele Eltern hohe Leistungen in Form von „guten“ oder „sehr guten“ Noten von ihren Kindern. Gleichzeitig wird kindgemäßes Verhalten wie Bewegungsdrang oder Ablenkbarkeit immer weniger toleriert und im Vergleich zu früheren Jahrzehnten schneller pathologisiert. Doch diese hohen Leistungsanforderungen, bei gleichzeitig zunehmend schlechteren Lernbedingungen, aufgrund von immer größeren Klassen, weniger Lehrern, etc., gehen tatsächlich an vielen Schülern nicht spurlos vorüber. Dies zeigt sich zunächst vielleicht offen in Angst vor Klassenarbeiten oder allgemeiner Schulangst. Doch bestehen solche durch Überforderung verursachten Ängste längerfristig, führt das zu einer seelischen Dauerspannung, die bald weitreichende und schwerwiegende Auswirkungen hat.
Auf der Verhaltensebene zeigen sich offene oder versteckte Aggressionen, Depressionen, Hyperaktivität, Konzentrationsschwäche oder andere problematische Verhaltens weisen wie übermäßiger Konsum von Süßigkeiten oder gar Alkohol oder Drogen. Ein anderer Weg über den sich die Daueranspannung nach außen hin zeigt, sind psychosomatische Beschwerden oder Erkrankungen, als Zeichen der Überforderung. So haben bereits viele Schüler Kopfschmerzen, Migräne, Magen- Darmbeschwerden oder Schlafstörungen.
llein die Tatsache, dass viele Schüler psychosomatische Beschwerden haben, sollte zu denken geben. Doch verschärft wird die Problematik noch dadurch, dass diese Symptome häufig - unterstützt durch Eltern, Lehrer und Ärzte – mit verschiedenen Medikamenten „behandelt“ werden. Diese Tendenz zum „ lockeren Griff zur Tablette“ ist in mehrfacher Hinsicht bedenklich. Zum einen können die Medikamente z.T. noch ungeklärte Auswirkungen auf die weitere körperliche oder psychische Entwicklung des Kindes haben, insbesondere deshalb, da Kinder aufgrund ihres im Vergleich zu Erwachsenen geringeren Körpergewichts leicht Überdosierungen erhalten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Autogenes Training bei Schulschwierigkeiten: Möglichkeiten und Grenzen
- Indikationen
- Allgemeine Indikationen
- Spezifische Indikationen
- Schlafstörungen
- Bettnässen
- Allergien
- Kontraindikationen
- Das Gruppentraining
- Die Zusammensetzung der Gruppe
- Das Gruppenklima
- Das Üben zuhause
- Die Übungsmodalitäten
- Die einzelnen Übungseinheiten
- Die Rolle der Eltern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Autogenen Training (AT) als Entspannungsverfahren für Kinder und Jugendliche. Der Fokus liegt dabei auf den besonderen Herausforderungen bei der Vermittlung des AT an Kinder und auf dessen Einsatz bei Schulschwierigkeiten.
- Die Indikationen und Kontraindikationen des Autogenen Trainings im Kindes- und Jugendalter
- Die Gestaltung von Gruppentrainings für Kinder und die Rolle der Eltern beim Üben zuhause
- Die Möglichkeiten und Grenzen des Autogenen Trainings bei Schulschwierigkeiten
- Die Bedeutung der Selbstwahrnehmung und Selbststeuerung für Kinder in stressigen Situationen
- Die Notwendigkeit, das Autogene Training nicht zur bloßen Leistungssteigerung zu missbrauchen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik von Leistungsdruck und Überforderung bei Kindern in der heutigen Zeit dar und führt die psychosomatischen Beschwerden ein, die als Folge auftreten können. Kapitel 2 behandelt die Möglichkeiten und Grenzen des Autogenen Trainings bei Schulschwierigkeiten. Es wird betont, dass sowohl interne als auch externe Faktoren bei der Entstehung von Problemen eine Rolle spielen und dass das Autogene Training vor allem die inneren Ressourcen des Kindes stärken kann.
Schlüsselwörter
Autogenes Training, Kinder, Schulschwierigkeiten, Entspannung, Stress, Leistungsdruck, Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, psychosomatische Beschwerden, Gruppentraining, Elternrolle.
- Quote paper
- Anja Riese (Author), 2003, Autogenes Training mit Kindern - Möglichkeiten und Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45831