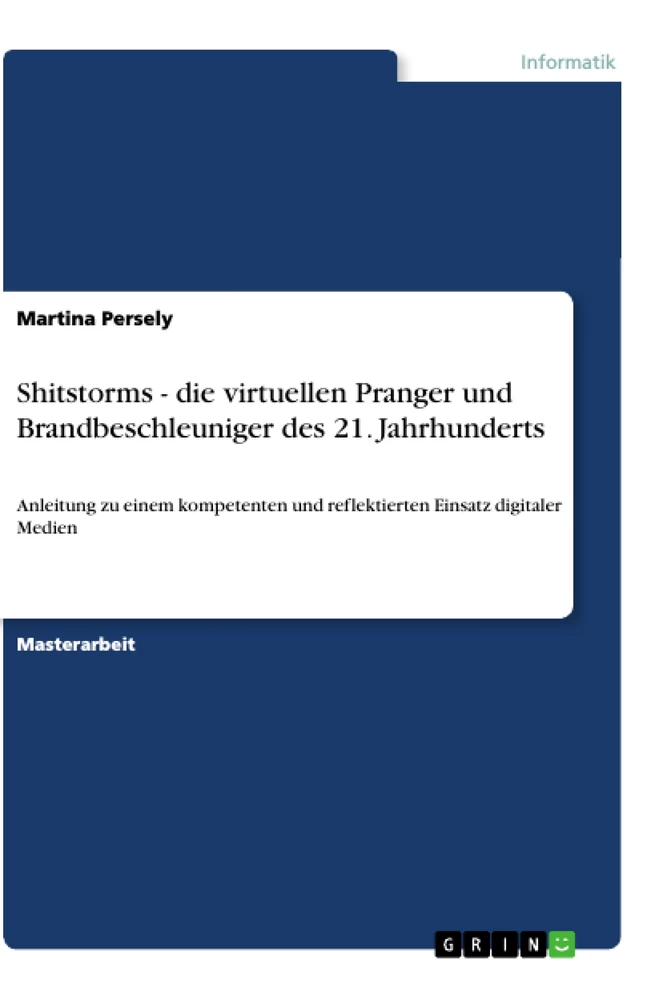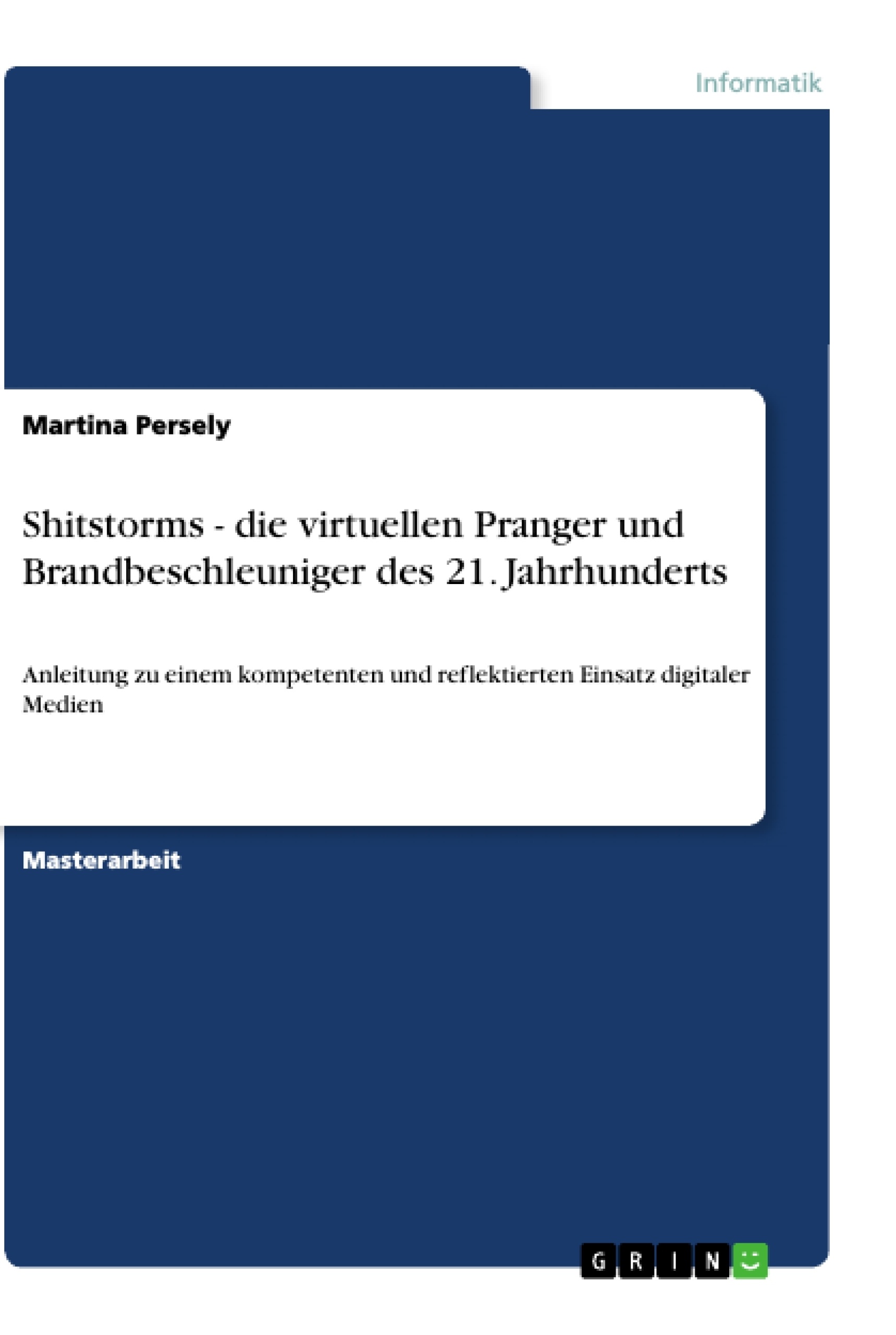Folgende Arbeit befasst sich mit der Rolle und Einfluss sogenannter "Shitstorms" im Internet.
Das Internet ist aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Das zusätzliche Aufkommen von Social Media eröffnete den Menschen neue Wege der Kommunikation.
Viele Unternehmen und Personen des öffentlichen Lebens setzen Social Media ein, um mit ihren Kunden oder Fans zu kommunizieren und sich als Marke virtuell zu präsentieren. In den meisten Fällen ist diese Vorgehensweise erfolgreich. Wie der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry jedoch bereits feststellte: "Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse."
Dieses Zitat spiegelt einen der Hauptgründe für sogenannte Shitstorms wieder. Das geschriebene Wort bietet viel Spielraum für Interpretationen, durch die sich Emotionen hochschaukeln können, von denen Empörungsstürme leben. Wie genau wird jedoch ein Shitstorm definiert? Das verheerende Problem für Unternehmen ist die Tatsache, dass sie Shitstorms kaum kontrollieren können und sich diese meist mit sehr hoher Geschwindigkeit viral verbreiten.
Trotz zahlreicher Verhaltenstipps im Falle eines Empörungssturms ist zu bedenken, dass jeder einzigartig ist, was es wiederum unmöglich macht, eine standardisierte Vorgehensweise festzulegen, die immer greift.
Aufgrunddessen ist es für Betroffene essenziell, Personen mit einschlägigem kommunikativen Know-how zu engagieren, die im Fall des Falles auf die Situation reagieren können. Viele Menschen verstecken sich bei ihren Äußerungen häufig in der vermeintlichen Anonymität des Internets. Aber ist das Internet wirklich ein rechtsfreier Raum? Wie sollten sich Einzelpersonen beziehungsweise Unternehmen, die Opfer eines Shitstorms werden, verhalten?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Kurzfassung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Erwartetes Resultat
- 1.3 Methodisches Vorgehen
- 1.4 State-of-the-Art
- 2 Einleitung
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Was ist ein Shitstorm?
- 2.3 Der Ursprung des Wortes Shitstorm
- 2.4 Wie alles begann - Die Geschichte des Shitstorms
- 2.5 Trolle
- 3 Anatomie eines Proteststurmes: Blick ins Innere des Shitstorms
- 3.1 Die Auslöser
- 3.2 Die Merkmale
- 3.3 Die Arten
- 3.4 Der Streisand-Effekt
- 3.5 Seeding und Spillover
- 3.6 Zerstörungsgrade eines Shitstorms
- 3.7 Wie gestaltet sich eine Empörungswelle im österreichischen Stil?
- 4 Im Auge des Sturms
- 4.1 Die Pre-Phase
- 4.2 Die Akut-Phase
- 4.3 Die Post-Phase
- 4.4 Nach dem Shitstorm
- 4.5 Den Shitstorm als Chance sehen
- 4.6 Folgen einer Empörungswelle
- 4.7 Das Markenimage
- 4.8 Überwachung der Konsequenzen
- 4.9 Gründe, wieso ein Proteststurm nicht den Weltuntergang bedeuten muss
- 5 Rechtliche Aspekte
- 5.1 Einleitung/State-of-the-art
- 5.2 Rechtlicher Rahmen
- 5.2.1 E-Commerce-Gesetz, Inkrafttretensdatum 01.01.2002
- 5.2.2 Verpflichtungen von Diensteanbietern
- 5.2.3 Umfang der Pflichten der Diensteanbieter
- 5.3 Straftaten im Rahmen von Shitstorms
- 5.3.1 Offizialdelikte
- 5.3.2 Privatanklagedelikte
- 5.4 Das Recht auf Meinungsfreiheit
- 5.5 Kosten/Konsequenzen eines Shitstorms
- 5.5.1 Allgemein
- 5.5.2 Entlassung auf Grund von Hasspostings
- 5.5.3 Möglichkeiten eines Arbeitgebers im Falle von Hasspostings
- 5.5.4 Wer haftet bei einem Shitstorm auf einer Facebook-Seite?
- 5.5.5 Der anonyme Shitstorm
- 6 Das Resümee Shitstorm-gebeutelter Unternehmen
- 6.1 ING-DiBa: „der Wurstkrieg“ vom 02-17.01.2012
- 6.2 Post: E-Brief 2010
- 6.3 Deutschen Telekom: „Drosselkom“
- 6.4 Vodafone: Proteststurm „Anni Roc“ Sommer 2012
- 6.5 Zusammenfassung der Interviews
- 6.5.1 Das Gefährdungspotenzial
- 6.5.2 Die Sichtweise zum Thema Shitstorm
- 6.5.3 Die Entwicklung viraler Proteststürme
- 6.5.4 Reaktionen der Unternehmen auf den Shitstorm
- 6.5.5 Folgen der Kommunikationskrise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht das Phänomen des Shitstorms im digitalen Zeitalter. Sie analysiert die Ursachen, die Dynamik und die Folgen von Shitstorms für betroffene Unternehmen und Einzelpersonen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf rechtlichen Aspekten und möglichen Strategien zur Bewältigung solcher Online-Krisen.
- Definition und Entstehung von Shitstorms
- Rechtliche Implikationen und Verantwortlichkeiten
- Strategien zur Krisenbewältigung im Falle eines Shitstorms
- Langfristige Folgen für das Markenimage
- Analyse konkreter Fallbeispiele
Zusammenfassung der Kapitel
1 Kurzfassung: Diese Kurzfassung bietet einen Überblick über die Problemstellung der Arbeit, die erwarteten Resultate, die angewandte Methodik und den aktuellen Forschungsstand zum Thema Shitstorms. Sie hebt die zentralen Forschungsfragen hervor und skizziert die Bedeutung der Untersuchung von Shitstorms im Kontext der modernen Online-Kommunikation. Die Zusammenfassung betont die Notwendigkeit effektiver Strategien zur Krisenbewältigung und die Herausforderungen, die sich aus der rasanten Verbreitung von negativer Online-Meinung bilden.
2 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Shitstorms ein und definiert den Begriff. Sie beleuchtet den Ursprung des Wortes und seine historische Entwicklung, inklusive der Rolle von "Trollen" in der Entstehung und Verbreitung von Shitstorms. Dieser Abschnitt legt die Grundlage für die detailliertere Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten des Phänomens in den folgenden Kapiteln. Die Geschichte des Shitstorms wird hier skizziert, um den Kontext und die Entwicklung des Themas zu verdeutlichen.
3 Anatomie eines Proteststurmes: Blick ins Innere des Shitstorms: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen, Merkmale und Arten von Shitstorms. Es untersucht Auslöser wie Fehltritte von Unternehmen oder öffentlichen Personen, die zu negativen Online-Reaktionen führen. Die Merkmale eines Shitstorms wie Geschwindigkeit, Reichweite und Intensität werden detailliert beschrieben, ebenso der Streisand-Effekt und die Rolle von "Seeding" und "Spillover". Der österreichische Kontext wird ebenfalls betrachtet.
4 Im Auge des Sturms: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Phasen eines Shitstorms – die Pre-Phase, die Akut-Phase und die Post-Phase. Es beleuchtet die Herausforderungen für betroffene Unternehmen und Einzelpersonen während dieser Phasen und diskutiert Strategien zur Krisenbewältigung. Der Fokus liegt auf der Reaktion auf den Shitstorm und auf der Möglichkeit, ihn als Chance zur Verbesserung zu nutzen. Die langfristigen Folgen für das Markenimage und den Ruf werden ebenfalls thematisiert.
5 Rechtliche Aspekte: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für Shitstorms in Österreich. Es beleuchtet relevante Gesetze und Bestimmungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem E-Commerce-Gesetz und dem Recht auf Meinungsfreiheit. Die Kapitel befasst sich mit möglichen Straftaten im Kontext von Shitstorms (Offizialdelikte und Privatanklagedelikte) und den damit verbundenen Konsequenzen, wie Kosten und Haftungsfragen für Unternehmen und Einzelpersonen. Die Rolle von Anonymität im Internet wird ebenfalls erörtert.
6 Das Resümee Shitstorm-gebeutelter Unternehmen: Dieses Kapitel präsentiert Fallstudien von Unternehmen, die von Shitstorms betroffen waren. Anhand konkreter Beispiele (ING-DiBa, Post, Deutsche Telekom, Vodafone) werden die verschiedenen Reaktionen der Unternehmen auf die Krise und die daraus resultierenden Folgen untersucht. Die Zusammenfassung der Interviews liefert zusätzliche Einblicke in die Perspektiven betroffener Unternehmen und deren Erfahrungen mit Shitstorms. Das Kapitel analysiert das Gefährdungspotenzial, die unterschiedlichen Sichtweisen zum Thema und die Entwicklung viraler Proteststürme.
Schlüsselwörter
Shitstorm, Online-Kommunikation, Social Media, Krisenmanagement, Markenimage, Rechtliche Aspekte, Meinungsfreiheit, Online-Reputation, Fallstudien, Österreichisches Recht, Virale Verbreitung, Kommunikationsstrategien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: "Anatomie eines Shitstorms"
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht umfassend das Phänomen des Shitstorms im digitalen Zeitalter. Sie analysiert die Ursachen, die Dynamik und die Folgen von Shitstorms für Unternehmen und Einzelpersonen, mit besonderem Fokus auf rechtliche Aspekte und Strategien zur Krisenbewältigung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Definition und Entstehung von Shitstorms, rechtliche Implikationen und Verantwortlichkeiten, Strategien zur Krisenbewältigung, langfristige Folgen für das Markenimage, und die Analyse konkreter Fallstudien. Die verschiedenen Phasen eines Shitstorms (Pre-, Akut- und Post-Phase) werden ebenso detailliert untersucht wie der Einfluss von "Trollen" und der Streisand-Effekt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Kurzfassung, eine Einleitung, die Anatomie eines Shitstorms, die Betrachtung des Shitstorms in seinen verschiedenen Phasen, die rechtlichen Aspekte und schließlich ein Kapitel mit Fallstudien von Unternehmen, die von Shitstorms betroffen waren (z.B. ING-DiBa, Post, Deutsche Telekom, Vodafone).
Welche konkreten Fallstudien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Fälle von ING-DiBa ("der Wurstkrieg"), der Post (E-Brief 2010), der Deutschen Telekom ("Drosselkom") und Vodafone ("Proteststurm „Anni Roc“"). Diese Fallstudien dienen dazu, die Auswirkungen von Shitstorms auf Unternehmen und deren Reaktionen zu illustrieren.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich, insbesondere das E-Commerce-Gesetz, das Recht auf Meinungsfreiheit, mögliche Straftaten im Kontext von Shitstorms (Offizialdelikte und Privatanklagedelikte), Haftungsfragen und die Rolle der Anonymität im Internet.
Welche Strategien zur Krisenbewältigung werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht Strategien zur Bewältigung von Shitstorms in den verschiedenen Phasen. Sie betrachtet die Möglichkeiten, negative Online-Meinung zu managen und den Shitstorm sogar als Chance zur Verbesserung zu nutzen. Die langfristigen Folgen für das Markenimage werden ebenfalls im Hinblick auf die Krisenbewältigung betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Shitstorm, Online-Kommunikation, Social Media, Krisenmanagement, Markenimage, Rechtliche Aspekte, Meinungsfreiheit, Online-Reputation, Fallstudien, Österreichisches Recht, Virale Verbreitung, Kommunikationsstrategien.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, insbesondere an Studierende und Forschende im Bereich Kommunikationswissenschaften, Medienwissenschaften, Jura und Wirtschaftswissenschaften, die sich mit dem Thema Online-Kommunikation, Krisenmanagement und rechtlichen Aspekten des Internets auseinandersetzen.
Wo finde ich den vollständigen Inhalt der Arbeit?
Der vollständige Inhalt der Arbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieses FAQ dient lediglich als Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Welche Methodik wurde in der Arbeit verwendet?
Die genaue Methodik ist im Kapitel zur Kurzfassung der Arbeit beschrieben. Die Arbeit kombiniert theoretische Analysen mit der empirischen Untersuchung von Fallstudien. Der genaue methodische Ansatz wird in der Arbeit detailliert erläutert.
- Quote paper
- Martina Persely (Author), 2018, Shitstorms - die virtuellen Pranger und Brandbeschleuniger des 21. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458117