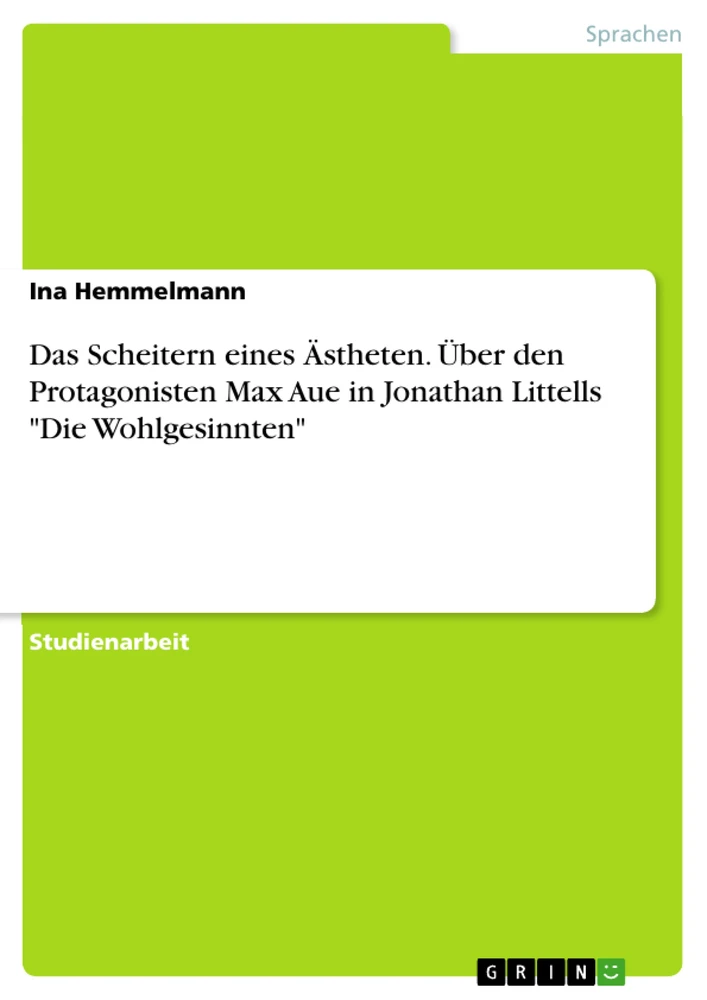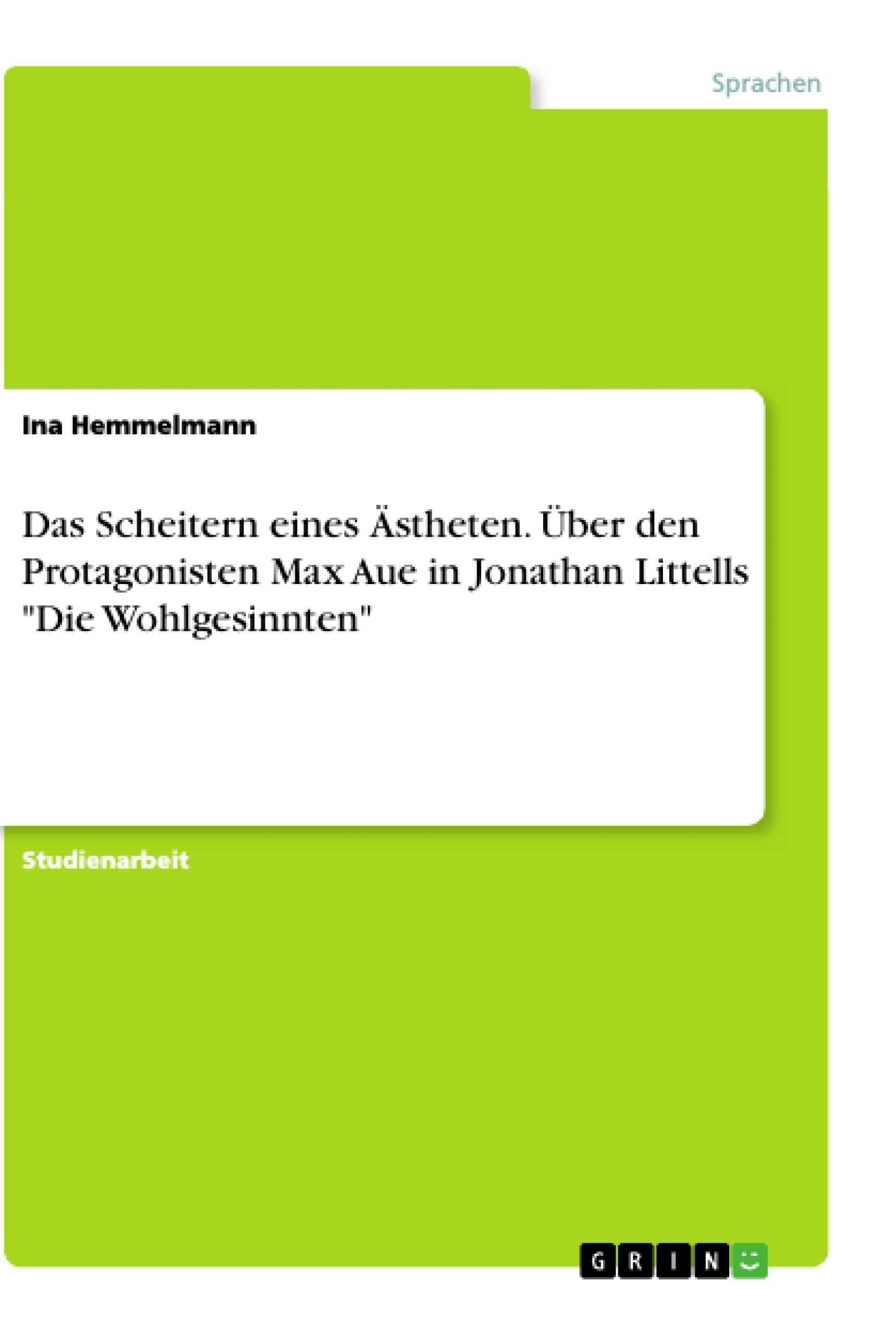"Ihr Menschenbrüder, lasst mich euch erzählen, wie es gewesen ist." Es ist kein leichtes Unterfangen, dem sich der Erzähler des Romans "Die Wohlgesinnten" widmet. Im Gegenteil erscheint das Vorhaben geradezu anmaßend. Die nachfolgenden Ausführungen betrachten die Ansprüche, die der Protagonist als Akteur und Autor an sich selbst stellt und inwiefern er ihnen gerecht wird beziehungsweise unmöglich gerecht werden kann.
Immer wieder stilisiert sich der erzählende Protagonist Max Aue im Verlauf seines angeblich authentischen Berichtes zum ästhetischen, humanistisch gebildeten Menschen. Bis zu einem gewissen Grad kann ihm Intelligenz, Intellekt und Geschmack auch keinesfalls abgesprochen werden. Doch gleichzeitig stechen wiederkehrende Brüche in dieser Selbstdarstellung ins Auge, sei es in Form ethisch-moralischer Unfähigkeit, ekelerregender Körperlichkeit oder im perversen Begehren der eigenen Schwester.
Die folgenden Untersuchungen befassen sich mit der Diskrepanz besagter Selbstansprüche und deren tatsächlicher Umsetzung hinsichtlich der nationalsozialistischen Karriere des Protagonisten, der Täterschaft und moralischen Urteilsfähigkeit sowie der Autorrolle des Erzählers.
Inhaltsverzeichnis
- I. Charakterisierung eines Ästheten: Vorgehensweise und Zielsetzung
- II. Das Scheitern eines Ästheten. Über den Protagonisten Max Aue in Jonathan Littells Die Wohlgesinnten.
- 1. Zur Ästhetik des Nationalsozialismus: Max Aue als tugendhaftes Vorbild
- 2. Zuschauer/Täter? Der Protagonist als Mitwisser, Beteiligter, Urteilender
- 3. Der Autor Aue: Schreiben als ästhetischer Produktionsprozess
- 4. Das Scheitern des Ästheten als Möglichkeit der Holocaustdarstellung
- III. Die Zukunft der NS-Vergangenheit in der Kunst
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Figur des Max Aue in Jonathan Littells Roman „Die Wohlgesinnten“ im Kontext der Ästhetik. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Diskrepanz zwischen Aues Selbstbild als ästhetischer, humanistisch gebildeter Mensch und seinem tatsächlichen Handeln im nationalsozialistischen Regime. Die Arbeit beleuchtet Aues Rolle als Akteur und Zuschauer im Holocaust sowie seine Funktion als Autor seines eigenen Berichtes.
- Die Ästhetisierung des Nationalsozialismus
- Max Aues Position als Betrachter und Täter
- Das Schreiben als ästhetischer Akt
- Das Scheitern des Ästheten als Möglichkeit der Holocaustdarstellung
- Die Zukunft der NS-Vergangenheit in der Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Rolle des Protagonisten Max Aue im nationalsozialistischen Regime und untersucht, inwiefern er innerhalb der ästhetischen Konventionen des Nationalsozialismus agiert. Es wird insbesondere die Ästhetisierung des Menschen und seines Lebens im totalitären Regime untersucht.
Das zweite Kapitel fokussiert sich auf Aues Position als Betrachter und setzt diese in den Kontext der Ästhetik der Aufklärung und des Idealismus. Es wird untersucht, inwiefern Aues humanistische Bildung und intellektuelle Fähigkeiten ihn in diese Tradition einordnen lassen. Des Weiteren wird die Dimension des Wahrnehmens und der moralischen Urteilsbildung im Kontext der aufklärerisch-humanistischen Ästhetik betrachtet.
Das dritte Kapitel widmet sich Aues Rolle als Autor seines Tatsachenberichtes und analysiert das Schreiben als ästhetischen, schöpferischen Akt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Ästhetik, Nationalsozialismus, Holocaust, Literatur, Täter, Zuschauer, Autor, Selbstbild, Wahrnehmung, Moral, Geschichte, Kunst und Schreibprozess.
- Citar trabajo
- Ina Hemmelmann (Autor), 2011, Das Scheitern eines Ästheten. Über den Protagonisten Max Aue in Jonathan Littells "Die Wohlgesinnten", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457979