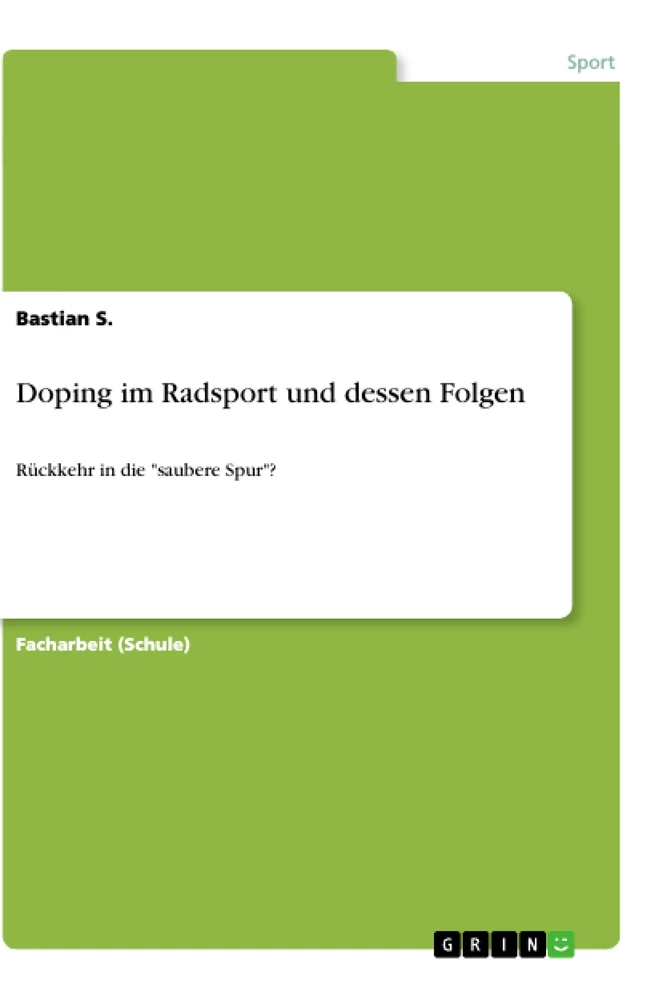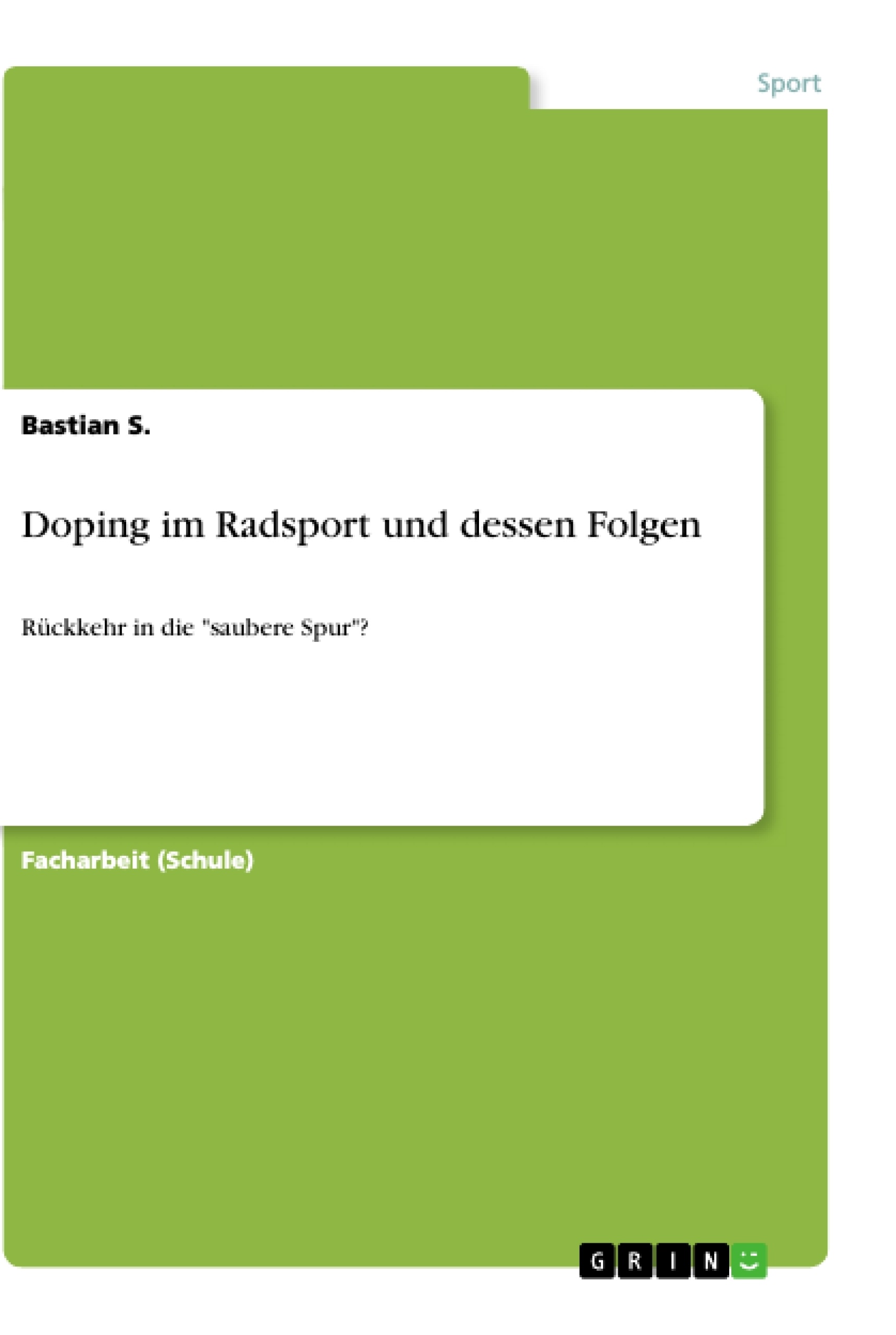Es war der 7. September 2017. Der britische Radprofi Chris Froome fuhr gerade die 18. Etappe der Vuelta a España, eines der drei wichtigsten Etappenrennen im Straßenradsport. Anschließend musste er eine Urinprobe zur Dopingkontrolle abgeben. Er hat eine Asthma-Erkrankung und verfügt daher über eine therapeutische Ausnahmegenehmigung (TUE) für das Asthmamittel Salbutamol, wobei er einen Grenzwert von 1000 ng/ml des Mittels nicht überschreiten darf.
Das Testergebnis lieferte einen Wert von 2000 ng/ml. Froome ist vierfacher Tour de France-Sieger und derzeit einer der erfolgreichsten Radsportler, sowie der Sieger der Vuelta a España 2017. Hat auch er, wie viele andere, den Titel nicht durch "saubere" Leistungen gewonnen? Begibt sich auch Chris Froome in eine Schublade mit Sportlern wie Lance Armstrong oder Jan Ullrich, die als ehemalige Tour de France-Sieger des Dopings überführt wurden? Dopingfälle, wie diese, erschüttern die Radsportwelt immer wieder.
Das Vertrauen in einen Athleten und den Sport, sowie die Glaubwürdigkeit an die Existenz eines nichtdopenden Sportlers, geht dadurch verloren. Hinzu kommt, dass der Radsport immer weiter aus dem Blickfeld rückt und sich nur noch im Schatten der Dopingproblematik bewegt. Nicht zu vernachlässigen ist ebenso die Gesundheit der Athleten, die sich oft über die langfristig auftretenden Folgen des Dopinggebrauchs nicht bewusst sind oder diese einfach ignorieren. All diese Auswirkungen des Dopingmissbrauchs haben zu einem enormen Imageverlust des Radsports in den letzten 20 Jahren beigetragen.
Dies war vor allem im männlichen Straßenradrennsport zu beobachten, worauf sich diese Seminararbeit vorwiegend bezieht. Unter dem Begriff Doping wird in der Arbeit lediglich die physische Leistungssteigerung von Athleten durch Einnahme verbotener Substanzen verstanden, nicht, das in den letzten Jahren vermehrt aufgetretene, Motor-Doping.
Die Hauptquellen der Arbeit stellen zum einen, aufgrund der Aktualität des Themas, Internetquellen, wie Online-Zeitungsartikel dar. Zum anderen ist das "Schwarzbuch Doping" von Norman Schöffel als eine wichtige Quelle anzusehen. Das Buch gibt einen sehr umfassenden Einblick in die Welt des Dopings. Es werden vor allem Themen wie Dopingkontrollen, Rechtsprechung und der Zusammenhang der Medien mit der Kommerzialisierung beleuchtet und auch kritisch hinterfragt.
Inhaltsverzeichnis
- Der Fall Froome: Ein Indiz eines funktionierenden Kontrollsystems oder nur die „Spitze des Eisbergs“?
- Definition des Begriffes „Doping“
- Zusammenhang von Doping mit
- Professionalisierung
- Kommerzialisierung
- Folgen der Publizierung großer Dopingskandale auf das allgemeine Interesse der deutschen Bevölkerung am Radsport
- Strategien zur Bekämpfung der Dopingproblematik im Radsport
- Dopingkontrollen der Athleten durch die CADF
- Ablauf einer Dopingkontrolle nach den Richtlinien der WADA
- Methodik und Art der Analyse einer Dopingprobe
- Problematik bei Dopingkontrollen
- Probleme mit ADAMS
- Unterschiede in der Kontroll-Frequenz
- Konfliktpotenzial in der Abnahme der Dopingprobe
- Effektivität von Nachweismethoden und Zusammenfassung
- Sportgerichtsbarkeit von dopenden Athleten im Radsport
- Sportrechtliche Sanktionierung
- Strafrechtliche Sanktionierung in Deutschland
- Dopingkontrollen der Athleten durch die CADF
- Schlussbetrachtung: Wie sauber ist der Radsport im Jahr 2018?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Dopingproblematik im Radsport, insbesondere im Kontext von Professionalisierung und Kommerzialisierung. Sie analysiert die Auswirkungen großer Dopingskandale auf das öffentliche Interesse und beleuchtet Strategien zur Dopingbekämpfung, fokussiert auf Dopingkontrollen und die sportgerichtliche Verfolgung von Dopingsündern.
- Definition und rechtliche Einordnung von Doping
- Der Einfluss von Professionalisierung und Kommerzialisierung auf die Dopingproblematik
- Auswirkungen von Dopingskandalen auf das öffentliche Interesse am Radsport
- Analyse der Effektivität von Dopingkontrollmethoden
- Bewertung der Sportgerichtsbarkeit im Umgang mit Dopingfällen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Fall Froome: Ein Indiz eines funktionierenden Kontrollsystems oder nur die „Spitze des Eisbergs“?: Dieses Kapitel beginnt mit dem Fall Chris Froome, dessen positiver Dopingtest die Problematik des Dopings im Radsport verdeutlicht. Es wird die Frage aufgeworfen, ob dieser Fall ein Einzelfall ist oder die Spitze eines größeren Problems darstellt. Der Verlust des Vertrauens in den Sport und die Athleten, sowie der anhaltende Schatten der Dopingproblematik, werden als zentrale Folgen diskutiert. Das Kapitel betont die Notwendigkeit einer effektiven Dopingbekämpfung und die langfristigen gesundheitlichen Risiken für die Athleten.
Definition des Begriffes „Doping“: Dieses Kapitel widmet sich der präzisen Definition von Doping, um eine solide Grundlage für die weitere Analyse zu schaffen. Es wird der Unterschied zwischen einer vagen Definition und der präzisen Definition der World Anti-Doping Agency (WADA) im World Anti-Doping Code (WADC) herausgearbeitet. Die zehn im WADC festgelegten Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen werden erläutert, wobei die Minimierung von Grauzonen durch detaillierte Unterartikel und Kommentare betont wird. Die Bedeutung einer allgemein gültigen Definition für Transparenz und Fairness im Radsport wird hervorgehoben.
Zusammenhang von Doping mit Professionalisierung und Kommerzialisierung: Dieses Kapitel beleuchtet den komplexen Zusammenhang zwischen Doping, der Professionalisierung und Kommerzialisierung im Radsport. Es untersucht, wie der immense Druck durch den Wettbewerb und das Streben nach finanziellen Erfolgen die Wahrscheinlichkeit von Dopinghandlungen erhöhen können. Die Kapitel werden vermutlich die Verflechtungen zwischen Sponsoren, Teams und Athleten analysieren und die ethischen Dilemmata im modernen Profisport herausstellen.
Folgen der Publizierung großer Dopingskandale auf das allgemeine Interesse der deutschen Bevölkerung am Radsport: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen großer Dopingskandale auf das Zuschauerinteresse am Radsport in Deutschland. Es wird die Entwicklung der Fernseh-Quoten bei Übertragungen der Tour de France als Indikator für das öffentliche Interesse herangezogen und vermutlich mit der Häufigkeit und Schwere der Dopingskandale korreliert. Die Analyse zeigt die negative Auswirkung des Dopings auf die Popularität des Sports.
Strategien zur Bekämpfung der Dopingproblematik im Radsport: Dieses Kapitel befasst sich mit den Strategien zur Bekämpfung von Doping im Radsport. Im Fokus stehen die Dopingkontrollen durch die CADF, deren Ablauf, Methodik und die damit verbundenen Probleme, wie z.B. die Problematik mit ADAMS und unterschiedliche Kontrollfrequenzen. Weiterhin wird die Sportgerichtsbarkeit, sowohl die sportrechtlichen als auch die strafrechtlichen Sanktionen gegen Dopingsünder, eingehend analysiert. Die Kapitel wird die Effektivität der verschiedenen Maßnahmen bewerten.
Schlüsselwörter
Doping, Radsport, Professionalisierung, Kommerzialisierung, Dopingskandale, Dopingkontrollen, WADA, WADC, CADF, Sportgerichtsbarkeit, öffentliches Interesse, Gesundheit der Athleten, Salbutamol, Chris Froome, Anti-Doping-Maßnahmen, Effektivität, Abschreckung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Doping im Radsport
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Dopingproblematik im Radsport, insbesondere im Kontext von Professionalisierung und Kommerzialisierung. Sie analysiert die Auswirkungen großer Dopingskandale auf das öffentliche Interesse und beleuchtet Strategien zur Dopingbekämpfung, fokussiert auf Dopingkontrollen und die sportgerichtliche Verfolgung von Dopingsündern.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und rechtliche Einordnung von Doping; Einfluss von Professionalisierung und Kommerzialisierung auf die Dopingproblematik; Auswirkungen von Dopingskandalen auf das öffentliche Interesse am Radsport; Analyse der Effektivität von Dopingkontrollmethoden; Bewertung der Sportgerichtsbarkeit im Umgang mit Dopingfällen; Der Fall Chris Froome als Fallbeispiel; Die Methodik und Problematik von Dopingkontrollen (inkl. ADAMS, unterschiedliche Kontrollfrequenzen und Konfliktpotenzial bei Probenahmen); Sportrechtliche und strafrechtliche Sanktionen.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die sich jeweils mit einem Aspekt der Dopingproblematik befassen. Sie beginnt mit einer Einleitung, die den Fall Chris Froome als Einstiegspunkt verwendet. Es folgen Kapitel zur Definition von Doping, dem Zusammenhang mit Professionalisierung und Kommerzialisierung, den Auswirkungen von Dopingskandalen auf das öffentliche Interesse, und schließlich Strategien zur Dopingbekämpfung. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung.
Welche Rolle spielen Professionalisierung und Kommerzialisierung im Kontext des Dopings?
Die Arbeit untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen Doping und dem immensen Druck durch Wettbewerb und das Streben nach finanziellen Erfolgen im professionellen Radsport. Es wird analysiert, wie diese Faktoren die Wahrscheinlichkeit von Dopinghandlungen erhöhen können und welche ethischen Dilemmata sich daraus ergeben.
Wie effektiv sind die derzeitigen Dopingkontrollmethoden?
Die Seminararbeit analysiert die Effektivität der Dopingkontrollen, insbesondere der CADF (Nationale Anti-Doping Agentur Deutschlands), und beleuchtet dabei Probleme wie die Problematik mit ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System), unterschiedliche Kontrollfrequenzen und das Konfliktpotenzial bei der Probenahme. Die Effektivität der Nachweismethoden wird ebenfalls bewertet.
Welche Rolle spielt die Sportgerichtsbarkeit?
Die Arbeit analysiert die Sportgerichtsbarkeit im Umgang mit Dopingfällen, sowohl die sportrechtlichen als auch die strafrechtlichen Sanktionen in Deutschland. Die Effektivität der Sanktionen im Hinblick auf Abschreckung und Prävention wird bewertet.
Wie wirkt sich die Veröffentlichung von Dopingskandalen auf das öffentliche Interesse am Radsport aus?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen großer Dopingskandale auf das Zuschauerinteresse am Radsport in Deutschland, beispielsweise anhand der Entwicklung der Fernsehquoten bei der Tour de France. Es wird analysiert, wie stark die Popularität des Sports durch Doping geschädigt wird.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Doping, Radsport, Professionalisierung, Kommerzialisierung, Dopingskandale, Dopingkontrollen, WADA, WADC, CADF, Sportgerichtsbarkeit, öffentliches Interesse, Gesundheit der Athleten, Salbutamol, Chris Froome, Anti-Doping-Maßnahmen, Effektivität, Abschreckung.
- Quote paper
- Bastian S. (Author), 2018, Doping im Radsport und dessen Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457807