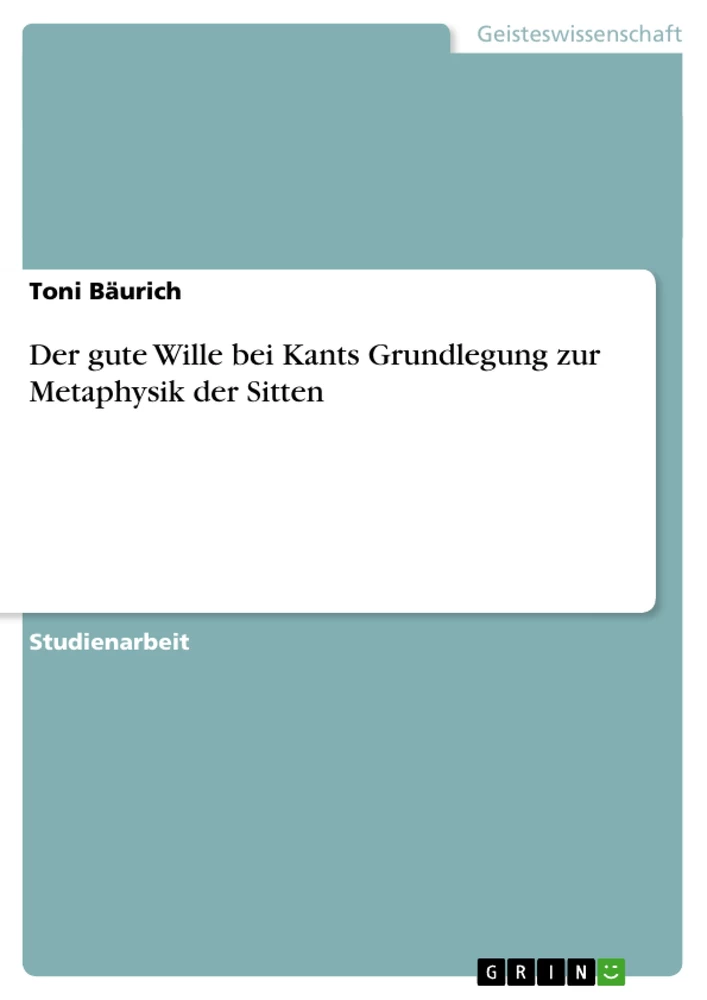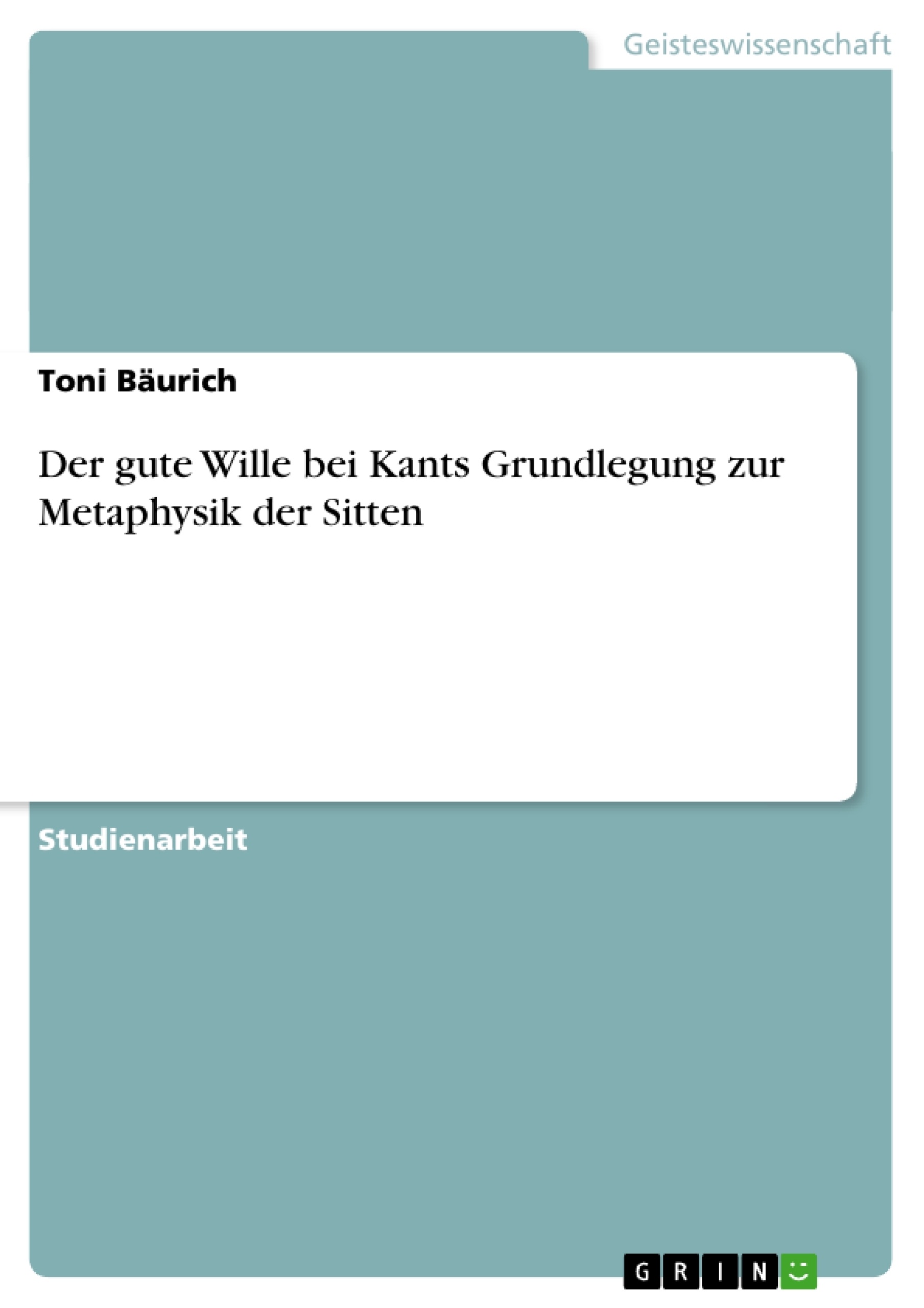„Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer der selben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein der gute Wille“(GMS 28,1-3)
Einleitung:
Mit diesen Worten wird der erste Abschnitt der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“(GMS) eingeleitet. In meiner Hausarbeit werde ich mich mit dem guten Willen in Kants Werk beschäftigen. Dazu möchte ich Leitfragen, wie zum Beispiel welche Bedeutung Kant dem guten Willen beimißt, wie er über Tugenden oder die Glückseligkeit urteilt und wie sich der gute Wille dazu verhält, klären. Außerdem möchte ich aufzeigen, wie Kant über den guten Willen und dessen näherer Erläuterung durch den Pflichtbegriff, zum Aufbau des ersten kategorischen Imperativ kommt. Um diese und andere Leitfragen aufzulösen, werde ich Schöneckers und Allens Kommentar(KSA) zur GMS benutzen und mich zudem an Höffes kooperativen Kommentar(KKH) über Kants Arbeit halten. Auffällig ist, dass Kant eine Behauptung aufstellt, die, ohne dass sie begründet wird, Ausgangspunkt für seine weiteren Ausführungen ist. Dem Leser bleibt nur die eine Möglichkeit, diese Ansicht zu teilen, will er dem Gedankengang des Autoren weiterhin folgen. Nur wenn er mit dem Philosophen und dessen Blick übereinstimmt, ergeben die weiteren Argumentationsschritte einen Sinn. Wird jedoch Kants Aussage in Frage gestellt oder gar abgelehnt, so kann der Leser seine Lektüre bereits an dieser Stelle abbrechen und zur Seite legen, denn die folgenden Schritte ergeben sich aus diesem Fundament und werden ihn so niemals ohne logische Brüche überzeugen können. Dem Leser, der sich davon nicht abschrecken läßt, bieten sich nun zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten dieser Eingangsformulierung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Strukturaufbau von Kants Werk
- Kants Bestimmung des höchsten Gutes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem "guten Willen" in Kants Werk "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten". Sie analysiert die Bedeutung des guten Willens für Kant, beleuchtet seine Ansichten über Tugenden und Glückseligkeit und untersucht das Verhältnis des guten Willens zu diesen. Außerdem wird aufgezeigt, wie Kant vom guten Willen über den Pflichtbegriff zum ersten kategorischen Imperativ gelangt.
- Der gute Wille als höchstes Gut
- Kants Kritik an Natur- und Glücksgaben
- Die Rolle der Vernunft bei der Gestaltung des guten Willens
- Die Beziehung zwischen gutem Willen, Pflicht und kategorischem Imperativ
- Kants Auseinandersetzung mit antiken ethischen Prinzipien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den "guten Willen" als zentralen Begriff in Kants "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" vor. Sie verdeutlicht die Leitfragen der Hausarbeit, wie die Bedeutung des guten Willens für Kant, seine Ansichten über Tugenden und Glückseligkeit sowie die Entwicklung des ersten kategorischen Imperativs.
Strukturaufbau von Kants Werk
Dieser Abschnitt analysiert den Aufbau des Textes, der sich in zwei Hauptteile gliedert. Im ersten Teil wird gezeigt, dass Natur- und Glücksgaben nur einen eingeschränkten Wert haben, während der zweite Teil das teleologische Argument präsentiert, welches die Vernunft als Quelle des guten Willens hervorhebt. Der Übergang vom guten Willen zum Pflichtbegriff und zur ersten Definition des kategorischen Imperativs wird nur überblicksmäßig behandelt.
Kants Bestimmung des höchsten Gutes
Kant definiert den guten Willen als das einzig uneingeschränkt gute Prinzip und setzt sich damit in den Kontext der antiken ethischen Prinzipienlehre. Er kritisiert den Wert von Natur- und Glücksgaben und argumentiert, dass nur der gute Wille einen unbedingten inneren Wert besitzt. Durch den guten Willen wird die Moralität des Erkenntnismittels selbst zum Beurteilungsmittel.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: guter Wille, Glückseligkeit, Tugend, Pflicht, kategorischer Imperativ, Vernunft, Ethik, Moralität, Prinzipienlehre, antike Philosophie.
- Quote paper
- Toni Bäurich (Author), 2004, Der gute Wille bei Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45778