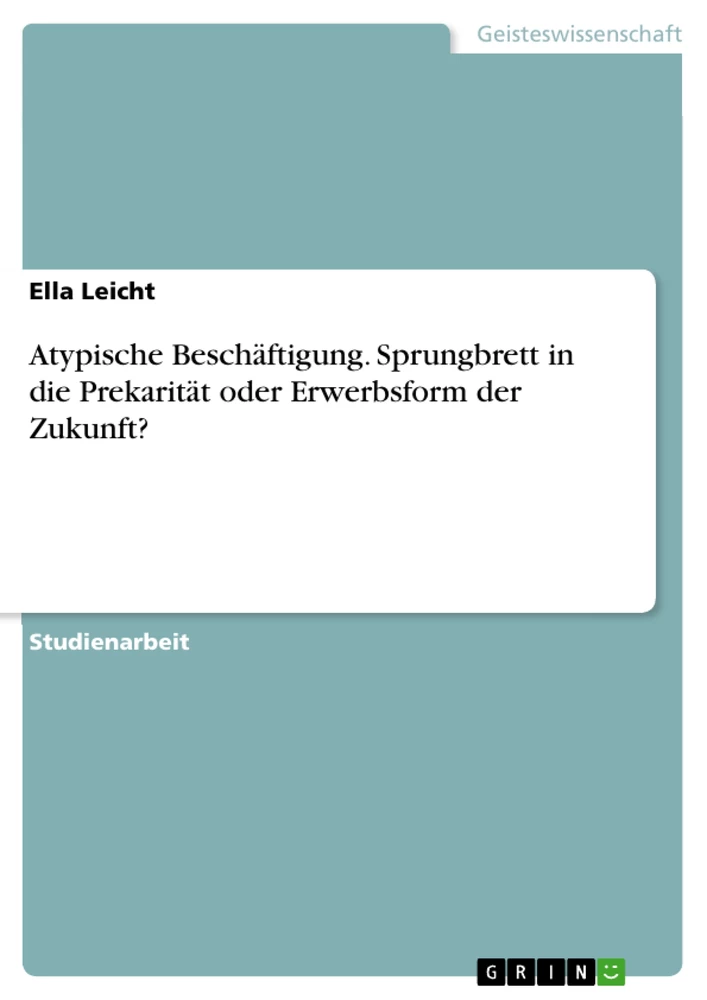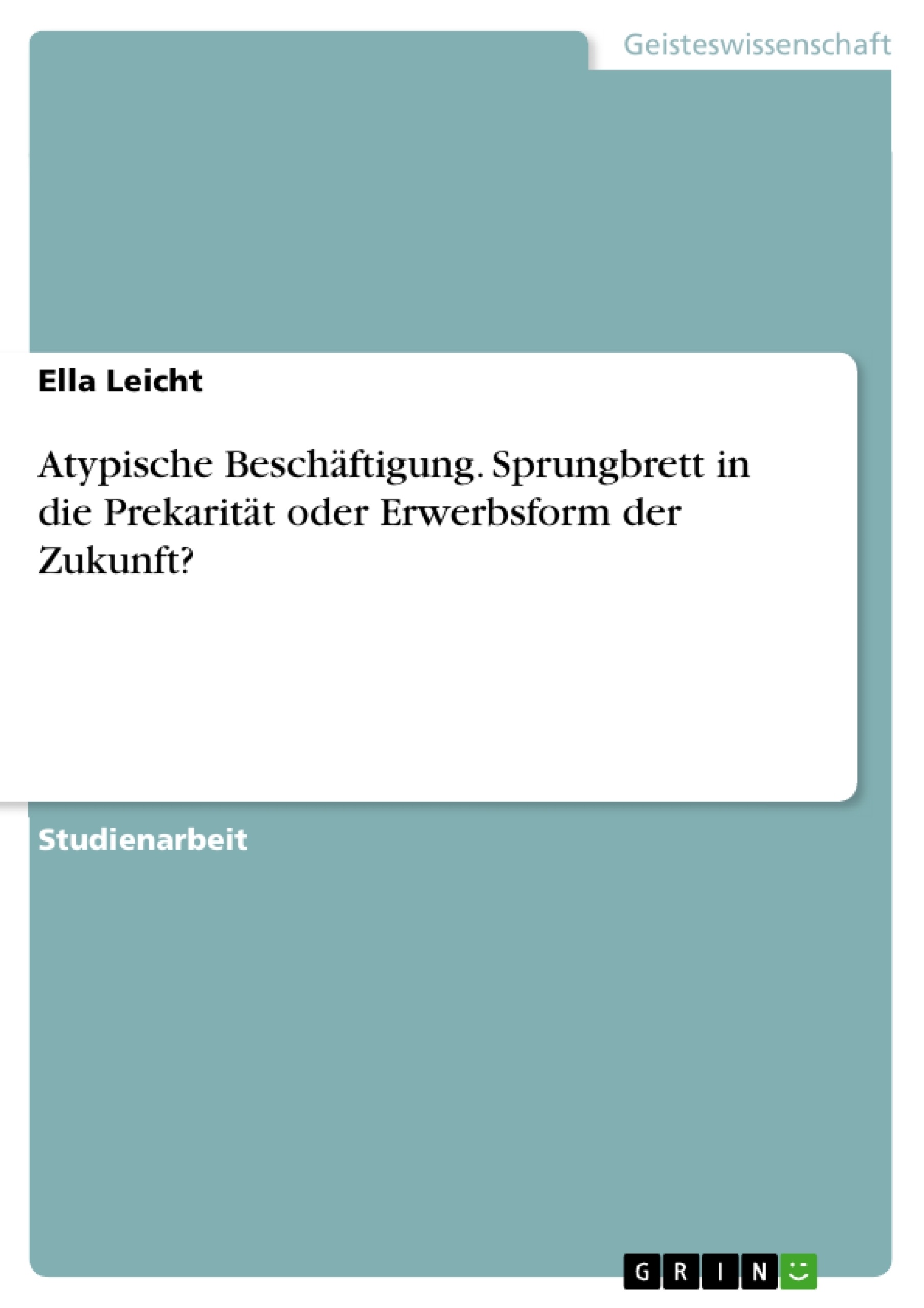Die moderne Arbeit ist atypisch. Binnen zwanzig Jahren stieg die Zahl der befristet, in Leih- oder Zeitarbeit Beschäftigten und Minijobbern um mehr als 70 Prozent. Im Jahr 2016 ging jeder fünfte Erwerbstätige zwischen 15 und 64 Jahren einer atypischen Beschäftigung nach, während seit 1991 die Zahlen Erwerbstätiger mit unbefristeter Vollzeitbeschäftigung konstant zurück gehen (destatis 2017). Diese Entwicklung geht mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandelungsprozessen wie erhöhtem Marktdruck und Normwandel einher und eröffnete neben einer politischen auch eine Debatte über qualitative Aspekte von atypischer Arbeit. Denn nicht nur gesetzliche Reglementierungen, auch die sozialen Sicherungssysteme erfüllen nicht mehr die Ansprüche des modernen Arbeitnehmers. Es wird zunehmend Flexibilität gefordert, ohne eine hinreichende Flexibilisierung der Sicherungssysteme zu gewährleisten. Dieses Abstimmungsproblem könnte auf lange Sicht zu umfassenden Exklusionsprozessen führen und bedarf dringender Handlung. Erfordert es zusätzlich eine Relativierung des Begriffs „atypisch“, wenn diese Arbeitsform zunehmend zur Normalität wird? Und sind alle atypischen Erwerbsformen auch gleich prekär?
In der vorliegenden Arbeit wird auf diese Fragen detailliert eingegangen. Zusätzlich soll untersucht werden, wie der aktuelle Trend einer Verlagerung vom Normalarbeitsverhältnis auf atypische Beschäftigungsformen zu interpretieren ist und wie dieser Prozess ausgestaltet werden kann. Dazu werden zunächst Begrifflichkeiten wie Atypische Arbeit und Prekarität geklärt und in Bezug zueinander gestellt. Anschließend sollen die Rahmenbedingungen genauer erläutert sowie ein theoretischer Bezug zu Robert Castels Theorie der Desintegrationspotentiale hergestellt werden. Welche Risiken oder auch Chancen sich aus den neuen Beschäftigungsformen entwickeln können, wird dann anhand einer Analyse von Brehmer und Seifert nochmals gegenüber gestellt und in einem Fazit die Fragestellung beantwortet und ein Ausblick auf Lösungs- und Gestaltungsmöglichkeiten gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffe
- 2.1 Atypische Arbeit
- 2.2 Prekarität
- 3. Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen und neue Formen von Arbeitsorganisation
- 4. Chancen und Risiken
- 4.1 Ergebnisse der Analyse
- 4.2 Chancen
- 4.3 Risiken
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Trend zur atypischen Beschäftigung und deren Auswirkungen auf die Prekarität von Arbeitnehmern. Sie analysiert die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die zu dieser Entwicklung geführt haben, und beleuchtet Chancen und Risiken atypischer Beschäftigungsformen. Der Fokus liegt auf der Klärung der Begriffe „atypische Arbeit“ und „Prekarität“ sowie deren wechselseitigen Beziehungen.
- Definition und Abgrenzung atypischer Arbeit und Prekarität
- Analyse der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen
- Chancen und Risiken atypischer Beschäftigungsformen
- Bezug zu Robert Castels Theorie der Desintegrationspotentiale
- Interpretation des aktuellen Trends zur Verlagerung vom Normalarbeitsverhältnis auf atypische Beschäftigungsformen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den starken Anstieg atypischer Beschäftigungsformen in den letzten zwanzig Jahren und deren Zusammenhang mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandelprozessen. Sie thematisiert die Diskrepanz zwischen der steigenden Flexibilität der Arbeitswelt und der Starrheit der sozialen Sicherungssysteme und stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor: die Interpretation des Trends zur atypischen Beschäftigung, die Untersuchung der Chancen und Risiken dieser Entwicklung und die Frage nach der Gleichsetzung von atypischer und prekärer Arbeit. Die Arbeit kündigt eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Begriffen, den Rahmenbedingungen, sowie eine Analyse von Chancen und Risiken an.
2. Begriffe: Dieses Kapitel liefert eine definitorische Abgrenzung der Begriffe „atypische Arbeit“ und „Prekarität“. Atypische Beschäftigung wird als Abweichung vom Normalarbeitsverhältnis definiert, das durch Vollzeittätigkeit, unbefristeten Vertrag, soziale Integration und Weisungsgebundenheit gekennzeichnet ist. Die Heterogenität atypischer Beschäftigung wird hervorgehoben, mit Beispielen wie befristeten Verträgen, Teilzeit, Leiharbeit und Minijobs. Prekarität wird im Kontext von Robert Castels Theorie der Desintegrationspotentiale erläutert, welche eine „Zone der Prekarität“ zwischen Integration und Entkopplung beschreibt. Es werden die zentralen Merkmale prekärer Beschäftigungsverhältnisse, wie geringer Arbeitsplatzsicherheit, eingeschränkter sozialer Schutz und geringes Einkommen, zusammengefasst. Der Zusammenhang zwischen atypischer Beschäftigung und Prekarität wird diskutiert, wobei betont wird, dass nicht alle atypischen Beschäftigungsformen prekär sind.
Schlüsselwörter
Atypische Beschäftigung, Prekarität, Normalarbeitsverhältnis, Robert Castel, Desintegrationspotentiale, soziale Sicherungssysteme, Flexibilisierung, Chancen, Risiken, Wirtschaftlicher Wandel, Gesellschaftlicher Wandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Atypische Beschäftigung und Prekarität
Was ist der Gegenstand des Dokuments?
Das Dokument untersucht den Trend zur atypischen Beschäftigung und deren Auswirkungen auf die Prekarität von Arbeitnehmern. Es analysiert die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die zu dieser Entwicklung geführt haben, und beleuchtet Chancen und Risiken atypischer Beschäftigungsformen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Klärung der Begriffe „atypische Arbeit“ und „Prekarität“ sowie deren wechselseitigen Beziehungen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument umfasst eine Einleitung, eine Begriffsbestimmung von „atypischer Arbeit“ und „Prekarität“, eine Analyse der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, eine Betrachtung der Chancen und Risiken atypischer Beschäftigungsformen sowie ein Fazit. Es wird Bezug auf Robert Castels Theorie der Desintegrationspotentiale genommen und der aktuelle Trend zur Verlagerung vom Normalarbeitsverhältnis auf atypische Beschäftigungsformen interpretiert.
Wie wird „atypische Arbeit“ definiert?
Atypische Beschäftigung wird als Abweichung vom Normalarbeitsverhältnis definiert, welches durch Vollzeittätigkeit, unbefristeten Vertrag, soziale Integration und Weisungsgebundenheit gekennzeichnet ist. Beispiele für atypische Beschäftigung sind befristete Verträge, Teilzeit, Leiharbeit und Minijobs.
Wie wird „Prekarität“ im Dokument definiert?
Prekarität wird im Kontext von Robert Castels Theorie der Desintegrationspotentiale erläutert. Es beschreibt eine „Zone der Prekarität“ zwischen Integration und Entkopplung. Zentrale Merkmale prekärer Beschäftigungsverhältnisse sind geringer Arbeitsplatzsicherheit, eingeschränkter sozialer Schutz und geringes Einkommen. Nicht jede atypische Beschäftigung ist zwangsläufig prekär.
Welche wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen werden analysiert?
Das Dokument analysiert die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die zum Anstieg atypischer Beschäftigungsformen geführt haben. Es wird die Diskrepanz zwischen der steigenden Flexibilität der Arbeitswelt und der Starrheit der sozialen Sicherungssysteme thematisiert.
Welche Chancen und Risiken atypischer Beschäftigungsformen werden genannt?
Das Dokument beleuchtet sowohl Chancen als auch Risiken atypischer Beschäftigungsformen. Die genauen Chancen und Risiken werden im Detail im entsprechenden Kapitel analysiert.
Welche Rolle spielt Robert Castel in der Analyse?
Robert Castels Theorie der Desintegrationspotentiale dient als theoretischer Rahmen für die Betrachtung von Prekarität. Seine Konzepte helfen, die Zusammenhänge zwischen atypischer Beschäftigung, sozialer Integration und dem Risiko der Ausgrenzung zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Atypische Beschäftigung, Prekarität, Normalarbeitsverhältnis, Robert Castel, Desintegrationspotentiale, soziale Sicherungssysteme, Flexibilisierung, Chancen, Risiken, Wirtschaftlicher Wandel, Gesellschaftlicher Wandel.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von einer Begriffserklärung, der Analyse der Rahmenbedingungen, der Betrachtung von Chancen und Risiken und einem abschließenden Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis erleichtert die Navigation.
- Quote paper
- Ella Leicht (Author), 2018, Atypische Beschäftigung. Sprungbrett in die Prekarität oder Erwerbsform der Zukunft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457720