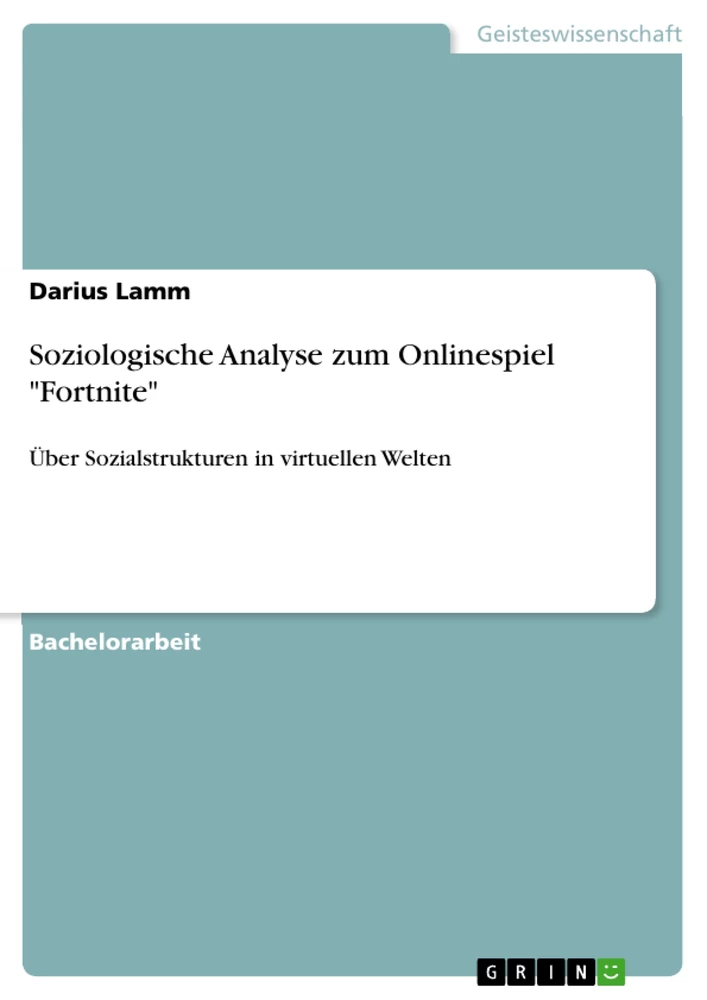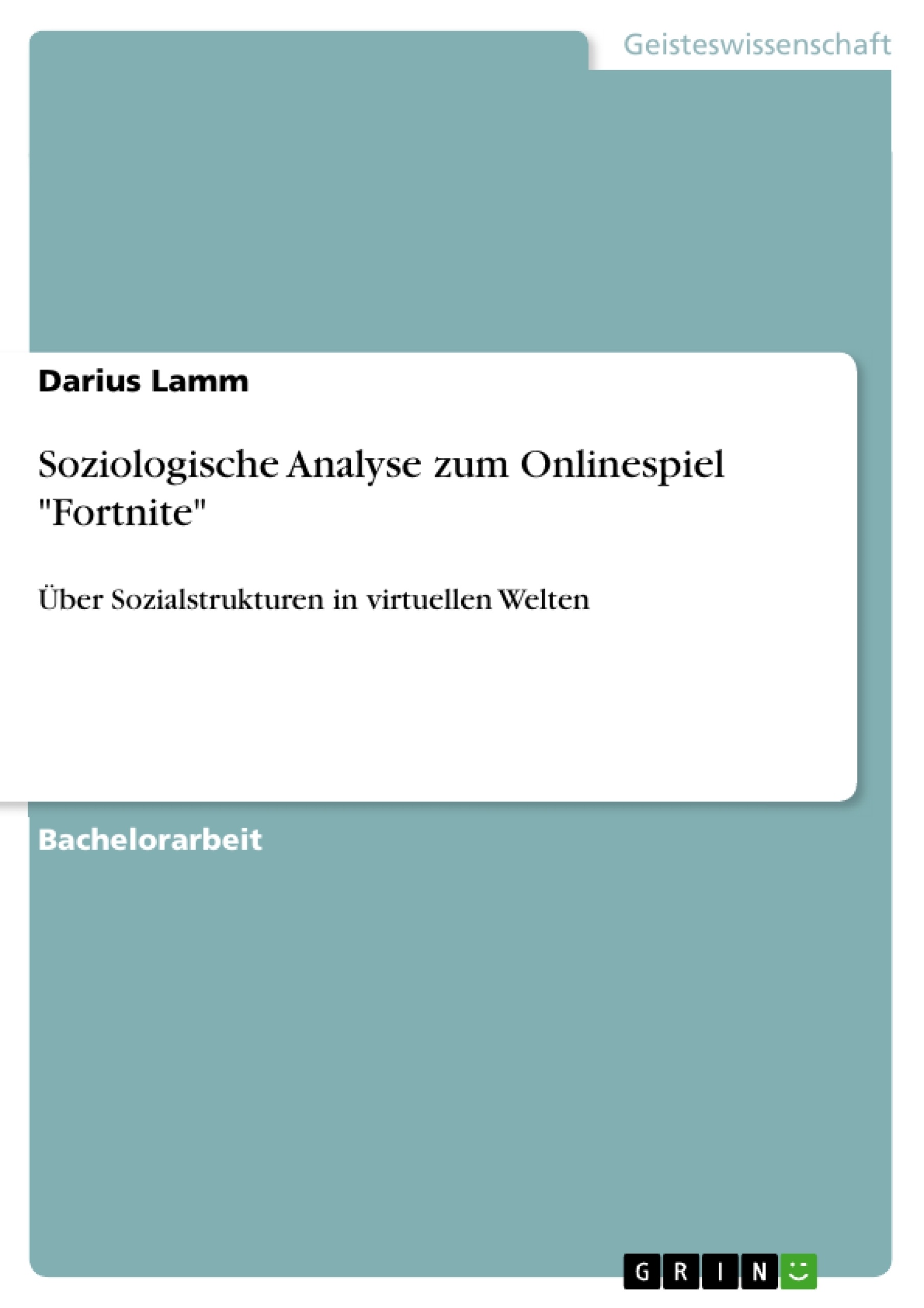Ziel der vorliegenden Arbeit ist es aufzuzeigen, wie aus symbolischen Spielpräsentationen eine Sozialstruktur hervorgebracht wird. Hierfür wird das Onlinespiel "Fortnite" analysiert. Wenn es darum geht, welche Thematiken Studenten der Soziologie innerhalb ihrer Hausarbeiten bearbeiten konnten, so hört oder liest ein jeder Student: "Die Themen liegen auf der Straße." Im Sinne dieser Aussage ging es zunächst auch auf die "Straßen" der Gesellschaft. Auf den Straßen angekommen, den in den Bars sitzenden, an den Bushaltestellen stehenden und im Supermarkt gehenden Menschen fiel eines immer wieder auf- das Handy. Menschen die im Hier und Jetzt, zugleich aber auch im Dort und Jetzt sind. Somit war das Handy mitunter ausschlaggebend für die Grundintention der Erforschung des Onlinespiels "Fortnite". Daneben war es auch die durch soziale Medien erzeugte Popularität des Spiels, sowie die Berichte über das Zustandekommen einer virtuellen Gemeinschaft.
Der Kontrast zwischen Realität und Virtualität wird insbesondere anhand virtueller Spielwelten festgemacht. In diesem Kontext liegen Aussagen der sozialen Isolierung sehr nahe, die wiederum im Alltag als Autoexklusion aufgefasst werden. Es erscheint jedoch aus wissenssoziologischer Sicht paradox, dass 'Spielwelten' der Inbegriff sozialer Isolierung darstellen. Vielmehr stellt sich durch diesen Begriff die Frage, ob denn nicht gerade in diesen exklusiven Welten soziales Handeln vorzufinden ist. Denn die Annahme, dass wir nur in einer Welt existieren können, die wir zusammen mit Anderen konstruieren bildet eine Maxime der Soziologie. Hinzu kommt, dass die Erforschung virtueller Welten überwiegend zum Forschungsgebiet der Psychologie zählt.
Die Sozialstruktur des hier dargestellten Milieus besteht demnach aus der Kohärenz und Interdependenz von differenten sozialweltlichen Wirklichkeitsbezügen, weil diese zu sozialen Beziehungen und sozialen Begegnungen in und zwischen den Welten führen. Als Konsequenz dessen entwickeln und etablieren sich soziale Teilzeitwelten, die allgemein auch als Subwelt, hier als Milieu bezeichnet werden. In diesem Verständnis und Kontext sind Teilzeitwelten somit kleine Welten, die sich inmitten einer übergeordneten Welt befinden und in Austausch mit dieser stehen, anzusehen. Das Milieu als Produkt von Wirklichkeitsüberschneidungen und wechselseitigen Sinnbezügen ermöglicht es, Alltagswissen und Sonderwissen auf symbiotischen Weg zu koordinieren und zu klassifizieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Feldforschungsmethode
- Forschungsrahmen
- Das Spiel
- Im Feld des Spiels
- Erste Eindrücke und Erfahrungen (Solomodus)
- Sozialisationsprozess (Duomodus)
- Institutionalisierung und Habitualisierung von Wissen (Teammodus)
- Internalisierung virtueller Wirklichkeit (50 vs. 50 Modus)
- Schnittpunkte von Sinnweltbezügen
- Charakteristik von Spielen
- Generierung einer sozialen Lebenswelt
- Die Relevanz des Teilzeitweltkonzepts
- Die Teilzeitwelt als Produkt der Dialektik zwischen sozialer Lebenswelt und Alltagswelt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die soziale Struktur des Onlinespiels „Fortnite“ aus wissenssoziologischer Perspektive. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie aus symbolischen Spielpräsentationen eine soziale Lebenswelt entsteht, die sich in Beziehung zur Alltagswelt setzt.
- Die Konstruktion sozialer Lebenswelten in virtuellen Spielumgebungen
- Die Rolle von Wissen und Interaktion in der Entstehung virtueller Gemeinschaften
- Der Einfluss von „Fortnite“ auf die Synthese von Realität und Virtualität
- Das Teilzeitweltkonzept als Analyseinstrument für die Verbindung von virtuellen Spielwelten und der Alltagswelt
- Die Dialektik zwischen sozialen Lebenswelten und Alltagswelt im Kontext virtueller Spielwelten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die Relevanz der Untersuchung von Onlinespielen, insbesondere „Fortnite“, im Kontext der digitalen Alltagswelt und stellt das Forschungsinteresse an der Interaktion und Wissensproduktion in virtuellen Welten heraus. Der Beitrag stellt sich gegen ein reduktionistisches Verständnis von Spielen als Ausdruck sozialer Isolierung und betont die soziologische Relevanz der Analyse von Interaktionsprozessen in virtuellen Umgebungen.
- Feldforschungsmethode: Die Arbeit erläutert die Methodik der „interaktionistischen Ethnografie“ als Grundlage für die Datenerhebung innerhalb des Spiels „Fortnite“. Die Methode ermöglicht die Beobachtung und Analyse von Interaktionen und Kommunikationsformen innerhalb der virtuellen Spielwelt.
- Forschungsrahmen: Die Arbeit stellt das interpretative Paradigma als theoretischen Rahmen dar, das die Analyse der Datenstruktur und die Interpretation der Ergebnisse leitet. Insbesondere die Konzepte von Berger und Luckmann zur „gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit“ sowie die Überlegungen von Schütz und Luckmann zu sozialen Beziehungen und Begegnungen bilden die Grundlage der Analyse.
- Das Spiel: Die Arbeit bietet eine Einführung in das Onlinespiel „Fortnite“, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis der Spielmechanik und des virtuellen Spielumfelds zu vermitteln. Dieser Abschnitt dient als Kontext für die anschliessende Analyse der Interaktionsprozesse innerhalb des Spiels.
- Im Feld des Spiels: Dieser Teil der Arbeit präsentiert und analysiert empirische Befunde aus der Feldforschung in „Fortnite“. Es werden verschiedene Spielmodi (Solo-, Duo-, Team- und 50 vs. 50 Modus) betrachtet und die Interaktionsprozesse sowie die Entwicklung von Wissen und sozialen Strukturen in diesen Modi untersucht. Die Analyse zeigt, wie die Spieler durch die Interaktion im Spiel eine soziale Lebenswelt konstruieren, die mit den Konzepten von Berger und Luckmann interpretiert werden kann.
- Schnittpunkte von Sinnweltbezügen: Dieser Abschnitt untersucht die Bedeutung der Schnittpunkte von Sinnweltbezügen für die Konstruktion einer sozialen Lebenswelt in „Fortnite“. Die Analyse betrachtet die Generierung von Sinn und die Interaktionsprozesse, die zur Entstehung einer virtuellen Gemeinschaft führen. Die Arbeit beleuchtet zudem den Stellenwert der wechselseitigen Sinnweltbezüge für die Sozialstruktur des Spiels und die Entstehung einer Lebenswelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen „Fortnite“, „virtuelle Welten“, „soziale Lebenswelt“, „Wissenssoziologie“, „interaktionistische Ethnografie“, „Teilzeitwelt“, „gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“, „soziales Handeln“, „virtuelle Gemeinschaft“, „interaktionistische Soziologie“, „Alltagswelt“ und „Synthese von Realität und Virtualität“. Die Arbeit untersucht die Interaktionsprozesse, die Wissensproduktion und die Entstehung sozialer Strukturen innerhalb der virtuellen Spielwelt von „Fortnite“ und analysiert die Beziehungen zwischen virtuellen Lebenswelten und der Alltagswelt.
- Quote paper
- Darius Lamm (Author), 2018, Soziologische Analyse zum Onlinespiel "Fortnite", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457348