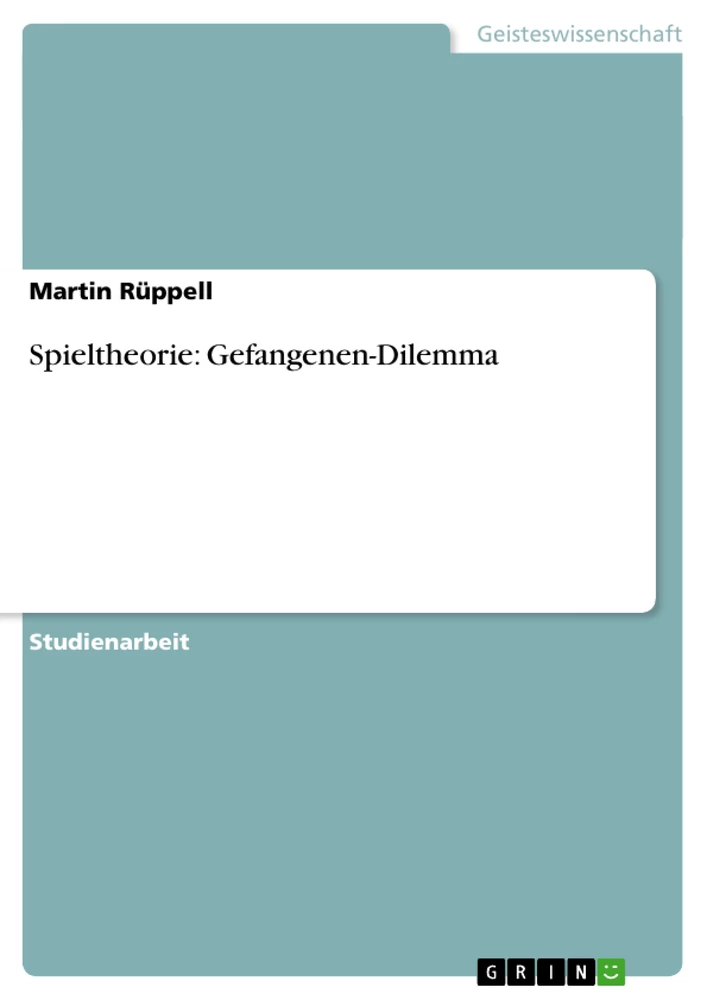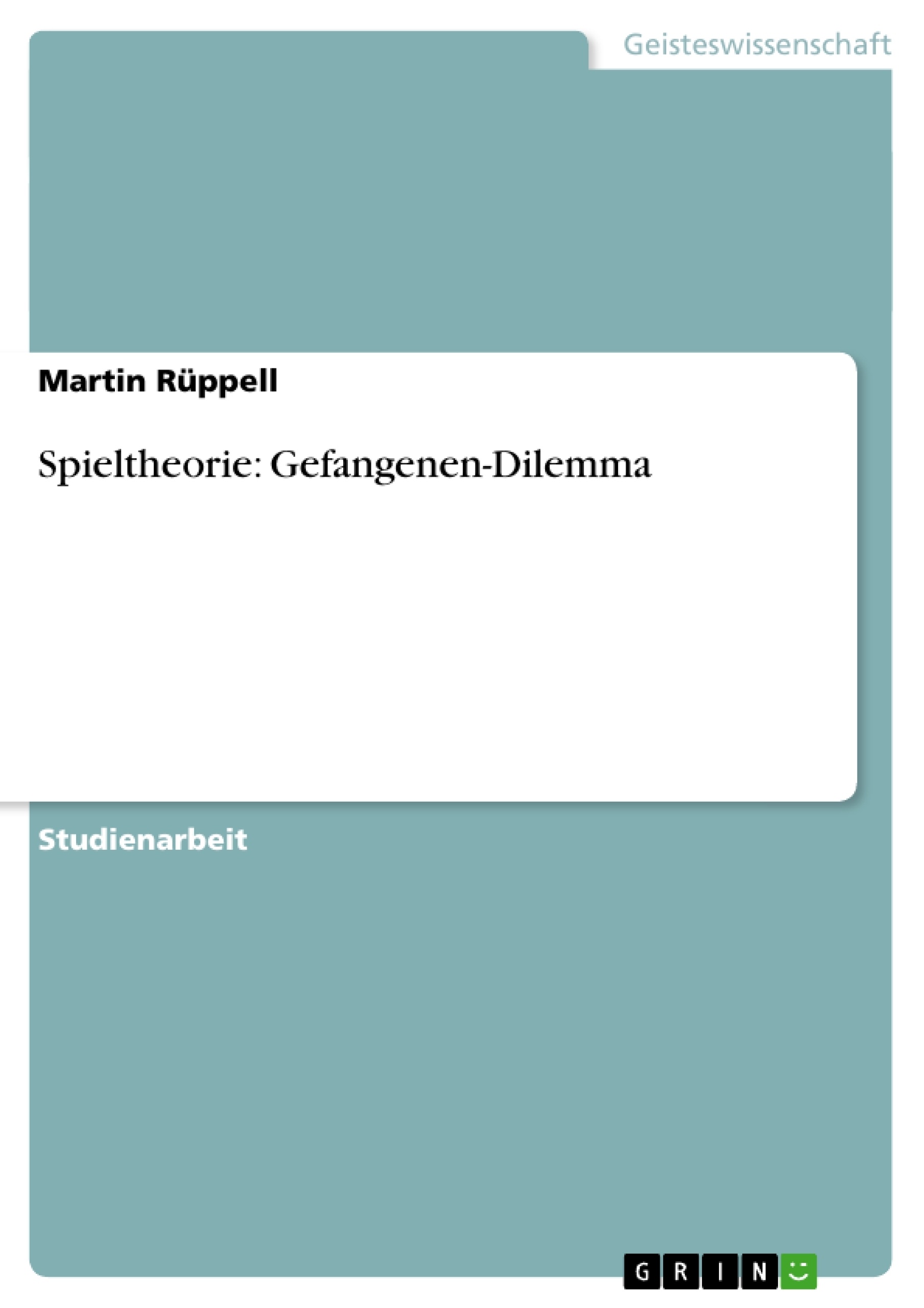Konflikte und Konfliktverhalten sind Forschungsgegenstand der verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen. Entsprechend gibt es viele unterschiedliche Definitionen und Ansätze um Konflikte zu beschreiben. Die vorliegende Arbeit setzt sich mit sozialen Konflikten auseinander. Der Begriff „sozial“ meint in diesem Zusammenhang alle zwischenmenschlichen Konflikte, in die wenigstens zwei Personen verwickelt sind, d.h. Konflikte in Paaren, Gruppen oder zwischen Gruppen, in größeren Gemeinschaften und großen sozialen Gebilden. Der Begriff des sozialen Konfliktes meint also interpersonelle Konflikte. Eine gängige Definition des sozialen Konfliktes stammt von Friedrich Glasl. Ein sozialer Konflikt ist demnach „eine Interaktion zwischen zwei Aktoren (Individuen, Gruppen, Organisationen usw.), wobei wenigstens ein Aktor den Umgang mit einer Differenz so erlebt, dass er durch das Handeln eines anderen Aktors dabei beeinträchtigt wird die eigenen Vorstellungen, Gefühle oder Absichten zu leben oder zu verwirklichen.“
Auch hinsichtlich der sozialen Konflikte existieren mannigfaltige Untersuchungsansätze. So wurde in den frühen Ansetzen zur Erforschung vor allem die Bedeutung von subjektiven Einstellungen zum Gegenüber (z.B. Stereotypen) und das Aggressionsverhalten untersucht. Der Aufmerksamkeitsfokus lag also auf den an der Konfliktsituation beteiligten Personen. Ein anderer Ansatz liegt darin, das Hauptaugenmerk auf die dem Konflikt zugrunde liegende Situation der Abhängigkeit der Konfliktparteien voneinander zu lenken. Derartige Situationen sind Grundlage spieltheoretischer Untersuchungen6, die Gegenstand der folgenden Darstellung sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines zur Spieltheorie
- Das Gefangenen-Dilemma aus (klassischer) ökonomischer Sicht
- Spielsituation
- Spielresultate
- Psychologischer Ansatz
- Kooperation fördernde Faktoren
- Kooperation hindernde Faktoren
- Anwendungen
- Beispiel: Kartellabsprachen in einem Dyopol
- Beispiel: Bereitstellung öffentlicher Güter durch Private
- Beispiel: Krieg
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Gefangenen-Dilemma, ein zentrales Konzept der Spieltheorie. Ziel ist es, das Dilemma sowohl aus ökonomischer als auch aus psychologischer Perspektive zu beleuchten und die Faktoren zu analysieren, die Kooperation oder Nicht-Kooperation in solchen Situationen beeinflussen.
- Das Gefangenen-Dilemma als spieltheoretisches Modell
- Ökonomische Betrachtung des Dilemmas und rationale Entscheidungsfindung
- Psychologische Einflussfaktoren auf die Kooperation
- Anwendungsbeispiele des Gefangenen-Dilemmas in verschiedenen Kontexten
- Abweichungen des realen Verhaltens vom rational-ökonomischen Modell
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik sozialer Konflikte ein und definiert den Begriff des sozialen Konflikts nach Friedrich Glasl. Sie beleuchtet verschiedene Forschungsansätze zu sozialen Konflikten, wobei der Fokus auf die spieltheoretische Betrachtungsweise gelegt wird, welche die Abhängigkeit der Konfliktparteien voneinander in den Mittelpunkt stellt. Die Arbeit positioniert sich somit als spieltheoretische Auseinandersetzung mit sozialen Konflikten, insbesondere dem Gefangenen-Dilemma.
Allgemeines zur Spieltheorie: Dieses Kapitel beschreibt die Spieltheorie als Zweig der Mathematik und Ökonomie, der strategische Entscheidungssituationen analysiert, in denen Interdependenz der Entscheidungen zentral ist. Es hebt den Unterschied zwischen der normativen (ökonomischen) und deskriptiven (psychologischen) Herangehensweise hervor. Während die Ökonomie das rational-ökonomisch zu erwartende Verhalten analysiert, fokussiert sich die Psychologie auf die situativen und personalen Bedingungen für kooperatives oder nicht-kooperatives Verhalten.
Das Gefangenen-Dilemma aus (klassischer) ökonomischer Sicht: Dieses Kapitel präsentiert das klassische Gefangenen-Dilemma aus ökonomischer Sicht. Es beschreibt die Spielsituation, die möglichen Strategien der beteiligten Akteure und die resultierenden Ergebnisse. Der Fokus liegt auf der Analyse der rationalen Entscheidung unter Berücksichtigung der Interdependenz und der daraus resultierenden suboptimalen Gesamtsituation, wenn beide Akteure rational handeln. Der Konflikt zwischen individueller Rationalität und kollektiver Optimalität steht im Vordergrund.
Psychologischer Ansatz: Dieses Kapitel untersucht das Gefangenen-Dilemma unter Berücksichtigung psychologischer Faktoren. Es werden sowohl kooperationsfördernde als auch kooperationshindernde Faktoren detailliert erläutert. Beispiele für fördernde Faktoren sind externe Anreize, Kommunikation, Bindungen, soziale Normen und Vertrauen, sowie die persönliche Orientierung der Spieler und wiederholte Spielinteraktionen. Hindernde Faktoren bleiben hier unausgeführt.
Anwendungen: Dieses Kapitel illustriert die Relevanz des Gefangenen-Dilemmas anhand von konkreten Anwendungsbeispielen aus verschiedenen Bereichen. Es werden Kartellabsprachen, die Bereitstellung öffentlicher Güter durch Private und die Dynamik von Kriegen als Beispiele für Situationen diskutiert, die sich durch das Gefangenen-Dilemma modellieren lassen. Die Beispiele verdeutlichen die breite Anwendbarkeit des Modells und die Bedeutung des Verständnisses der zugrundeliegenden Mechanismen.
Schlüsselwörter
Spieltheorie, Gefangenen-Dilemma, Kooperation, Nicht-Kooperation, rationale Entscheidung, ökonomischer Ansatz, psychologischer Ansatz, soziale Konflikte, Interdependenz, strategische Entscheidung, Anreize, Kommunikation, soziale Normen, Vertrauen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Das Gefangenen-Dilemma
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Gefangenen-Dilemma, einem zentralen Konzept der Spieltheorie. Sie analysiert das Dilemma aus ökonomischer und psychologischer Perspektive und untersucht die Faktoren, die Kooperation oder Nicht-Kooperation beeinflussen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: das Gefangenen-Dilemma als spieltheoretisches Modell; die ökonomische Betrachtung des Dilemmas und rationale Entscheidungsfindung; psychologische Einflussfaktoren auf die Kooperation; Anwendungsbeispiele des Gefangenen-Dilemmas in verschiedenen Kontexten; und Abweichungen des realen Verhaltens vom rational-ökonomischen Modell.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Allgemeines zur Spieltheorie, Das Gefangenen-Dilemma aus (klassischer) ökonomischer Sicht, Psychologischer Ansatz, Anwendungen und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Gefangenen-Dilemmas.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik sozialer Konflikte ein, definiert den Begriff des sozialen Konflikts nach Friedrich Glasl und beleuchtet verschiedene Forschungsansätze, wobei der Fokus auf die spieltheoretische Betrachtungsweise gelegt wird.
Was wird im Kapitel "Allgemeines zur Spieltheorie" erklärt?
Dieses Kapitel beschreibt die Spieltheorie als Zweig der Mathematik und Ökonomie und hebt den Unterschied zwischen der normativen (ökonomischen) und deskriptiven (psychologischen) Herangehensweise hervor.
Wie wird das Gefangenen-Dilemma aus ökonomischer Sicht betrachtet?
Das Kapitel zur ökonomischen Sicht präsentiert das klassische Gefangenen-Dilemma, beschreibt die Spielsituation, die Strategien der Akteure und die Ergebnisse. Der Fokus liegt auf der rationalen Entscheidung und dem Konflikt zwischen individueller Rationalität und kollektiver Optimalität.
Welche psychologischen Aspekte werden betrachtet?
Der psychologische Ansatz untersucht das Gefangenen-Dilemma unter Berücksichtigung kooperationsfördernder (z.B. externe Anreize, Kommunikation, Bindungen) und kooperationshindernder Faktoren.
Welche Anwendungsbeispiele werden genannt?
Die Arbeit illustriert die Relevanz des Gefangenen-Dilemmas anhand von Beispielen wie Kartellabsprachen, Bereitstellung öffentlicher Güter durch Private und die Dynamik von Kriegen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Spieltheorie, Gefangenen-Dilemma, Kooperation, Nicht-Kooperation, rationale Entscheidung, ökonomischer Ansatz, psychologischer Ansatz, soziale Konflikte, Interdependenz, strategische Entscheidung, Anreize, Kommunikation, soziale Normen, Vertrauen.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für Spieltheorie, soziale Konflikte, Entscheidungsfindung und die Interaktion von ökonomischen und psychologischen Faktoren interessieren.
- Quote paper
- Martin Rüppell (Author), 2005, Spieltheorie: Gefangenen-Dilemma, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45706