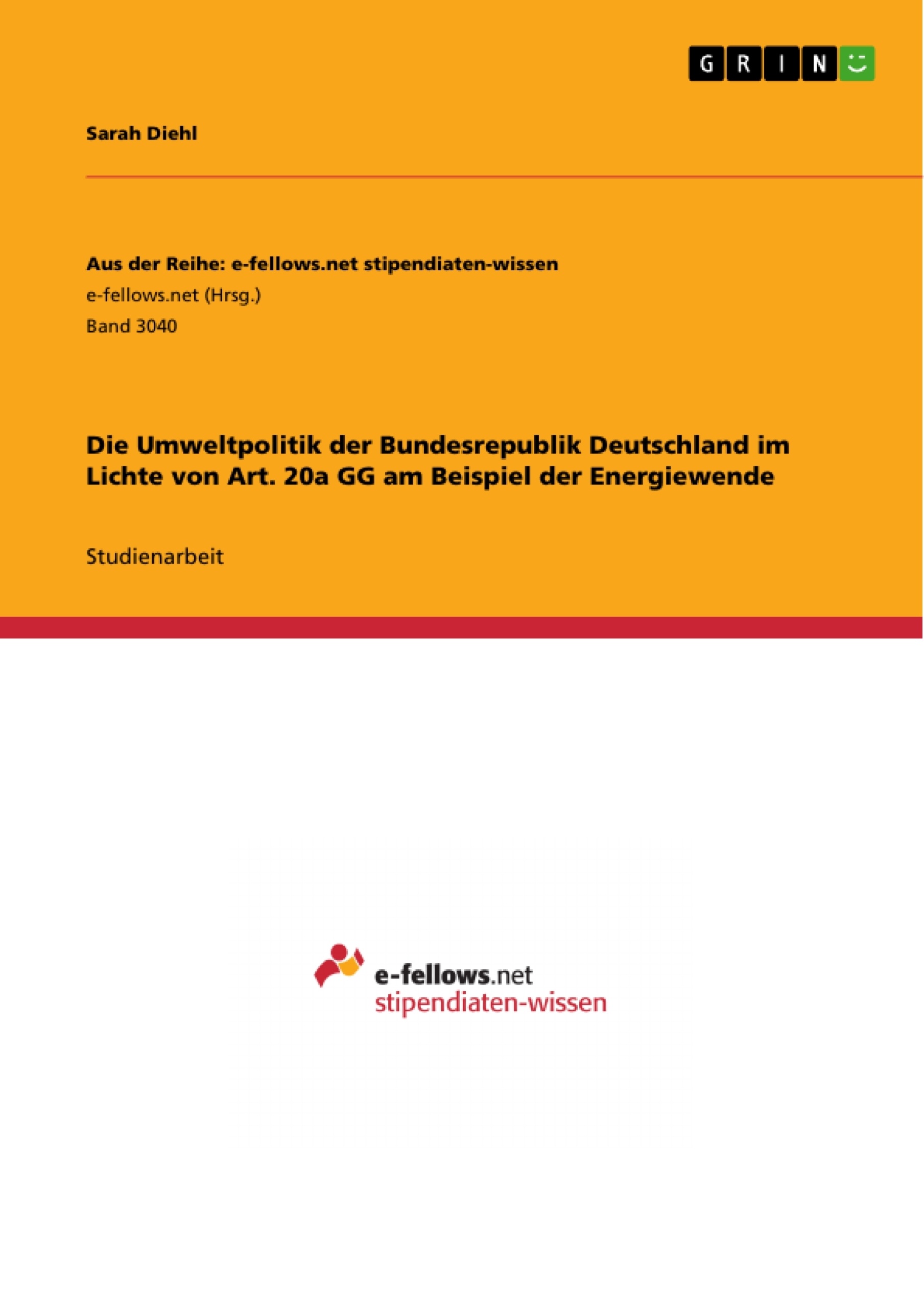Kein Tag vergeht, ohne dass neue Schreckensmeldungen über die ökologische Krise publik werden: Der voranschreitende Verlust der Artenvielfalt, die Kontamination von Gewässern, die Verunreinigung von Luft und Böden, die Abholzung des Regenwaldes, die Zunahme von Extremwetterlagen und daraus resultierende Massenfluchtbewegungen sind nur einige Aspekte. Insbesondere der durch den Ausstoß von Treibhausgasen verursachte Klimawandel gilt als eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Diese, durch das anthropogene Wirken auf der Erde verursachten, Umweltprobleme gefährden zunehmend nicht nur die Existenzgrundlage der gegenwärtig lebenden Menschen, sondern insbesondere auch die künftiger Generationen.
Korrespondierend zum Anstieg der Belastungen und dem Bekanntwerden neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse haben Umweltschutz und -politik seit den 1980er Jahren in der öffentlichen Diskussion immer mehr an Bedeutung gewonnen. Im Zuge dessen setzte sich die Einsicht durch, dass der Staat schon zum Schutz der Menschenwürde zur Gewährleistung eines „ökologisches Existenzminimums“ für künftige und gegenwärtige Generationen verpflichtet sein müsse. Im Jahr 1994 erhielt der Schutz der Umwelt schließlich im Rahmen „einer der umfangreichsten Änderungen seit Bestehen des Grundgesetzes“ durch Art. 20a GG Verfassungsrang. Insbesondere soll dieser Schutz dahingehend ausgestaltet sein, dass die Umwelt auch für nachfolgende Generationen erhalten wird. Dies wurde als große Errungenschaft gefeiert, die zu einer effektiveren Berücksichtigung von Umweltbelangen in der Politik führen sollten.
Fraglich ist jedoch, ob die Umweltpolitik der Bundesrepublik Deutschland der Staatszielbestimmung aus Art. 20a GG auch tatsächlich gerecht wird, also ob sie zum Schutz der Umwelt für künftige Generationen beiträgt. Dies soll in der vorliegenden Arbeit exemplarisch am Beispiel der viel diskutierten Energiewende beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Umwelt und Generationengerechtigkeit
- Umweltpolitik in Deutschland am Beispiel der Energiewende
- Was ist Umweltpolitik?
- Begriff und Aufgaben
- Entwicklung der Umweltpolitik in Deutschland
- Grundprinzipien der Umweltpolitik
- Verfassungsrechtliche Verpflichtung zum Umweltschutz
- Was ist eine Staatszielbestimmung?
- Art. 20a GG - Umweltschutz als Staatszielbestimmung
- Verhältnis von Art. 20a GG zu anderen Rechtsgütern
- Umweltpolitik in Deutschland am Beispiel der Energiewende
- Was ist die Energiewende?
- Teilziele zur Umsetzung der Energiewende
- Tatsächliche Veränderung bis heute
- Was ist Umweltpolitik?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Umweltpolitik der Bundesrepublik Deutschland im Kontext des Grundgesetzes, insbesondere des Artikels 20a GG, der den Umweltschutz zur Staatszielbestimmung erhebt. Mit dem Beispiel der Energiewende untersucht sie, inwieweit die deutsche Umweltpolitik dem Gebot der Generationengerechtigkeit gerecht wird. Die Arbeit fokussiert auf die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Umweltschutzes, analysiert die Ziele der Energiewende und stellt diese den bisherigen tatsächlichen Veränderungen gegenüber.
- Verfassungsrechtliche Grundlagen des Umweltschutzes
- Die Energiewende als Beispiel der deutschen Umweltpolitik
- Generationengerechtigkeit im Kontext der Energiewende
- Abwägung von Umweltschutz und anderen Rechtsgütern
- Ziele und tatsächliche Veränderungen der Energiewende
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die Herausforderungen der ökologischen Krise, insbesondere den Klimawandel, und setzt diese in Verbindung mit der Frage der Generationengerechtigkeit. Es wird die Entwicklung des Umweltschutzes als politisches Thema und die Bedeutung von Art. 20a GG als Grundlage der deutschen Umweltpolitik dargestellt.
- Kapitel 2 widmet sich der Umweltpolitik Deutschlands, indem es den Begriff, die Aufgaben und die Entwicklung dieses Politikfeldes erklärt. Die drei Grundprinzipien der Umweltpolitik - Vorsorge-, Verursacher- und Kooperationsprinzip - werden erläutert, um einen tieferen Einblick in die Funktionsweise der Umweltpolitik in Deutschland zu ermöglichen.
- Im dritten Kapitel wird die verfassungsrechtliche Verpflichtung zum Umweltschutz näher beleuchtet, indem die Bedeutung der Staatszielbestimmung und deren Verhältnis zu anderen Rechtsgütern aufgezeigt wird.
- Das vierte Kapitel analysiert die Energiewende als exemplarischen Fall der deutschen Umweltpolitik. Die Ziele und Motive der Energiewende werden vorgestellt und die verschiedenen Teilziele, die die Bundesregierung zur Umsetzung dieses Projekts festgelegt hat, erläutert.
- Das fünfte Kapitel befasst sich mit der tatsächlichen Umsetzung der Energiewende. Hier werden die gesetzten Ziele mit den bisherigen tatsächlichen Veränderungen verglichen, um zu beurteilen, inwieweit die deutschen Umweltmaßnahmen geeignet sind, die Umwelt für kommende Generationen zu schützen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Umweltpolitik, Generationengerechtigkeit, Art. 20a GG, Energiewende, Klimawandel, Treibhausgasemissionen, erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Sie analysiert die verfassungsrechtlichen Grundlagen und die praktischen Auswirkungen der Umweltpolitik Deutschlands anhand des konkreten Beispiels der Energiewende.
- Quote paper
- Sarah Diehl (Author), 2018, Die Umweltpolitik der Bundesrepublik Deutschland im Lichte von Art. 20a GG am Beispiel der Energiewende, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456987