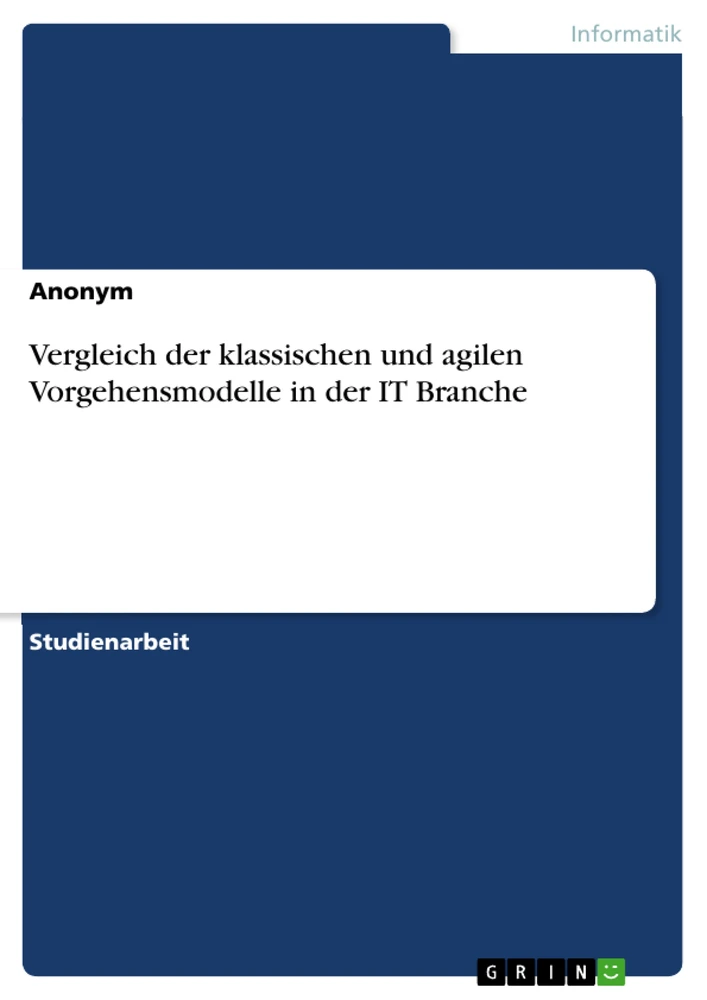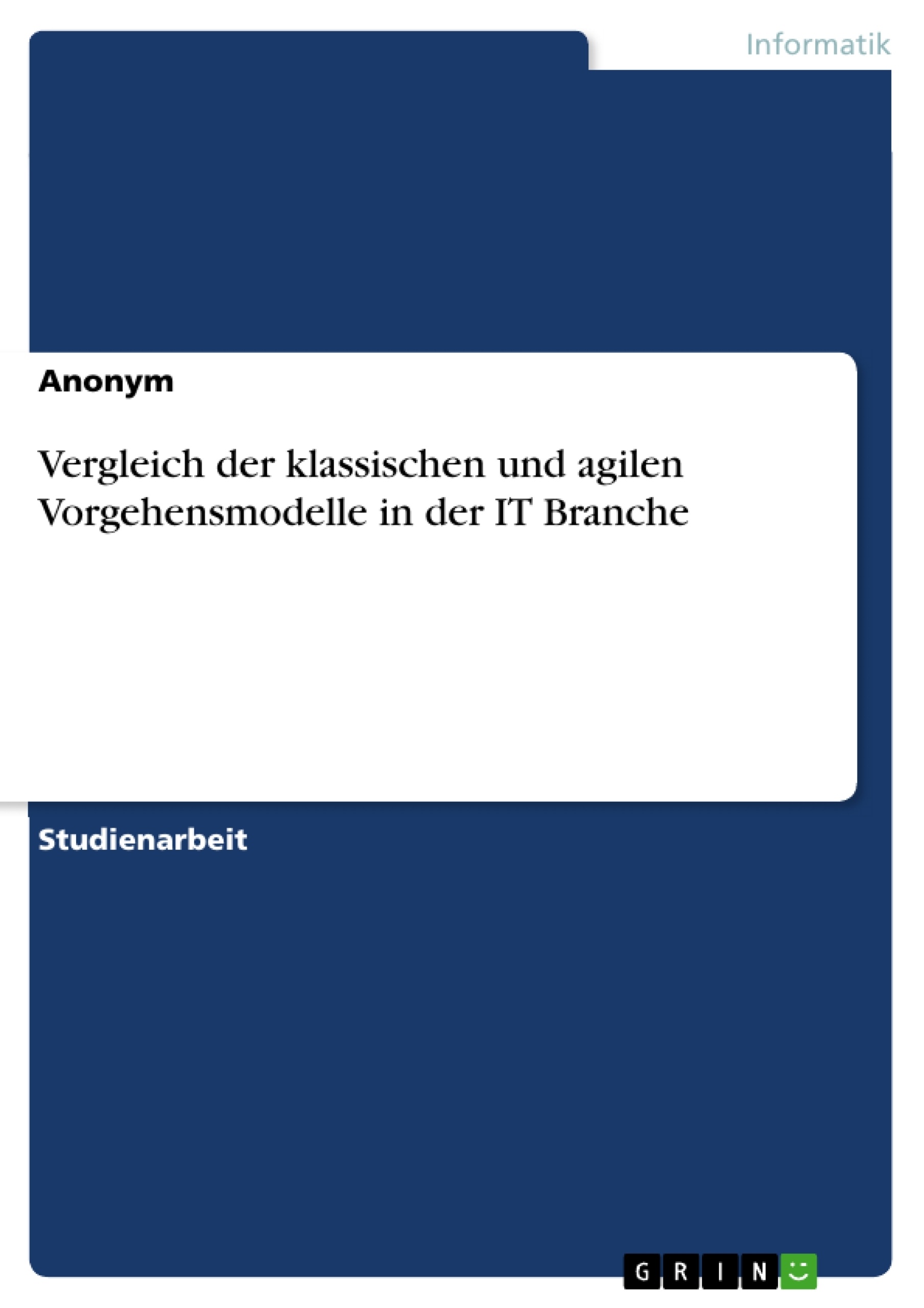Die IT-Branche ist ständigen Veränderungen ausgesetzt. Software wird mittlerweile in allen Lebensbereichen eingesetzt und ist nicht mehr wegzudenken. Dementsprechend steigen auch die Anforderungen an die Ersteller von Software. Diese stehen verschiedenen gesteigerten Anforderungen gegenüber, wie zum einen der Anspruch hinsichtlich einer hohen Zuverlässigkeit sowie gleichzeitig die Sicherstellung der Verfügbarkeit der Systeme, welche innerhalb kürzester Zeit erstellt werden müssen. Deshalb erfolgt die Erstellung neuer Software meist innerhalb eines Projektes.
Doch es gibt genügend Beispiele, bei denen IT-Projekte nicht erfolgreich verlaufen sind. So hat Ford 200 Mio. US-Dollar in ein Projekt zur Erneuerung der vorhandenen Software investiert, um nach drei Jahren zum Altbewährten zurückzukehren. Da es noch viele weitere dieser Beispiele gibt, stellt sich die Frage, wie Projekte erfolgreich gestaltet werden können. Einen Ansatz dafür sind die Vorgehensmodelle im Projekt. Hier wird nach klassischen und agilen Vorgehensmodellen unterschieden. Seit Jahren steigen die Bedeutung und der Einsatz von agilen Vorgehensmodellen gerade auch in der IT-Branche und der Einsatz der klassischen Vorgehensmodelle wird geringer.
Diese Ausarbeitung befasst sich genau mit diesen zwei Vorgehensmodellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zielsetzung
- 1.3. Aufbau und Methodik
- 2. Grundlagen
- 2.1. Definition und Entwicklung der Vorgehensmodelle
- 2.2. Klassische Vorgehensmodelle
- 2.3. Das Wasserfallmodell
- 2.4. Agile Vorgehensmodelle
- 2.5. Scrum
- 2.5.1.1. Projektrollen
- 2.5.1.2. Sprints
- 2.5.1.3. Artefakte
- 3. Vergleich der klassischen und agilen Vorgehensmodelle in der IT-Branche
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, ein grundlegendes Verständnis für klassische und agile Vorgehensmodelle in der IT-Branche zu vermitteln und deren Unterschiede, Vor- und Nachteile zu erläutern. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welches Vorgehensmodell ist für die IT-Branche besser geeignet?
- Definition und Entwicklung von Vorgehensmodellen
- Charakteristika klassischer Vorgehensmodelle (am Beispiel des Wasserfallmodells)
- Charakteristika agiler Vorgehensmodelle (am Beispiel von Scrum)
- Vergleich der beiden Modelltypen hinsichtlich ihrer Eignung für die IT-Branche
- Bewertung der jeweiligen Vor- und Nachteile im Kontext der IT-Projektlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, indem es die Problemstellung – die Herausforderungen und Misserfolge von IT-Projekten – beschreibt und die Zielsetzung der Arbeit definiert. Die Notwendigkeit des Vergleichs klassischer und agiler Vorgehensmodelle im Kontext der sich ständig verändernden IT-Landschaft wird begründet.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für den Vergleich. Es definiert den Begriff "Vorgehensmodell" im Kontext von IT-Projekten und beleuchtet die historische Entwicklung dieser Modelle von frühen Ansätzen bis hin zum agilen Manifest. Es werden sowohl klassische (mit dem Wasserfallmodell als Beispiel) als auch agile (mit Scrum als Beispiel) Vorgehensmodelle vorgestellt und ihre grundlegenden Konzepte erläutert.
3. Vergleich der klassischen und agilen Vorgehensmodelle in der IT-Branche: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es vergleicht die im vorherigen Kapitel beschriebenen Vorgehensmodelle (Wasserfall und Scrum) im Hinblick auf ihre Eignung für die IT-Branche. Vor- und Nachteile beider Ansätze werden ausführlich diskutiert, wobei Aspekte wie Flexibilität, Änderungsmanagement, Risikomanagement und Teamstrukturen berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der Studie der Standish Group werden herangezogen, um die Erfolgsraten beider Modelltypen zu belegen und die Schlussfolgerungen zu stützen.
Schlüsselwörter
Klassische Vorgehensmodelle, Agile Vorgehensmodelle, Wasserfallmodell, Scrum, IT-Projektmanagement, Softwareentwicklung, Projektmanagement, Anforderungsmanagement, Flexibilität, Risikomanagement, Erfolgsfaktoren, Teamwork, Methodenvergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich klassischer und agiler Vorgehensmodelle in der IT-Branche
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht klassische und agile Vorgehensmodelle im Kontext der IT-Branche. Sie untersucht deren Unterschiede, Vor- und Nachteile und zielt darauf ab, die jeweilige Eignung für IT-Projekte zu bewerten.
Welche Vorgehensmodelle werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Wasserfallmodell als Beispiel für ein klassisches Vorgehensmodell und Scrum als Beispiel für ein agiles Vorgehensmodell. Diese werden ausführlich beschrieben und miteinander verglichen.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welches Vorgehensmodell (klassisch oder agil) ist für die IT-Branche besser geeignet?
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Kapitel 1 (Einleitung): Stellt die Problemstellung (Herausforderungen bei IT-Projekten) und die Zielsetzung der Arbeit vor. Begründet die Notwendigkeit des Vergleichs klassischer und agiler Methoden.
Kapitel 2 (Grundlagen): Definiert Vorgehensmodelle und beleuchtet deren historische Entwicklung. Stellt klassische und agile Vorgehensmodelle (Wasserfall und Scrum) vor und erklärt deren grundlegende Konzepte.
Kapitel 3 (Vergleich): Vergleicht Wasserfall und Scrum hinsichtlich ihrer Eignung für die IT-Branche. Diskutiert Vor- und Nachteile unter Berücksichtigung von Flexibilität, Änderungsmanagement, Risikomanagement und Teamstrukturen. Berücksichtigt Ergebnisse der Standish Group zur Erfolgsrate beider Modelltypen.
Kapitel 4 (Fazit): Zusammenfassende Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Klassische Vorgehensmodelle, Agile Vorgehensmodelle, Wasserfallmodell, Scrum, IT-Projektmanagement, Softwareentwicklung, Projektmanagement, Anforderungsmanagement, Flexibilität, Risikomanagement, Erfolgsfaktoren, Teamwork, Methodenvergleich.
Welche Aspekte werden beim Vergleich der Vorgehensmodelle berücksichtigt?
Der Vergleich berücksichtigt Aspekte wie Flexibilität, Änderungsmanagement, Risikomanagement und die jeweiligen Teamstrukturen. Die Erfolgsraten der Modelle werden ebenfalls anhand von Studien (z.B. Standish Group) bewertet.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die konkreten Schlussfolgerungen zur Frage, welches Vorgehensmodell besser geeignet ist, ergeben sich aus dem Vergleich in Kapitel 3 und werden im Fazit zusammengefasst. Die Arbeit liefert keine pauschale Antwort, sondern bewertet die Vor- und Nachteile im Kontext der IT-Projektlandschaft.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Vergleich der klassischen und agilen Vorgehensmodelle in der IT Branche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456975