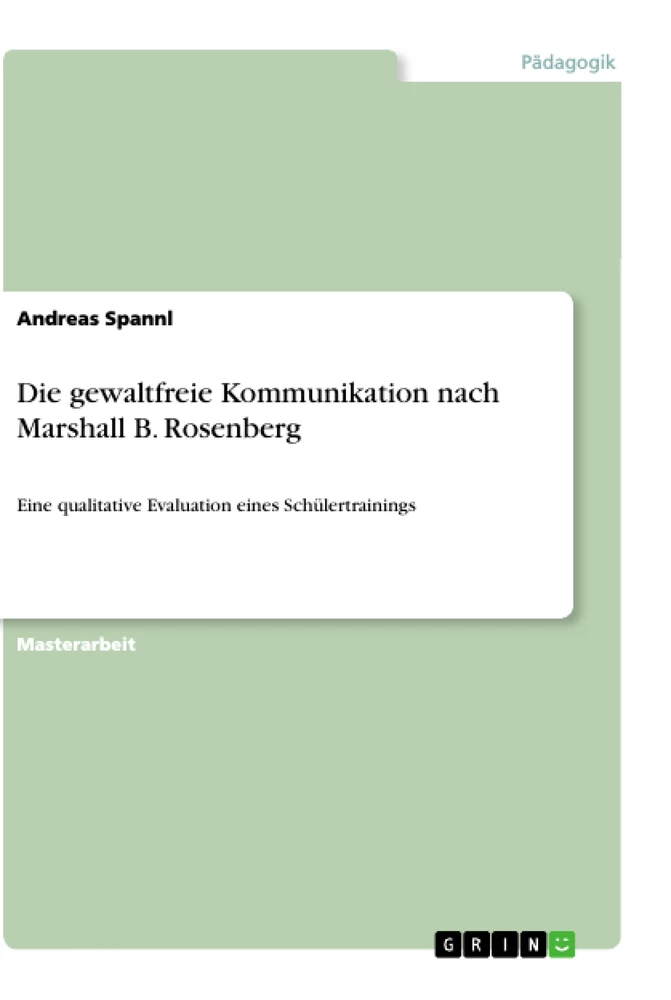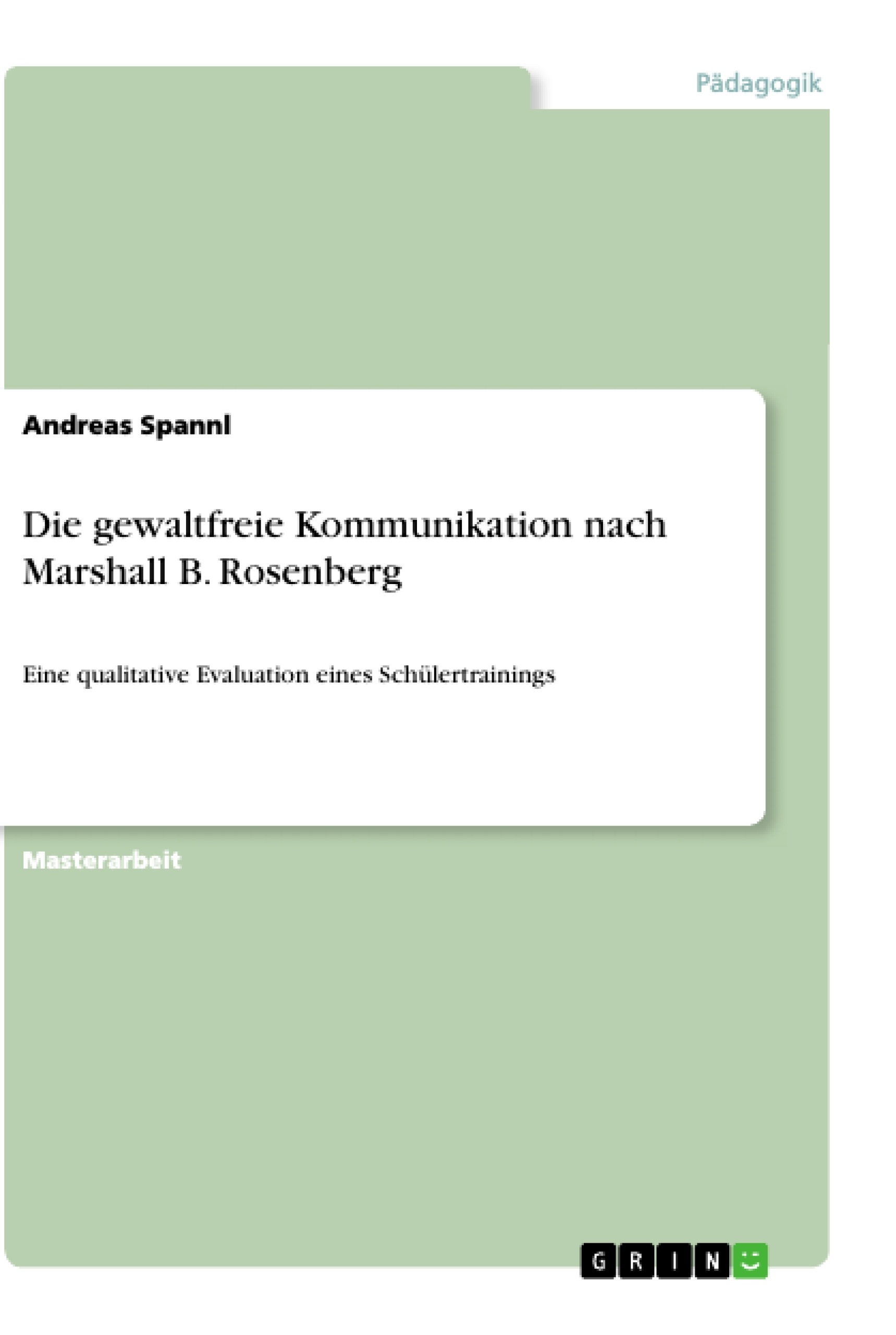„Konflikte löst man am besten, indem man sie gar nicht erst entstehen lässt (ANDERS).“ Anhand des Zitats, welches der Philosoph und Künstler Jerome ANDERS prägte, könnte man leicht den Eindruck gewinnen, dass Konflikte trivial zu lösen sind. Einfach könnte der Umgang bzw. die Bewältigung erst dann sein, wenn man die richtige Kommunikationsstrategie wählt.
Ist von einem Konflikt beziehungsweise Streit die Rede, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit jeder von uns sofort eine Situation vor Augen, die schon einmal im Alltag erlebt wurde. Konflikte begegnen uns in allen denkbaren Bereichen, in der Partnerschaft, in der Öffentlichkeit oder sogar international zwischen verschiedenen Ländern. Als ein zentraler Brennpunkt für Konfliktentstehungen kann der Berufsalltag gesehen werden. Hierbei gibt es vielerlei Ursachen, die zu Spannungen unter den Mitarbeitern führen und sich zu Konflikten entwickeln können. Dabei kann ein möglicher Faktor in den Machthierarchien liegen, wenn z.B. um eine besondere Position gerungen wird. Ebenso können Konflikte durch unterschiedliche Rollen bzw. Aufgabenbereiche verursacht werden, wenn z.B. ein Mitarbeiter schwierigere oder uninteressantere Aufgaben als ein anderer Mitarbeiter zugeteilt bekommt. Oftmals spielen sich diese Gegensätze auf verschiedenen Ebenen ab. Auf der Beziehungsebene können Konflikte durch emotionale Dissonanzen verursacht werden. Solche Konflikte sind im Arbeitsleben schwieriger zu beheben, denn die Thematisierung der Beziehungsebene wird in vielen Unternehmen oft vernachlässigt und nicht zur Sprache gebracht. Konflikte und Streitigkeiten können sich u.U. zu schlimmeren und in nicht seltenen Fällen zu schwerwiegenderen Ausprägungen entwickeln. Die psychische Gewalt wird als ein stark zunehmendes gesellschaftliches Problem wahrgenommen. Oft erleben die Betroffenen wiederholte feindselige Äußerungen oder Angriffe, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und zum Teil nonverbal stattfinden können. Hierbei zu nennen ist das Mobbing am Arbeitsplatz. Laut einer Studie aus dem Jahre 2014 gaben 28% der Befragten an, schon einmal Opfer von Mobbing geworden zu sein. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2013. Explizit auf den Arbeitsplatz bezogen, gaben 11,3% der Befragten an schon einmal gemobbt worden zu sein. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Grundverständnis von Gewalt und Kommunikation
- 2.1 Gewaltbegriff
- 2.1.1 Enge vs. weite Definition
- 2.1.2 Abgrenzungen (Gewalt, Aggressionen, Devianz, Konflikt)
- 2.1.3 Erscheinungsformen von Gewalt
- 2.2 Begriff der Kommunikation
- 2.2.1 Anatomie einer Nachricht
- 2.2.2 „Vier Ohren“ des Empfängers
- 3 Konflikte im schulischen, privaten und beruflichen Kontext
- 3.1 Definition sozialer Konflikt
- 3.2 Konfliktarten
- 3.3 Konfliktstile
- 3.4 Konflikte in Beziehungen
- 3.5 Gruppenkonflikte
- 3.6 Konflikte in der Schule
- 3.6.1 Disziplinkonflikte (Konflikte zwischen Lehrer und Schüler)
- 3.6.2 Konflikte verursacht durch Lehrkräfte
- 4 Die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. ROSENBERG
- 4.1 Wissenschaftstheoretische Einordnung der GfK
- 4.2 Definition GfK
- 4.3 Vier Komponenten der GfK
- 4.4 Empathie
- 4.5 Vier-Ohren-Modell nach ROSENBERG
- 4.6 Forschungsstand zur GfK
- 5 Fragestellungen
- 6 Forschungsmethodisches Vorgehen
- 6.1 Survey Design
- 6.2 Ablauf und Situationsanalyse des Trainings
- 6.3 Erhebung
- 6.3.1 Durchführung
- 6.3.2 Erhebungsverfahren
- 6.3.3 Feldzugang
- 6.4 Auswertung
- 6.5.1 Auswertungsablauf
- 6.5.2 Qualitative Analysetechnik
- 6.5.3 Quantitative Analysetechnik
- 7 Ergebnisteil
- 7.1 Fragestellung A (induktive Kategorienbildung)
- 7.2 Fragestellung B (induktive Kategorienbildung)
- 7.3 Hauptfragestellung (deduktive Kategorienanwendung)
- 8 Kritische Betrachtung der GfK bzw. des Schülertrainings
- 8.1 Grenzen bezüglich der theoretischen Konzeption
- 8.2 Grenzen hinsichtlich der praktischen Umsetzung
- 8.3 Grenzen bezüglich des Schülertrainings
- 9 Kritische Reflexion des eigenen Forschungsprozesses
- 10 Resümee und Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit evaluiert qualitativ ein Schülertraining zur Gewaltfreien Kommunikation (GfK) nach Marshall B. Rosenberg. Ziel ist es, die Wirksamkeit des Trainings und die Anwendbarkeit der GfK im schulischen Kontext zu untersuchen. Die Arbeit analysiert die Erfahrungen der Schüler und beleuchtet Herausforderungen bei der Umsetzung der GfK.
- Gewaltfreie Kommunikation (GfK) nach Rosenberg
- Konfliktlösung und -prävention im schulischen Umfeld
- Qualitative Forschungsmethoden und deren Anwendung
- Herausforderungen bei der Implementierung der GfK
- Wirkung des Trainings auf die Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung: Die Arbeit beginnt mit der These, dass Konflikte vermeidbar sind, indem die richtige Kommunikationsstrategie gewählt wird. Sie verdeutlicht die Allgegenwart von Konflikten in verschiedenen Lebensbereichen und hebt den Berufsalltag als zentralen Brennpunkt hervor. Besonders wird auf die zunehmende psychische Gewalt, inklusive Mobbing am Arbeitsplatz, als gesellschaftliches Problem hingewiesen, basierend auf aktuellen Studienergebnissen.
2 Grundverständnis von Gewalt und Kommunikation: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Arbeit fest, indem es den Gewaltbegriff (enge und weite Definitionen) und seine Erscheinungsformen beleuchtet. Es wird zwischen Gewalt, Aggression, Devianz und Konflikt differenziert. Der Begriff der Kommunikation wird ebenfalls definiert, wobei die "Anatomie einer Nachricht" und das "Vier-Ohren-Modell" des Empfängers erläutert werden. Diese Abschnitte bilden die Basis für das Verständnis der GfK.
3 Konflikte im schulischen, privaten und beruflichen Kontext: Dieses Kapitel definiert soziale Konflikte und differenziert zwischen verschiedenen Konfliktarten und -stilen. Es untersucht Konflikte in verschiedenen Beziehungsebenen und speziell im schulischen Kontext, wobei Disziplinkonflikte zwischen Lehrern und Schülern sowie lehrerverursachte Konflikte im Detail behandelt werden. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der verschiedenen Konflikttypen und deren Entstehung.
4 Die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. ROSENBERG: Dieses Kapitel präsentiert die Gewaltfreie Kommunikation (GfK) nach Rosenberg. Es beinhaltet die wissenschaftstheoretische Einordnung der GfK, deren Definition und die vier Komponenten. Der Begriff der Empathie und das Vier-Ohren-Modell werden ausführlich erklärt. Abschließend wird der Forschungsstand zur GfK zusammengefasst, um den theoretischen Rahmen für die empirische Untersuchung zu schaffen.
6 Forschungsmethodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es detailliert das Survey Design, den Ablauf und die Situationsanalyse des Schülertrainings, das Erhebungsverfahren (qualitativ und quantitativ) sowie die Datenaufbereitung und -analyse. Die gewählten Methoden werden begründet und ihre Eignung für die Forschungsfrage dargelegt.
Schlüsselwörter
Gewaltfreie Kommunikation (GfK), Marshall B. Rosenberg, Konfliktlösung, Schülertraining, qualitative Evaluation, Konfliktprävention, Schulkontext, Empathie, Mobbing, psychische Gewalt, qualitative Forschungsmethoden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Evaluation eines Schülertrainings zur Gewaltfreien Kommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit evaluiert ein Schülertraining zur Gewaltfreien Kommunikation (GfK) nach Marshall B. Rosenberg. Sie untersucht die Wirksamkeit des Trainings und die Anwendbarkeit der GfK im schulischen Kontext, analysiert die Schülererfahrungen und beleuchtet Herausforderungen bei der Umsetzung der GfK.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Gewaltfreie Kommunikation (GfK) nach Rosenberg, Konfliktlösung und -prävention im schulischen Umfeld, qualitative Forschungsmethoden und deren Anwendung, Herausforderungen bei der Implementierung der GfK und die Wirkung des Trainings auf die Schüler. Sie umfasst theoretische Grundlagen zu Gewalt, Kommunikation und Konflikten, die Methodik der empirischen Untersuchung und die Auswertung der Ergebnisse.
Welche Forschungsfragen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit des Schülertrainings zur GfK und die Anwendbarkeit der GfK im schulischen Kontext. Konkrete Fragestellungen werden im Kapitel 5 detailliert dargestellt, wobei induktive und deduktive Kategorienbildungen zur Analyse verwendet werden.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet qualitative und quantitative Forschungsmethoden. Das Kapitel 6 beschreibt detailliert das Survey Design, den Ablauf und die Situationsanalyse des Trainings, das Erhebungsverfahren (inklusive Feldzugang) und die Datenanalyse (qualitative und quantitative Analysetechniken).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Problemstellung, Grundverständnis von Gewalt und Kommunikation, Konflikte im schulischen, privaten und beruflichen Kontext, Die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, Forschungsmethodisches Vorgehen, Ergebnisteil, Kritische Betrachtung der GfK bzw. des Schülertrainings, Kritische Reflexion des eigenen Forschungsprozesses und Resümee und Handlungsempfehlungen. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis findet sich im Dokument.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Der Ergebnisteil (Kapitel 7) präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, gegliedert nach den Forschungsfragen. Es werden induktive und deduktive Kategorienbildungen verwendet zur Analyse der Daten.
Welche kritischen Aspekte werden behandelt?
Kapitel 8 und 9 befassen sich mit einer kritischen Betrachtung der GfK, des Schülertrainings und des eigenen Forschungsprozesses, beleuchten Grenzen der theoretischen Konzeption, der praktischen Umsetzung und des Trainings selbst.
Welche Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Kapitel 10 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt Handlungsempfehlungen basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gewaltfreie Kommunikation (GfK), Marshall B. Rosenberg, Konfliktlösung, Schülertraining, qualitative Evaluation, Konfliktprävention, Schulkontext, Empathie, Mobbing, psychische Gewalt, qualitative Forschungsmethoden.
- Quote paper
- Andreas Spannl (Author), 2015, Die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456840