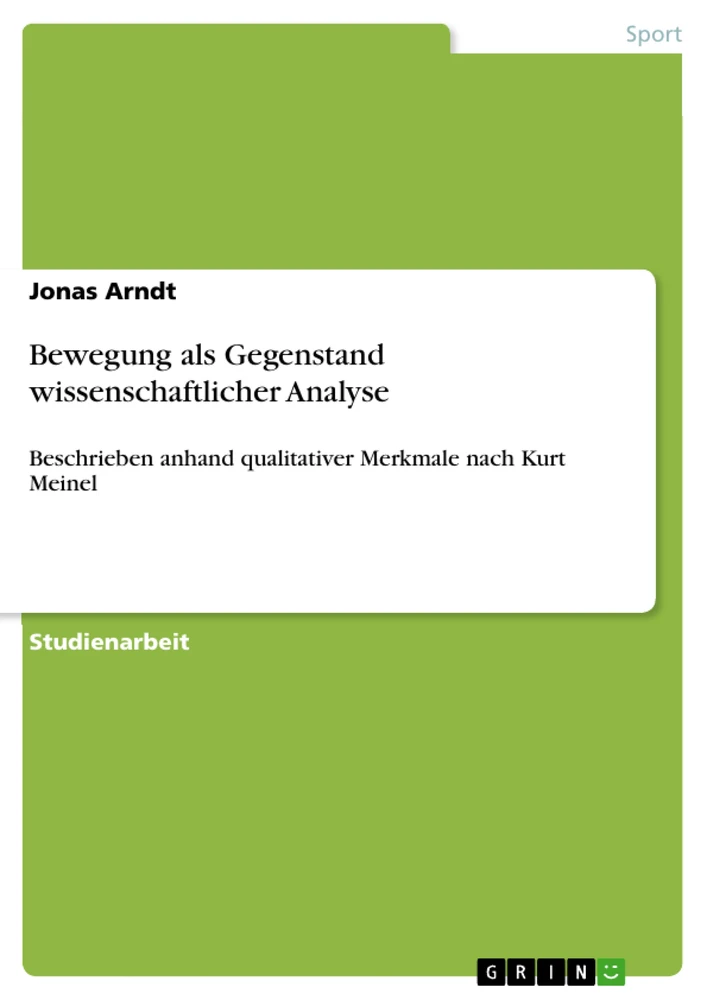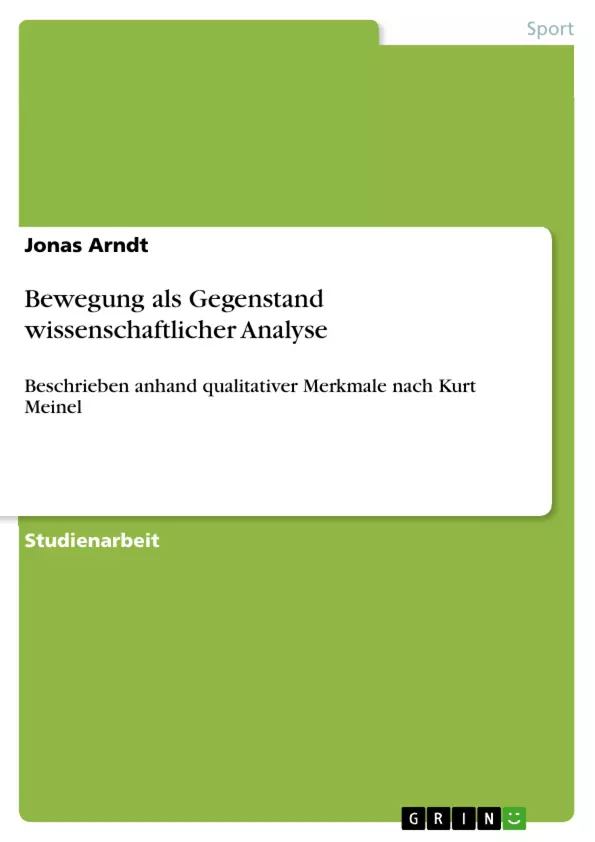In der vorliegenden Arbeit wird Bewegung anhand qualitativer Merkmale nach Kurt Meinel beschrieben, sowie eine Analyse einer Bewegungsaufgabe durchgeführt und ein Portrait eines Kindes erstellt.
In diesem Text geht es nicht darum die Begriffe „zu polarisieren oder das Eine gegen das Andere auszuspielen“. Vielmehr möchte er Denkanstöße in Form von „geeigneten Ausbildungsbereichen und stimmigen Anwendungsgebieten“ zur Lösungssuche geben. Der Begriff „Sport“ hat in den letzten Jahren unter Negativschlagzeilen gelitten. So werfen Doping, zunehmende Kommerzialisierung sowie Umweltzerstörung ihre dunklen Schatten auf den Sport. Darunter leidet nicht nur die Identifikation mit dem Sport, auch lässt sich so der Sport schwer mit dem pädagogischen Hintergrund einer Schule vereinbaren.
Balz beklagt, dass dem Sport die Abgrenzung und Überschaubarkeit verloren gegangen ist, da nach gängigen Definitionen auch Schach oder Saunieren dazu zurechnen wären. So sei der Sport, der im Ursprung nur eine Form der Bewegungskultur war, stark ausgeweitet und sogar widersprüchlich geworden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenstand des Studienfaches
- Argumente der Literatur von Eckart Balz (2000)
- Diskussionsverlauf
- Bewegung als Gegenstand wissenschaftlicher Analyse
- Beschreibung von Bewegung anhand qualitativer Merkmale nach Kurt Meinel
- Phasenstruktur
- Bewegungsrhythmus
- Bewegungskopplung
- Bewegungsfluss und Bewegungselastizität
- Bewegungspräzision
- Bewegungskonstanz
- Bewegungsumfang
- Bewegungstempo
- Bewegungsstärke
- Analyse einer Bewegungsaufgabe
- Portraitieren eines Kindes
- Beschreibung von Bewegung anhand qualitativer Merkmale nach Kurt Meinel
- Bewegungstheoretische Ansätze: physikalische und funktionelle Betrachtungsweise
- Dialogisches Bewegungskonzept als Grundlage des Lernens
- Lehrversuch: Gegenstände in der Luft halten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Seminar „Erziehen und bewegungspädagogisch Handeln“ zielt darauf ab, den Perspektivwechsel vom aktiven Sportler zum Sportlehrer zu ermöglichen und die Berufsorientierung in den Mittelpunkt zu stellen. Es untersucht die Beziehung zwischen Sportlehrer und Schüler und die Entwicklung bewegungsfördernder Diagnosen. Ein zentraler Punkt ist die Diskussion um den geeigneten Begriff zur Beschreibung des Studieninhalts: „Sport“ oder „Bewegung“.
- Der Vergleich der Begriffe „Sport“ und „Bewegung“ im Kontext der Sportpädagogik.
- Die Analyse von Bewegung anhand qualitativer Merkmale nach Kurt Meinel.
- Die Auseinandersetzung mit bewegungstheoretischen Ansätzen.
- Die Erörterung eines dialogischen Bewegungskonzepts als Grundlage des Lernens.
- Die kritische Betrachtung des modernen Sportunterrichts und seiner Ziele.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Seminar „Erziehen und bewegungspädagogisch Handeln“ ein und beschreibt dessen Zielsetzung: den Perspektivwechsel vom Sportler zum Sportlehrer zu vollziehen und die Bedeutung der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler im Hinblick auf bewegungsfördernde Diagnosen zu betonen. Die zentrale Frage nach der Fokussierung auf „Sport“ oder „Bewegung“ im Studium wird als Ausgangspunkt der weiteren Auseinandersetzung genannt.
2. Gegenstand des Studienfaches: Dieses Kapitel befasst sich mit der grundlegenden Frage, ob „Sport“ oder „Bewegung“ den Gegenstand des Studiums besser beschreibt. Ausgehend vom Wandel vom Turnunterricht zum Sportunterricht wird die aktuelle Debatte um Inhalte und Ziele des modernen Sportunterrichts diskutiert. Die Verwendung alternativer Begriffe wie „Sporterziehung“ oder „Bewegungserziehung“ wird in Betracht gezogen. Die Diskussion basiert auf einem Text von Eckart Balz, der im folgenden Unterkapitel detailliert behandelt wird.
2.1 Argumente der Literatur von Eckart Balz (2000): Dieser Abschnitt analysiert Eckart Balz' Aufsatz „Sport oder Bewegung – eine Frage der Etikettierung?“. Balz untersucht die Vor- und Nachteile der Begriffe „Sport“ und „Bewegung“ im Kontext der Sportpädagogik. Er kritisiert die zunehmende Kommerzialisierung und den Leistungsdruck im Sport, welche die pädagogische Einbindung erschweren. Demgegenüber stellt er den umfassenderen und offeneren Begriff „Bewegung“ dar, der jedoch auch die Gefahr der Beliebigkeit in sich birgt. Balz plädiert für eine Bewegungspädagogische Erweiterung der Sportlehrerausbildung, die Sportarten durch Bewegungsfelder ersetzt.
2.2 Diskussionsverlauf: Dieses Kapitel dokumentiert die Seminar-Diskussion zum Thema „Sport oder Bewegung?“. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen („Pro Sport“ und „Pro Bewegung“) eingeteilt, um Argumente für ihre jeweilige Position zu sammeln und zu diskutieren. Die „Pro Sport“-Gruppe betonte die Möglichkeiten zur individuellen Fähigkeitsentwicklung, den sozialen Aspekt und die mediale Attraktivität des Sports. Die „Pro Bewegung“-Gruppe verwies auf die umfassendere Natur des Begriffs „Bewegung“ und die Möglichkeit, sich von den negativen Aspekten des Leistungssports zu distanzieren. Die Diskussion zeigte die Komplexität der Thematik und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung.
3. Bewegung als Gegenstand wissenschaftlicher Analyse: Dieser Abschnitt widmet sich der wissenschaftlichen Analyse von Bewegung. Es werden qualitative Merkmale nach Kurt Meinel, wie Phasenstruktur, Bewegungsrhythmus, Bewegungskopplung, Bewegungsfluss, Bewegungspräzision, Bewegungskonstanz, Bewegungsumfang, Bewegungstempo und Bewegungsstärke, vorgestellt und deren Bedeutung im Kontext der Bewegungsanalyse erläutert. Die Kapitel behandeln weiter die Analyse einer konkreten Bewegungsaufgabe und das Portraitieren eines Kindes, um die praktische Anwendung der theoretischen Konzepte zu veranschaulichen.
4. Bewegungstheoretische Ansätze: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen theoretischen Ansätzen zur Betrachtung von Bewegung, insbesondere mit physikalischen und funktionellen Perspektiven. Es wird eine detaillierte Auseinandersetzung mit den verschiedenen theoretischen Modellen und ihren jeweiligen Stärken und Schwächen erwartet. Die Verknüpfung dieser Ansätze mit den vorhergehenden Kapiteln wird eine zentrale Rolle spielen.
5. Dialogisches Bewegungskonzept als Grundlage des Lernens: Dieses Kapitel präsentiert ein dialogisches Bewegungskonzept als Grundlage des Lernprozesses. Der Lehrversuch „Gegenstände in der Luft halten“ dient als Beispiel, um die praktische Umsetzung des Konzepts zu illustrieren und seine Effektivität zu demonstrieren. Die Bedeutung des Dialogs und der Interaktion zwischen Lehrer und Schüler wird im Detail erläutert.
Schlüsselwörter
Sport, Bewegung, Sportpädagogik, Bewegungserziehung, Sporterziehung, Bewegungsanalyse, Kurt Meinel, Eckart Balz, Leistungssport, Bewegungsfelder, dialogisches Bewegungskonzept, Lehrversuch, qualitative Bewegungsmerkmale.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Erziehen und bewegungspädagogisch Handeln
Was ist der Gegenstand dieses Seminars?
Das Seminar „Erziehen und bewegungspädagogisch Handeln“ zielt auf einen Perspektivwechsel vom aktiven Sportler zum Sportlehrer ab und fokussiert die Berufsorientierung. Es untersucht die Lehrer-Schüler-Beziehung und die Entwicklung bewegungsfördernder Diagnosen. Eine zentrale Frage ist die Diskussion um den geeigneten Begriff zur Beschreibung des Studieninhalts: „Sport“ oder „Bewegung“.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themen sind: der Vergleich der Begriffe „Sport“ und „Bewegung“, die Analyse von Bewegung anhand qualitativer Merkmale nach Kurt Meinel, die Auseinandersetzung mit bewegungstheoretischen Ansätzen, die Erörterung eines dialogischen Bewegungskonzepts und die kritische Betrachtung des modernen Sportunterrichts.
Welche Kapitel umfasst das Seminar und worum geht es in jedem Kapitel?
Das Seminar gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Einführung in das Seminar und die zentrale Frage nach "Sport" oder "Bewegung"); Gegenstand des Studienfaches (Diskussion um den Begriff "Sport" vs. "Bewegung" anhand von Eckart Balz' Argumenten); Bewegung als Gegenstand wissenschaftlicher Analyse (qualitative Bewegungsmerkmale nach Kurt Meinel und deren Anwendung); Bewegungstheoretische Ansätze (physikalische und funktionelle Betrachtungsweisen); Dialogisches Bewegungskonzept als Grundlage des Lernens (praktische Umsetzung eines dialogischen Konzepts).
Welche Argumente von Eckart Balz werden diskutiert?
Eckart Balz' Aufsatz „Sport oder Bewegung – eine Frage der Etikettierung?“ wird analysiert. Balz kritisiert die Kommerzialisierung und den Leistungsdruck im Sport und plädiert für den umfassenderen Begriff „Bewegung“, der aber auch die Gefahr der Beliebigkeit birgt. Er schlägt eine Bewegungspädagogische Erweiterung der Sportlehrerausbildung vor.
Wie wird Bewegung wissenschaftlich analysiert?
Die wissenschaftliche Analyse von Bewegung erfolgt anhand qualitativer Merkmale nach Kurt Meinel: Phasenstruktur, Bewegungsrhythmus, Bewegungskopplung, Bewegungsfluss, Bewegungspräzision, Bewegungskonstanz, Bewegungsumfang, Bewegungstempo und Bewegungsstärke. Die Analyse einer konkreten Bewegungsaufgabe und die Portraitierung eines Kindes veranschaulichen die praktische Anwendung.
Was ist ein dialogisches Bewegungskonzept und wie wird es im Seminar behandelt?
Das Seminar präsentiert ein dialogisches Bewegungskonzept als Grundlage des Lernens. Der Lehrversuch „Gegenstände in der Luft halten“ dient als Beispiel für die praktische Umsetzung und die Bedeutung des Dialogs und der Interaktion zwischen Lehrer und Schüler wird detailliert erläutert.
Welche Schlüsselwörter sind für dieses Seminar relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Sport, Bewegung, Sportpädagogik, Bewegungserziehung, Sporterziehung, Bewegungsanalyse, Kurt Meinel, Eckart Balz, Leistungssport, Bewegungsfelder, dialogisches Bewegungskonzept, Lehrversuch, qualitative Bewegungsmerkmale.
- Quote paper
- Jonas Arndt (Author), 2010, Bewegung als Gegenstand wissenschaftlicher Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456733