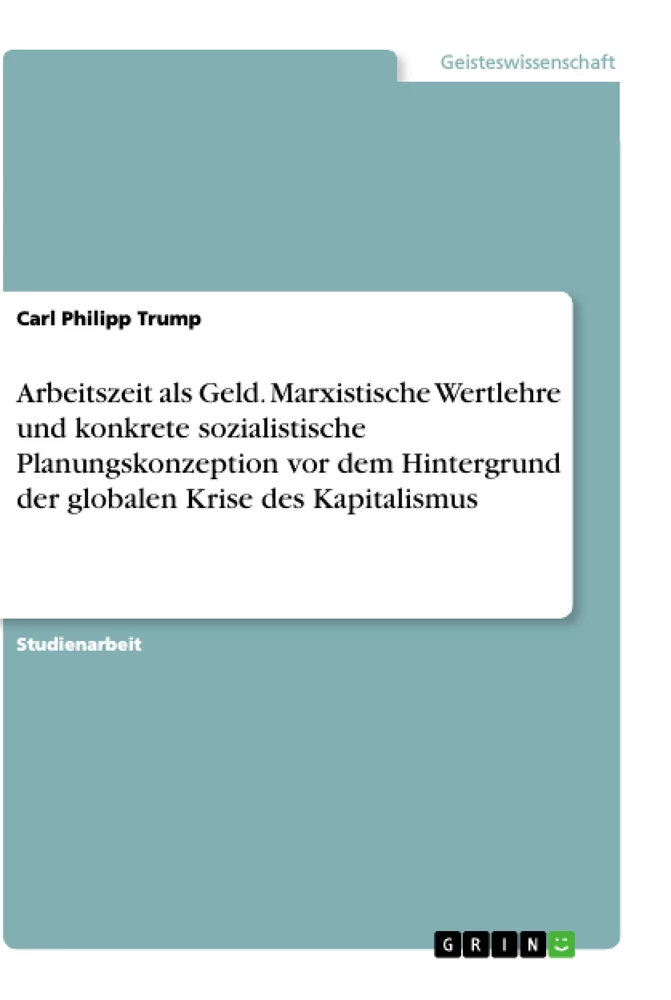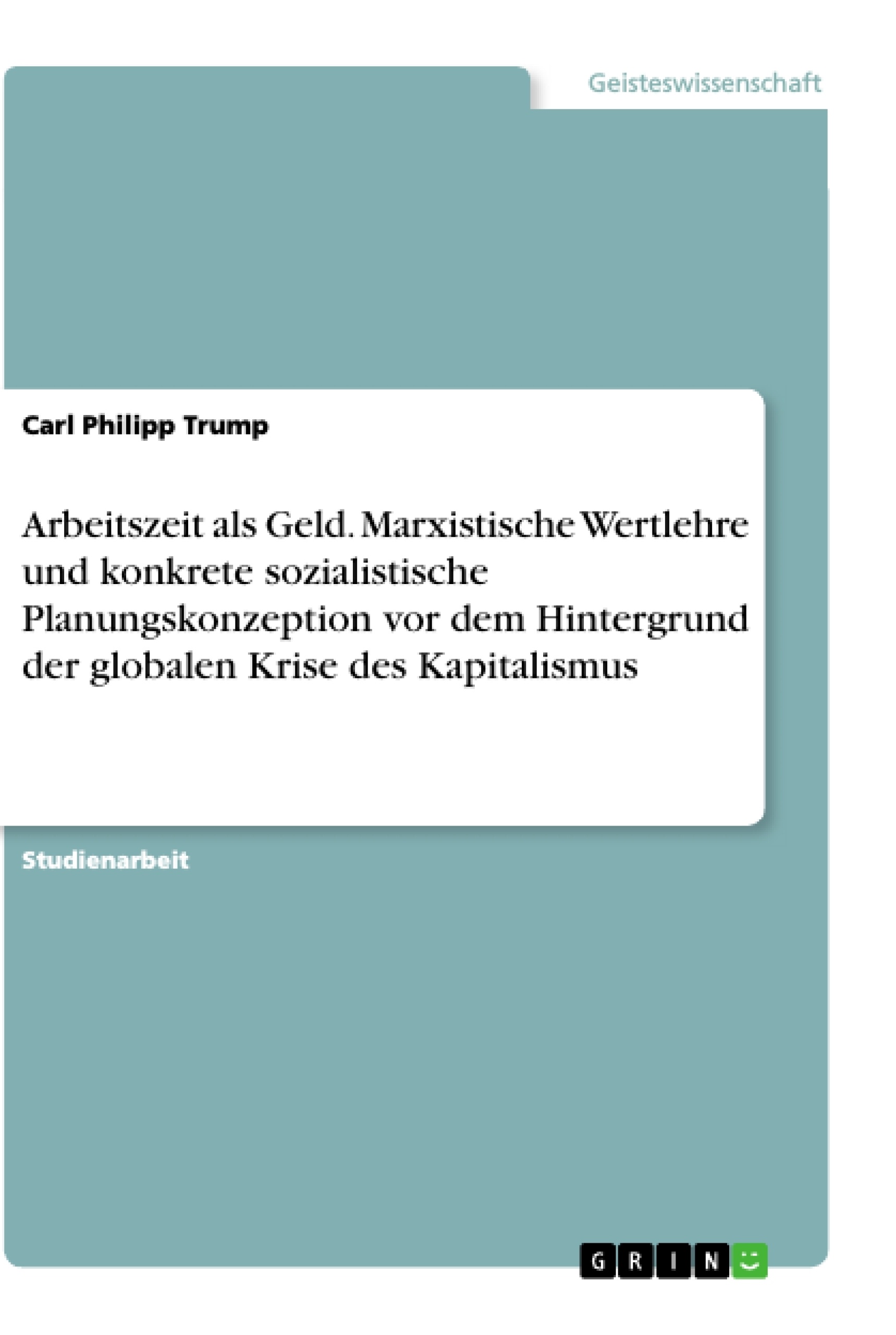In der Arbeit wird der Themenkomplex Arbeitszeit als Geld auf seine theoretischen Grundlagen, die praktische Umsetzung sowie die Frage der Aktualität hin untersucht. Vor dem Hintergrund der „schwerste[n] Krise [des Kapitalismus] seit dem Zweiten Weltkrieg“ – wie der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank Jean-Claude Trichet die aktuelle Lage einschätzt – erhält der Themengegenstand seine Relevanz. So wird in einer Zeit der expansiven Geldpolitik der westlichen Zentralbanken um sogenannte „Finanzpakte“ zur Rettung des Kapitalismus bereitzustellen, eine inflationäre Phase der Fiat-Währungen wahrscheinlicher.
In der Folge ist der gesellschaftliche Mechanismus Geld auf Grundlage einer Arbeitszeit-Ökonomie als eine mögliche Alternative soziologisch zu reflektieren. Hierfür sollen im zweiten Teil zunächst die marxistischen Grundlagen des Phänomens Arbeitszeit als Geld dargelegt und der Unterschied zur vorherrschenden Volkswirtschaftslehre deutlich gemacht werden. Im dritten Teil soll dann eine konkrete Planungskonzeption für Arbeitszeit als Geld von Cockshott und Cottrell vorgestellt werden, die als Grundlagenliteratur eines modernen Sozialismus rezipiert wird. Abschließend soll dann im vierten Teil ein Ausblick gewagt werden bezüglich der tatsächlichen historischen Chancen von Geld als Arbeitszeit.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen für Arbeitszeit als Geld
2.1 Erkenntnisinteresse: Historischer Materialismus und Idealismus
2.2 Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen
2.3 Wert des Arbeitsprodukts: Gebrauchs- und Tauschwert
2.4 Objektive und subjektive Wertlehre
3. Modernes Planungskonzept basierend auf Arbeitszeit
3.1 Sozialistische Ausrichtung: Abgrenzung von Sozialdemokratie, Tauschbanken und Tauschringen
3.2 Ausbeutung und ökonomische Benachteiligung im Kapitalismus
3.3 Grundlegende Prinzipien der Planungskonzeption
3.4 Gleichheit der Menschen, Ungleichheit der Arbeitsfähigkeit
3.4.1 Qualifizierte und unqualifizierte Arbeit
3.4.2 Unterschiedliche Produktivität der Arbeit
3.4.3 Prognostizierter technischer Entwicklungsschub
3.5 Konkrete Planung der Zeitökonomie
3.5.1 Input-Output-Berechnungen
3.5.2 Intelligente Planung statt Trial-and-Error
3.5.3 Planungsphasen und direkte Demokratie
4. Zur Aktualität von Arbeitszeit als Geld – ein Ausblick
5. Literaturverzeichnis
5.1 Verwendete Internetquellen
1.Einleitung
In der Arbeit wird der Themenkomplex Arbeitszeit als Geld auf seine theoretischen Grundlagen, die praktische Umsetzung sowie die Frage der Aktualität hin untersucht. Vor dem Hintergrund der „schwerste[n] Krise [des Kapitalismus] seit dem Zweiten Weltkrieg“ – wie der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank Jean- Claude Trichet die aktuelle Lage einschätzt – erhält der Themengegenstand seine Relevanz.1 So wird in einer Zeit der expansiven Geldpolitik der westlichen Zentral- banken um sogenannte „Finanzpakte“ zur Rettung des Kapitalismus bereitzustellen, eine inflationäre Phase der Fiat-Währungen wahrscheinlicher. In der Folge ist der gesellschaftliche Mechanismus Geld auf Grundlage einer Arbeitszeit-Ökonomie alseine mögliche Alternative soziologisch zu reflektieren. Hierfür sollen im zweiten Teil zunächst die marxistischen Grundlagen des Phänomens Arbeitszeit als Geld darge- legt und der Unterschied zur vorherrschenden Volkswirtschaftslehre deutlich ge- macht werden. Im dritten Teil soll dann eine konkrete Planungskonzeption für Ar- beitszeit als Geld von Cockshott und Cottrell vorgestellt werden, die als Grundlagenli-teratur eines modernen Sozialismus rezipiert wird.2 Abschließend soll dann im vier-ten Teil ein Ausblick gewagt werden bezüglich der tatsächlichen historischen Chan- cen von Geld als Arbeitszeit.
2. Theoretische Grundlagen für Arbeitszeit als Geld
2.1 Erkenntnisinteresse: Historischer Materialismus und Idealismus
Der historischer Materialismus und der Idealismus stehen einander als Erklärungs- modelle für gesellschaftliche Entwicklung fundamental gegenüber. Während der Idealismus Ideale und Ideen als entscheidende Ursachen für sozialen Wandel ansieht, begreift der historische Materialismus die konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse als Triebkraft für geschichtliche Entwicklung.3 Ideale können die Welt verändern, aber sie sind dabei eingebettet in einen geschichtlichen Kontext. Der Idealismus fo- kussiert sich folglich einseitig auf den Geist, ohne zu reflektieren, dass bevor sich ein Geist entwickelt, eine Sozialisation in einem bestimmten Rahmen stattfindet. Es gilt der berühmte Satz von Karl Marx:
„ E s ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“ 4
Vor Idealen und Ideen stehen also zunächst die konkreten gesellschaftlichen Um- stände:
„ Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorhan- denen, gegebenen und überlieferten Umständen.“5
Das Erkenntnisinteresse des historischen Materialismus besteht deshalb darin, die entscheidenden sozialen Mechanismen herauszuarbeiten, die zu diesen „gegebenen und überlieferten Umständen“ geführt haben. Es geht also nicht nur darum, zu ermit- teln, welche Sinnstrukturen und Konzepte der Realitätswahrnehmung die Menschen entwickelten, sondern darum, in welchen Umständen sie konkret gelebt und vor al- lem gearbeitet haben. Denn „die Grundlage jeder menschlichen Gesellschaft ist der Arbeitsprozess, die Zusammenarbeit von Menschen mit dem Ziel, die Naturkräfte zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu nutzen.“6 Der historische Materialismus beschäftigt sich folglich intensiv mit der Analyse der Arbeit. Wie der Arbeitsprozess konkret ab- läuft, hat dabei weitreichende Konsequenzen für die Lebensgestaltung der Bevölke- rung.
2.2 Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen
Marx beschreibt den Arbeitsprozess als Resultat der ständigen Dialektik – also dem prozesshaften Wechselwirkungsverhältnis – von Produktivkräften und Produktions- verhältnissen. Die Produktivkräfte stellen dabei den technischen Entwicklungsstand einer Gesellschaft dar – etwa in Form von Arbeitskräften, Arbeitsmitteln sowie auch verwertbarem technischen Wissen.7 Dem gegenüber stehen die Produktionsverhält- nisse mit der Frage nach Eigentumsverteilung und Teilhabeansprüchen der einzel-nen Gesellschaftsmitglieder. Konkret geht es also beispielsweise um den Privatbesitz an Produktionsmitteln. Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse stehen dabei in einem ständigen Wechselwirkungsverhältnis zueinander. In dem Maße, in dem sich die Technik entwickelt, werden tradierte Eigentumsverhältnisse in Frage gestellt. Ak- tuell ist beispielsweise auf die enorme technische Entwicklung des Internets hinzu- weisen, die massiv Eigentumsansprüche ganzer Industrien – etwa der Software- und Unterhaltungsindustrien in Form von Filesharing – untergräbt. Der Arbeitsprozess als Resultat dieses ständigen Wechselwirkungsverhältnisses steht also im Zentrum der marxistischen Gesellschaftsanalyse.
2.3 Wert des Arbeitsprodukts: Gebrauchs- und Tauschwert
Unterschieden wird das Arbeitsprodukt, also das Erzeugnis der Arbeit, zum einen in seinen konkreten Gebrauchswert und zum anderen in seinen allgemeinen Tausch- wert. Der Gebrauchswert verkörpert den Nutzen eines Produktes: Bei einem Stück Brot also beispielsweise die Sättigung durch den Verzehr. Gleichzeitig hat aber jedes Gut neben dem Gebrauchswert auch einen Tauschwert, wenn es als Ware auf dem Markt verkauft wird. Der Nutzen von Waren kann dabei sehr unterschiedlich sein und trotzdem kann es zu einem Tausch beispielsweise zwischen Brot und Hammerkommen – entweder unmittelbar oder über das Zwischenglied Geld.8 Als Grund dafür erkennt Marx, dass jede Ware einen ihr eigenen Wert hat, von dem der Tauschwert eine „bloße Widerspiegelung“ ist.9 Zwei so unterschiedliche Güter wie Brot und Hammer teilen folglich, dass sie beide Resultat menschlicher Arbeit sind. Der Ge- brauchswert entspringt dabei der „konkreten Arbeit“, also etwa dem Backen des Bro- tes, während die „abstrakte Arbeit“ den eigentlichen Wert eines Produktes in Form der dafür aufgewendeten Arbeitszeit ausdrückt.10 Diesen Zustand von zwei unter- schiedlichen Werten, die gleichzeitig in einem einzigen Produkt verkörpert sind, be- zeichnet Marx als „Doppelcharakter der Arbeit“.11 Arbeit selbst unterliegt der Konkur- renz aller gesellschaftlichen Produzenten untereinander. Auf dem Markt können langfristig also nur diejenigen Akteure bestehen, die dem Stand der Produktivkräfte entsprechen, weil sie billiger produzieren können als ihre Konkurrenten. Konkret geht es also bei der Bestimmung des Wertes nicht um irgendeine Arbeitszeit, etwa eines besonders langsamen Arbeiters, sondern um die „gesellschaftlich notwendige Ar- beitszeit“ im Rahmen der Produktivkraftentwicklung.12 Insofern kann für jedes Pro- dukt ein „objektiver“ Preis entsprechend der zur Herstellung notwendigen menschli- chen Arbeitszeit ermittelt werden.
2.4 Objektive und subjektive Wertlehre
Die neoklassische Ökonomie, die heute zusammen mit der aus ihr hervorgegangen„neoliberalen Schule […] die herrschende Wirtschaftstheorie“ verkörpert, hat diese marxistische Analyse von Arbeit und Wert schrittweise verdrängt.13 So wurde „die‚ objektive ‘ Wertlehre – nämlich den Preis nach den Gestehungskosten zu berechnen– […] durch die ‚ subjektive ‘ Wertlehre ersetzt“:14 Anstatt also den eigentlichen Her- stellungswert eines Gutes zu ermitteln, wird nur noch auf die individuelle „Bereit- schaft“ eines Konsumenten geachtet, ein Produkt zu einem bestimmten Preis zu kau- fen. Dahinter steht die Kritik an der objektiven Wertlehre, wonach Güter je nach Ort und nachfragender Person unterschiedlichen Nutzen erfüllen und insofern Menschen bereit sind, unterschiedliche Preise für das gleiche Produkt zu bezahlen – es also keinen „objektiven“ Wert geben kann. Der Preis von Arbeitskräften und Waren soll somit allein durch Angebot und Nachfrage auf Märkten bestimmt werden. In der Fol- ge wurden Forderungen nach einem wirklich „gerechten“ Wert etwa für die Entloh- nung von Arbeit als überholt und unwissenschaftlich dargestellt und konnten so an den Rand gedrängt werden. Ein Wirtschaftskonzept, das zurückgeht auf die ur- sprünglich objektive marxistische Wertlehre, soll dementgegen im Folgenden darge- stellt werden.
3. Modernes Planungskonzept basierend auf Arbeitszeit
1993, zwei Jahre nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus der Sowjetära, stellten zwei schottische Professoren, der Informatiker Paul Cockshott und der Ökonom Allin Cottrell, mit Ihrem Werk „Towards a New Socialism“, ein com- puterunterstütztes modernes Planungskonzept vor, das auf der marxistischen Ar-beitswerttheorie basiert.15 Ausgehend von ihrer wissenschaftlichen Aufarbeitung der Planungsmöglichkeiten des gesellschaftlichen Faktors Arbeitszeit, vertreten die Auto- ren die These, dass „eine effektive und produktive sozialistische Ökonomie sowohl möglich als auch dem Kapitalismus vorzuziehen ist (zumindest vom Standpunkt der arbeitenden Mehrheit aus gesehen)“.16
3.1 Sozialistische Ausrichtung: Abgrenzung von Sozialdemokratie, Tauschbanken und Tauschringen
Cockshott und Cottrell wenden sich mit ihrer Arbeit gegen die vermeintliche Alterna- tivlosigkeit des Neoliberalismus und der Theorie des freien Marktes. Statt weiterhin auf den Markt als gesellschaftlichen Koordinationsmechanismus zu vertrauen, beto- nen sie, dass Märkte „nicht der einzige Weg [sind], um komplexe Wirtschaften zu führen“.17 Vielmehr verweisen die Autoren auf strukturelle Schwächen der kapitalisti- schen Produktionsweise und stellen im Rahmen der existierenden technischen Mög-lichkeiten eine alternative Produktionsweise vor. Demnach tendiere der Kapitalismus als Wirtschaftssystem aufgrund des Privateigentums an Produktionsmitteln zwingend dazu „krasse Ungleichheiten im Einkommen, Wohlstand und in den Lebensperspek- tiven“ zu erzeugen.18 Gerade wegen dieser systemischen Pfadabhängigkeit, könne auch eine stärkere Regulierung der Marktkräfte – wie es die Sozialdemokratie mit ihrer „sozialen Marktwirtschaft“ beabsichtigt – die Tendenzen der Kapitalakkumulati- on nur verlangsamen, langfristig aber nicht aufhalten. Deshalb bezeichnen die Auto- ren die Sozialdemokratie als „unzureichend“ um dauerhaft Wohlstand für die Mehr- heit der Bevölkerung zu gewährleisten und befürworten daher in sozialistischer Tradi- tion die Überwindung des Kapitalismus.19 Anders als „idealistische Marxisten“, denen sie vorwerfen, „den Bezug zur historischen Realität“ verloren zu haben, setzen sich die Autoren auch bewusst mit dem Scheitern des real existierenden Sowjetsozialis- mus auseinander.20 Sie identifizieren dabei zwei Hauptgründe für das Scheitern: Auf der einen Seite die „undemokratischen und autoritären Praktiken der Sowjetpolitik“ und auf der anderen Seite das Festhalten an ineffizienten ökonomischen Mechanis-men aus den 1930er Jahren, was zu „einem stagnierenden Lebensstandard und zu chronischer Konsumgüterknappheit“ geführt hat.21 Ausgehend von diesen Ursachen wird von den Autoren „radikale Demokratie und eine effiziente Planung“ des gesell- schaftlichen Faktors Arbeitszeit mit Hilfe moderner Informationstechnologie vorge- schlagen.22 Statt also den Versuch zu unternehmen, die negativen Auswirkungen einer kapitalistischen Produktionsweise nur abzumildern, verfolgen Cockshott und Cottrell einen explizit sozialistischen Ansatz, bei dem die Produktionsmittel der de- mokratischen Kontrolle der Bevölkerung unterstellt werden sollen. Damit unterschei- det sich ihr Ansatz von sogenannten Tauschbanken, die mit ihrer geldlosen Ausrich- tung als historische Vorläufer komplexerer alternativer Produktionsweisen angese- hen werden können – wie sie beispielsweise der Anarchist Pierre-Joseph Proudhon 1849 gegründet hat. 23 Die Konstruktion der Tauschbanken wendet sich jedoch „nicht prinzipiell gegen das Privateigentum“ an Produktionsmitteln, sondern sieht vor, dass nur die Erzeugnisse eigener Arbeit, die durch „direkten Austausch zwischen den Produzenten“ entstehen, legitim sind.24 In arbeitsteiligen modernen Gesellschaften kann ein derartiger direkter Austausch von Produzenten allerdings gesamtgesell- schaftlich nicht mehr realisiert werden und würde sich auf Rand-Phänomene wie Nachbarschaftshilfe begrenzen. Ebenso widersprechen Tauschringe der Konzeption der Autoren. Denn Tauschringe prägen sich in der Regel problemlos innerhalb einer kapitalistischen Produktionsweise aus. Sie stellen also eher wie schon die Tausch- banken eine „Ergänzung“ zum klassischen Marktgeschehen im Sinne einer „kom-pensatorischen ‚Nebenökonomie‘ im haushaltsnahen Wohnumfeld“ dar und streben eben keine explizite Demokratisierung der Produktionsmittel insgesamt an.25 Cocks- hott und Cottrell argumentieren dabei, dass durch die von ihnen vorgeschlagene computerunterstützte Demokratisierung der Produktionsmittel „eine effiziente, huma- ne und zutiefst auf Gleichheit aufgebaute Gesellschaft möglich“ wird.26
3.2 Ausbeutung und ökonomische Benachteiligung im Kapitalismus
Ausgehend vom marxistischen Ausbeutungsbegriff definieren die Autoren Ausbeu- tung etwa einer Arbeiterin als gegeben, wenn „ihr Lohn weniger wert ist als das von ihr hergestellte Produkt“.27 Keine Ausbeutung liegt demnach vor, wenn ein Arbeiter, der 40 Stunden arbeitet auch Güter und Dienstleistungen erhält, die für ihre Herstel- lung ebenfalls 40 Stunden erfordern. 28 Im Kapitalismus findet entsprechend grund- sätzlich Ausbeutung der Arbeitskräfte statt, da sonst kein Profit für den Unternehmer anfallen würde. Um das Ausmaß der Ausbeutung konkret zu fassen, berechnen die Autoren die Ausbeutungsrate der Arbeitskräfte nach Zahlen der britischen volkswirt- schaftlichen Gesamtrechnung von1997. Von einem Wachstum von 640.596 Mio. Pfund wurden nur 324.324 Mio. Pfund durch Löhne ausgezahlt – demnach betrug die Ausbeutungsrate von den abhängig Beschäftigten in England aus gesehen knapp 98%.29 Konkret arbeiteten die Arbeiter etwas über 30 Minuten jeder Stunde um ihren Lohn zu erwirtschaften, die restlichen gut 29 Minuten arbeiteten sie umsonst, indem sie Werte für die Unternehmer, Banken und den Staat schufen.30 Ferner betonen die Autoren aufgrund offizieller staatlicher Zahlen von 1975, dass in England „ungefähr 330.000 Personen 55% aller Aktien und 58% allen Bodens besitzen“.31 Zudem wird deutlich auf die nicht im BIP erfasste Ausbeutung im Hauswirtschaftssektor verwie- sen – etwa in Form von unbezahlter Hausarbeit und Kinderbetreuung, die vor allem Frauen betrifft. Demnach wird gerade diese „besondere Form der Ausbeutung […] hochgradig mystifiziert“, da sie in „Ideologien von sexueller und Mutterliebe verhüllt“ ist und so Leute dazu neigen, „sie zu übersehen“.32
3.3 Grundlegende Prinzipien der Planungskonzeption
Um gesellschaftliche Ausbeutung zu beseitigen und soziale Ungleichheiten zu mini- mieren, baut das Planungskonzept von Cockshott und Cottrell auf zwei wesentlichen Prinzipien auf: Erstens soll arbeitenden Menschen, die „volle Verfügung über den Ertrag ihrer Arbeit“ zuteilwerden – der Lohn muss also dem entsprechen, was “sie im Laufe eines Arbeitstages in Form von Zeit und Anstrengung“ geleistet haben – und zweitens wird nur Arbeit als „legitime Quelle von Einkommen“ angesehen.33 Folglich sind „alle Einkommensquellen wie Rente, Dividende und Zinsen“, „die vom Besitz an Vermögen herrühren und nicht von persönlichen Anstrengungen ihrer Empfänger“, ausgeschlossen.34 Konkret basiert das monetäre System somit auf „Zeit statt auf willkürlichen und bedeutungslosen Währungseinheiten […] wie Pfund, Dollar“ oder auch Euro.35 Um es mit den Worten von Adam Smith auszudrücken: Bei der Zeit handelt es sich um die „eigentliche Währung“.36 Denn der „Reichtum [der Menschen] hängt davon ab, wie viel Zeit ihres Lebens sie aufwenden müssen, um die Sachen herzustellen, die sie begehren oder benötigen“37. Im konkreten Verfahren erhalten die Menschen also keine Geldeinheiten mehr, sondern nicht übertragbare Arbeits- gutscheine entsprechend ihrer geleisteten Arbeitszeit. Die Arbeitsgutscheine können dann wiederum in Güter und Dienstleistungen mit dem entsprechenden Zeitwert ein-getauscht werden. Statt Arbeitsgutscheinen sind heute etwa auch Chip- oder moder- ne berührungslose RFID-Karten vorstellbar. Durch die Währung Arbeitszeit halten die Autoren es für möglich, dass „ökonomische Ungleichheiten auf einen Bruchteil der heutigen reduziert werden, auch wenn einige durch Unterschiede in Fähigkeit und Ausbildung bedingte, bleiben werden.“38 Die Autoren verfolgen insofern keinen„naiven“ Sozialismus bei dem alle Menschen genau die gleichen Ressourcen haben sollen, sondern lassen ab einer Grundsicherung auch soziale Ungleichheiten zu. Entscheidend ist jedoch, dass die Ungleichheiten dabei durch individuell mehr geleis- tete Arbeitszeit und nicht durch Erträge aus Produktionsmittelbesitz – also durch die Ausbeutung der Arbeit anderer Menschen – entsteht.
3.4 Gleichheit der Menschen, Ungleichheit der Arbeitsfähigkeit
Das Planungskonzept basiert auf der „demokratischen Annahme, dass die Men- schen gleich sind und dementsprechend ihre Arbeit auch als gleich angesehen wer-den sollte“.39 Neben dieser philosophischen Grundannahme, sehen die Autoren in der Praxis aber „tatsächliche Unterschiede in der Arbeitsfähigkeit der Menschen“.40 Daraus ergeben sich zwei grundsätzliche Fragestellungen: Erstens, ob Menschen mit besseren Kenntnissen oder Fähigkeiten besser bezahlt werden sollen und zwei- tens, ob „bei aller Philosophie von der Gleichheit der Menschen, jede sozialistische Ökonomie aus Planungsgründen gezwungen ist, die Verschiedenheit von Arbeit an- zuerkennen“.41
3.4.1 Qualifizierte und unqualifizierte Arbeit
Im Kapitalismus werden höher qualifizierte Menschen in der Regel besser bezahlt als weniger qualifizierte. Das Hauptargument dafür liegt in der Kompensation für den erlittenen Verdienstausfall und die angefallenen Ausbildungskosten. Die höhere Be- zahlung erfolgt also im Kapitalismus, um sicher zu gehen, dass genügend Menschen das „Opfer“ bringen, sich ausbilden zu lassen. Im sozialistischen Planungsmodell der Autoren wird ein anderer Ansatz verfolgt: Sie gehen davon aus, dass in einer moder- nen arbeitsteiligen Gesellschaft Ausbildung „eine wertvolle und gesellschaftlich not- wendige Form der Arbeit“ darstellt, weil dabei qualifizierte Arbeitskräfte als Output fürden Arbeitsprozess entstehen.42 Folglich betrachten sie die Arbeitszeit einer Ausbil-dungsmaßnahme analog zu jeder anderen geleisteten Arbeitszeit. Über allgemeine Steuern auf Arbeitszeit kann die Ausbildung in der Folge nicht nur kostenfrei zur Ver- fügung gestellt werden, sondern der Auszubildende wird dafür sogar entsprechend bezahlt. Insofern ist das Kompensations-Argument für Ausfälle nicht mehr gegeben und so wird jede Arbeitszeit sowohl von qualifizierten als auch von unqualifizierten Arbeitern gleich entlohnt. Maßgeblich für Entlohnung ist nicht mehr das Ausbildungs- niveau, sondern in sozial abgesicherten Maßen die individuelle Produktivität. Die Au- toren prognostizieren, dass diese „Nivellierung der Bezahlung […] zu einer Revoluti-on des Selbstwertgefühls führen“ wird.43
3.4.2 Unterschiedliche Produktivität der Arbeit
Wenn nun jede Arbeitsstunde unabhängig vom Output exakt gleich bewertet würde, bestünde die Möglichkeit, dass Menschen absichtlich langsam arbeiten. Deshalb muss die Arbeitszeit entsprechend der Produktivität kategorisiert werden, um Anreize richtig zu setzen. Die Autoren schlagen drei Kategorien vor, A, B und C, wobei B die durchschnittliche Produktivität bedeutet, A über dem Durchschnitt und C unter dem Durchschnitt.44 Entsprechend würden ausschließlich Arbeiter der Kategorie B eine Stunde Arbeitszeit pro geleisteter Stunde erhalten, A-Arbeiter etwas mehr und C- Arbeiter etwas weniger. Die Bezahlung muss dabei in solchen Proportionen festge- legt werden, dass die Gesamtsumme der Arbeitsgutscheine der Gesamtsumme geleisteten Arbeitsstunden entspricht. Dabei soll die Auswertung automatisch per Computer erfolgen, so dass die Anzahl der Personen in jeder Kategorie bekannt sind. Gleichzeitig „darf keine Stigmatisierung damit verbunden sein, ein ‚C‘-Arbeiter zu sein, ein solcher Arbeiter hat sich entschieden, einen ruhigeren Schritt einzu- schlagen – und akzeptiert dementsprechend ein niedrigeres Konsumniveau“.45 In der heutigen Praxis ist durchaus auch eine über die genannten drei Kategorien hinaus- gehende Differenzierung von Arbeitsproduktivität vorstellbar. Die vom Computer er- fassten Produktions-Daten sollen weitergeleitet werden an ein zentrales Datenbank- system. Für Planungszwecke können Arbeiter dann über die Datenbank entspre-chend ihrer jeweiligen Berufe und Produktivitäts-Kategorisierung koordiniert werden. Gesellschaftliche Planungsprojekte können entsprechend der Dringlichkeit unter- schiedlichen Kategorien zugeteilt werden. Über die Datenbank-Erfassung der Ar- beitszeit und der Berufsqualifikationen können ferner auch Engpässe gewisser Aus- bildungsbereiche ermittelt werden, so dass frühzeitig gegengesteuert werden kann. Dabei gehen die Autoren davon aus, dass „außer einigen besonders anspruchsvol- len Aufgaben und einigen eingeschränkten Individuen, fast jeder alles machenkann“.46 Eine Umschulung von Menschen wird also als möglich angesehen. Zudem gehen die Autoren davon aus, dass es immer einen Teil von Menschen geben wird, die etwa nach zehn Jahren einer bestimmten Berufsausübung gerne eine Umschu- lung machen um in ihrem Leben auch andere Tätigkeitsbereiche kennenzulernen. Im Kapitalismus unterbleibe dieser Tätigkeitswechsel oft wegen des Verdienstausfalls während einer Umschulung und wegen der Angst nach der Ausbildung u.a. wegen des Alters keine weitere Berufsperspektive zu haben. Da die Ausbildungszeit in dem vorgeschlagenen Konzept genauso bezahlt wird wie die Arbeitszeit, wird von einer deutlich höheren Anzahl an Menschen ausgegangen, die sich im Laufe ihres Lebens komplett umschulen lassen, als das derzeit im Kapitalismus der Fall ist.
3.4.3 Prognostizierter technischer Entwicklungsschub
Sollte es doch zu einem Engpass an Spezialwissen und Ausübungsbereitschaft kommen, muss sich die Gesellschaft demokratisch entscheiden: Zahlt sie den Arbei- tern, die die „Drecksarbeit“ machen, mehr Lohn und führt damit eine gewisse Entwer- tung der Arbeitsstunde ein oder setzt sie auf die Entwicklung modernerer Technolo- gien, die darauf abzielen bestimmte unattraktive Arbeitsschritte zu automatisieren.47 Eine direkte Zwangsarbeit, wie es die Sowjetunion kannte, wird abgelehnt. Die Auto-ren verweisen in dem Zusammenhang besonders auf die hemmende Wirkung des Kapitalismus für die Entwicklung von arbeitseinsparenden Technologien.48 Demnach wird neue Technologie im Kapitalismus nur dann entwickelt und auch tatsächlich eingesetzt, wenn die neue Technik billiger ist als die Arbeitskraft. Da dies oft nicht der Fall ist, wie das Outsourcing nach China zeigt, bleibt die kapitalistische Gesell- schaft trotz enormer Fortschritte weit hinter ihren technischen Möglichkeiten zurück.Dies drückt sich durch eine immense Summe an eigentlich unnötig zu leistender Ar- beit aus. Insofern sei davon auszugehen, dass unter sozialistischen Planungsge- sichtspunkten eine schrittweise Automatisierung vieler derzeit noch von Menschen ausgeführter Tätigkeiten stattfinden wird. Gerade durch diesen effektiveren Umgang mit Arbeitszeit könne der Sozialismus „seine Überlegenheit gegenüber dem Kapita-lismus beweisen“.49
3.5 Konkrete Planung der Zeitökonomie
3.5.1 Input-Output-Berechnungen
Um nun konkrete gesellschaftliche Planungen vornehmen zu können, setzen die Au- toren auf die Bestimmung des Arbeitsinhaltes von Gütern und Dienstleistungen über Input-Output-Tabellen, wie man sie auch in der klassischen Volkswirtschaftsfor- schung verwendet.50 Zudem wird auf den auch in der Betriebswirtschaft bekannten Begriff der „Mannwoche“, also den Wert einer Arbeitswoche, zurückgegriffen.51 Vor-stellbar ist aber ebenso die Verwendung der bekannten Arbeitsstunde bzw. Mann- stunde. Jedes Arbeitserzeugnis soll dabei in Input und Output von Arbeitszeit und verwendeten anderen Gütern umgerechnet werden. Erfasst wird dafür nicht nur die direkte Arbeit etwa das Pflanzen und Pflücken einer Tomate, sondern auch die indi- rekte Arbeit in Form von den Bauarbeiten des Gewächshauses, sowie die Ölförde-rung für die Beheizung des Gewächshauses etc.52 Alle Arbeitsschritte eines Produk-tionsprozesses müssen also erfasst, aufeinander umgerechnet und so zur Grundlage der Arbeitsplanung werden. Beispielsweise kann eine gewisse Menge an Arbeits- stunden und eine bestimmte Menge an Öl als Produktions-Input direkt umgerechnet werden in einen bestimmten Produktions-Output in Form von Laibe Brot, Lastwagen, Maschinen etc.53 Dabei ist deutlich, dass es unmöglich ist, „mit manuellen Methoden solch einen Plan zu erstellen“.54 Anders sieht es aus, wenn Computer zum Einsatz kommen. Mit Hilfe der Komplexitätstheorie, einem Teilgebiet der Informatik, und ma- thematischen Iterationsverfahren zur schrittweisen Annäherung (sukzessive Appro- ximation) kann die Berechnungszeit durch Verwendung eines Supercomputers radi- kal reduziert werden.55 So gehen die Autoren davon aus, dass „die Berechnung der Arbeitszeiten für eine ganze Volkswirtschaft [mit100 Milliarden arithmetischen Re- chenoperationen in der Sekunde (100 Gigaflops)] in nur wenigen Minuten machbar“ ist.56 Berücksichtigt werden sollte dabei das Mooresche Gesetz, wonach sich unge- fähr alle zwei Jahre die Rechenleistung eines Prozessors verdoppelt. Heutige Super- computer bewegen sich beispielsweise im Petaflops-Bereich und sind somit nicht mehr bei Milliarden, sondern bei Billiarden Rechenoperationen in der Sekunde.57 Hinzu kommen technische Möglichkeiten wie Distributed Computing, also das auf mehrere Rechner verteilte Berechnen einer Gesamtaufgabe. Insofern ist davon aus- zugehen, dass der reine Rechenaufwand heutzutage keinerlei Hindernis mehr dar- stellt. Zudem hat die technische Seite der Erfassung von Daten durch das Internet, die Satellitentechnologie wie GPS und moderne RFID-Technologie enorme Fort- schritte gemacht.
3.5.2 Intelligente Planung statt Trial-and-Error
Bei der gesellschaftlichen Planung geht es im Weiteren grundlegend darum, „auto- matische Steuerungsprozesse“ zu installieren.58 Zusammengefasst wird dieses auf Planung basierende Prozess-Management unter dem Begriff Kybernetik. Die Autoren vergleichen die Marktwirtschaft dabei mit einem groben Heizkessel-Regulator, der um die Temperatur in einem Raum konstant zu halten, nur die Brennstoffzufuhr- Optionen an- und abstellen ausführt – je nachdem ob die Temperatur über oder unter dem gewünschten Wert ist. Insofern gleicht die Marktwirtschaft einem „Trial-and- Error-Prinzip“, ist somit nur „reaktiv und vermag nichts vorherzusehen“.59 Auch „Kon- sumentenwünsche [können] nicht als Ziel oder Steuerungsinput dienen, da sie nur effektiv sind, wenn sie auch durch das nötige Geld zum Kaufen abgesichert sind“.60
Die Kaufkraft hängt aber wiederum von schwankenden Faktoren ab, wie Zentral- bankzinssätzen, dem Kreditmarkt etc. – anders verhält es sich bei der vorgestellten Zeitökonomie: Statt einem „groben Kontroller“ wie bei der Marktwirtschaft, kann von einem „intelligenten Kontroller“ gesprochen werden.61 Zentrale Ziele der Planung sind klar definiert: 1.) Der allgemeine „Anstieg des kulturellen Niveaus und des Le- bensstandards vor allem der Arbeiterklasse“, was sich u.a. auch durch „allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit und Verlängerung der Freizeit“ ausdrückt, 2.) das „Ein- schlagen eines langfristigen ressourcenschonenden Entwicklungsweges“, 3.) die Etablierung von ökonomischer Geschlechtergleichheit und 4.) die „Reduzierung von Klassen- und regionalen Unterschieden“.62
3.5.3 Planungsphasen und direkte Demokratie
Drei Planungsphasen werden unterschieden: 1.) Die makroökonomische Planung,2.) die strategische Planung und 3.) die detaillierte Planung. Im Rahmen der makro- ökonomischen Planung soll über gesellschaftliche Ziele – also über die Frage nach der Aufteilung der Gesamtarbeitszeit – direkt demokratisch abgestimmt werden: „Wie viel der gesellschaftlichen Arbeitszeit sollte der Produktion von [Luxus-]Konsumgütern gewidmet sein? Wie viel der Versorgung mit gesellschaftlichen Gü- tern wie Gesundheit, Erziehung oder sozialisierte Kinderbetreuung?“63 Während die Autoren die Abstimmung über „Fernseher“ mit „elektronischen Abstimmungsgeräten“ realisieren wollen, ist heutzutage eine Internetbeteiligung realistischer.64 Bei der stra- tegischen Planung geht es dann im zweiten Schritt um Fragestellungen der techni- schen Umsetzung der beschlossenen Planziele. Dabei sollen „die Resultate gegen- wärtiger wissenschaftlicher Forschung in die Zukunft projiziert werden“. Die genaue- ren „machbaren Optionen“ sollen dann vor einer demokratischen Abstimmung von„Ökonomen in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern“ ausgearbeitet und der Allge- meinheit zur Prüfung vorgestellt werden sollen.65 Wissenschaft wird also zum Teil in den Dienst der gesellschaftlichen Planziele gestellt. Im dritten Schritt, der detaillierten Planung, wird entsprechend der definierten Ziele auf die bekannten computerunter- stützten Input-Output-Tabellen zurückgegriffen und ermittelt welche konkreten Güter für die Herstellung eines angestrebten Endproduktes an welcher Produktionsstädte in welcher Anzahl benötigt werden. Ausgehend von den drei Planungsphasen auf Grundlage von Arbeitszeit halten die Autoren eine sozialistische Gesellschaftspla- nung für möglich. Der „liberalen Dreieinigkeit von Preis, Markt und Parlament“, halten sie „Arbeitswerttheorie, kybernetische Regulierung und partizipative Demokratie“entgegen.66
4.Zur Aktualität von Arbeitszeit als Geld – ein Ausblick
Cockshott und Cottrell aktualisieren die in die Bedeutungslosigkeit gedrängte objekti- ve Wertlehre des Marxismus, indem es ihnen gelingt, sie in eine konkrete moderne Planungskonzeption einzubetten. Dabei ist besonders die Verbindung von Sozialis- mus und direkter Demokratie richtungsweisend. Zudem stellen die Input-Output- Tabellen in Anbetracht einer permanenten Aktualisierung durch Computer eine glaubhafte Planungsgrundlage dar. Zentrale Aspekte wie Effizienz, Fairness und Transparenz könnten etwa über ein für alle jederzeit abrufbares Interface ähnlich ei- ner Wiki-Plattform sichergestellt werden. Insofern skizzieren die Autoren eine moder- ne Zeitökonomie ohne Fiat-Geld und Privateigentum an Produktionsmitteln. Aus technischer Sicht mag das Konzept 1993 als zu visionär und als zu ambitionierter High-Tech Glauben abgetan worden sein. Aus heutiger Perspektive wirken jedoch Verfahren wie elektronische Abstimmungsgeräte am Fernseher schon wieder äu- ßerst antiquiert. Es ist wirklich bezeichnend wie schnell die Produktivkräfte in Form von Computertechnologie und Internet bis vor kurzem undenkbare Möglichkeiten zur Steuerung des globalen Miteinanders hervorgebracht haben. Auch frühere Zweifel an der grundsätzlichen Machbarkeit von sozialistischer Planung müssen vor dem Hin- tergrund der damals dominierenden Unvorstellbarkeit von heute alltäglichen techni- schen Lösungen verstanden werden. So ist auch die grundlegende Kritik von libera- len Wirtschaftstheoretikern wie Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises aus dem letzten Jahrhundert, wonach niemals genügend Informationen zentral ge- sammelt und ausgewertet werden können, um eine Planwirtschaft wirklich zu reali- sieren, im Zeitalter von Smartphones mit permanenter Internetverbindung und tech- nisch längst einsatzfähigen Daten-Portalen wie Facebook, Google und Wikipedia sowohl theoretisch als auch praktisch einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten. Heute gilt der Satz von Cockshott und Cottrell folglich noch mehr als damals:
„ W ir spürten […] eine zentrale Planung war nicht nur durchführbar, sie wurde vielmehr dank der Fortschritte in Computertechnik immer naheliegender.“67
Genau das ist immer stärker der Fall. Längst ist Planungs-Technik im Alltag ange- kommen. Unternehmen planen ihre eigenen Produktionsprozesse so detailliert mit Just-in-Time-Produktion, RFID-Verfolgung von Warenströmen, GPS-Lokalisation, Dienstleistungsmanagement und Warenwirtschaftssystemen in den Supermärkten, dass es nur noch der Umstellung von „Planung nach privatem Profit“ auf „Planung nach allgemeinem Nutzen“ bedarf.
Zudem wird der Widerspruch zwischen immer besserer Technik und immer längerer Arbeitszeit offenkundig. Statt die Arbeitszeit wie es die Autoren vorschlagen mit stei- gender Technik für alle zu reduzieren, geschieht im Kapitalismus das Gegenteil: Im- mer längere Wochenarbeitszeiten und Arbeitsjahre insgesamt sind gefordert. Diese paradoxe Entwicklung lässt sich nur durch den kapitalistischen Zwang zur Wert- schöpfung durch Arbeit erklären. Denn nicht allgemeiner Wohlstand ist das Ziel des Kapitalismus, sondern privater Profit. Unabhängig also wie gut die Technik wird, ge- arbeitet werden muss im Kapitalismus immer, um Wert zu schaffen. So gerät die Entwicklung der Produktivkräfte ganz im Sinne der Dialektik des historischen Mate- rialismus immer mehr in Konflikt mit den Produktionsverhältnissen. Derartige Phasen sind jedoch kritische Phasen im Sinne der Marxschen Revolutions-Prognose:
„ Au f einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktiv- kräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsver- hältnissen […]. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. […] Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse tre- ten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind.“ 68
Der „Kommunismus“ der Sowjetunion wurde gegen diese marxistische Überlegung der Produktivkraftentwicklung ausgerufen. Statt die Phase der Marktwirtschaft als notwendige Entwicklungsphase zu durchleben, hat man versucht direkt von einem unterentwickelten Agrarstaat in eine hochindustrialisierte sozialistische Gesellschaft„zu springen“. Insofern kann von dem konkreten Scheitern des real existierenden Sowjetsystems keinesfalls auf das Scheitern des sozialistischen Modells insgesamt geschlossen werden. Der berühmte Princeton Philosophie Professor Richard Rorty wies bereits 1999 auf eine ganze andere mögliche Wendung hin:
„ [N]obody can prove that Marx and Engels were wrong when they proclaimed that ‘the bourgeoisie has forget the weapons that bring death to itself.‘ It may be that the globalization of the labor market in the next century will reverse the progressive bourgeoisification of the European and North American proletariat. […] Maybe, in short, Marx and Engels just got the timing a century or two wrong.”69
Und in der Tat nimmt die Verelendung nun, nachdem sie lange über Kredite hinaus- gezögert werden konnte, etwa in den USA immer grundlegendere Formen an.70 So waren beispielsweise im Dezember 2011 46,5 von den 311 Millionen Amerikanern im Rahmen des „Supplemental Nutrition Assistance Program“ (SNAP) Empfänger von Essensmarken.71 Damit verdient also jeder siebte Amerikaner nicht mehr genug, um sich selbst ernähren zu können. Ein Argument, das oft vorgebracht wird besagt, dass der Arbeiter zwar tatsächlich – wie Marx es schildert – im Kapitalismus in Ketten lie- ge, aber die Ketten seien durch den Sozialstaat und den allgemeinen Wohlstand so vergoldet, dass er keinen Grund mehr habe für die Revolution. Dieses Argument wird sich in den kommenden Jahren nicht nur in den USA, sondern auch in Europa hart bewähren müssen. Nicht umsonst wurde der englische Ausdruck „squeezed middle“ jüngst in Großbritannien zum Wort des Jahres gewählt.72 Soziale Kürzungen werden nach wie vor mit dem Argument „Alternativlosigkeit“ radikal gegen die Interessen der Mehrheit durchgesetzt. Auch die jüngsten Finanz-Hilfspakete zur Rettung des Kapita- lismus mit Steuergeldern werden nicht nur im Süden von Europa, massive soziale Kürzungen nach sich ziehen. Die kurze Formel drückt das Vorgehen treffend aus: Gewinne werden privatisiert, Verluste werden sozialisiert. Soziale Sicherung stellt somit keine Priorität der Politik mehr da. Die Konsequenz wird die Verelendung im-mer weiterer Teile der Bevölkerung sein. Es wird sich also zeigen, wie lange die zu- künftig dann nicht mehr vergoldeten Ketten von einer den Wohlstand gewöhnten Be- völkerung akzeptiert werden. Der Hedge-Fonds Milliardär George Soros prognosti- zierte im Januar 2012 bereits bevorstehende Aufstände, Klassenkampf und Polizei- staat.73 Auch der Philosoph Slavoj Žižek sieht post-demokratische und totalitäre Strukturen auf dem Vormarsch: „The marriage between capitalism and democracy is over.”74 In der Tat soll bis Ende 2013 das von der EU-Kommission finanzierte euro- päische Überwachungssystem „INDECT“ vollständig einsatzbereit sein. Dabei geht es um die zentrale Bündelung und per Computer automatisierte Auswertung beste- hender Überwachungstechnologien wie etwa Gesichtserkennung, Handyortung, Vi- deoüberwachung, Telekommunikationsüberwachung sowie dem Einsatz von fliegen- den Überwachungsdrohnen zur Personenverfolgung in der ganzen EU.75 Die Wo- chenzeitung Zeit bezeichnet INDECT als „Traum der EU vom Polizeistaat“ und führt aus:
„ Beg r iffe wie Unschuldsvermutung oder gerichtsfester Beweis haben dabei keine Bedeutung mehr, ersetzt es doch die gezielte Suche nach Verdächtigen durch das vollständige und automatisierte Scannen der gesamten Bevölke- rung“. 76
Eine Totalüberwachung ist vor diesem Hintergrund nicht mehr auszuschließen. Somit wäre nicht einmal mehr das Argument abschreckend, sozialistische Gesellschaften seien unfreie, überwachte Gebilde, weil es empirisch gerade der Kapitalismus und nicht der Sozialismus ist, der die technisch allumfassendsten Überwachungsstruktu- ren gegen seine Bürger in Stellung bringt.
Über die vorliegende Arbeit hinaus wäre also eine konkrete Erfassung der gesell- schaftlich notwendigen Arbeitszeiten für eine Auswahl an alltäglichen Gütern als For- schungsthema interessant. So könnte die Bevölkerung ganz im Sinne von Arbeitszeit als Geld mit konkreten wissenschaftlichen Zahlen vor die demokratische Wahl ge- stellt werden: Wollt ihr wirklich bei schlechterer sozialer Absicherung für das gleiche Produkt im Kapitalismus 10 Stunden arbeiten, wofür ihr im Sozialismus nur 5 Stun- den arbeiten müsstet? Gerade auch vor dem Hintergrund der Verelendung und der Totalüberwachung wäre es zugespitzt die alte Frage von Rosa Luxemburg: Sozia- lismus oder Barbarei?
5. Literaturverzeichnis
Callinicos, Alex (2011 [1983]): Die revolutionären Ideen von Karl Marx. 3. Aufl. Ham- burg: VSA.
Cockshott, W. Paul/Cottrell, Allin (2006 [1993]): Alternativen aus dem Rechner. Für sozialistische Planung und direkte Demokratie. Köln: PapyRossa.
Dieterich, Heinz (2006): Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Wirtschaft, Gesell- schaft und Demokratie nach dem globalen Kapitalismus. Berlin: Kai Homilius Verlag.
Hinz, Thomas/Wagner, Simone (2006): Gib und Nimm. Lokale Austauschnetzwerke zwischen sozialer Bewegung und Marktergänzung, in: Soziale Welt 57 (1), S. 65-82. Online unter: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-18668 [Stand: 10.03.2012; letzter Zugriff 10.03.2012].
Kellermann, Paul (2008): Soziologie des Geldes, in: Maurer, Andrea (Hrsg.): Hand- buch der Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag, S. 320-340.
Marx, Karl/Engels, Friedrich (1972): Werke, Berlin/DDR: Dietz Verlag.
Ottmann, Henning (2008): Geschichte des politischen Denkens. Die Neuzeit. Die po- litischen Strömungen im 19. Jahrhundert. Stuttgart: J.B. Metzler.
Rogall, Holger (2006). Volkswirtschaftslehre für Sozialwissenschaftler. Eine Einfüh- rung. Wiesbaden: VS Verlag.
Rorty, Richard (1999): Failed Prophecies, Glorious Hopes, in: Constellations 6 (2). S. 216–221.
5.1 Verwendete Internetquellen
Biermann, Kai (2009): Indect – der Traum der EU vom Polizeistaat. Online unter http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2009-09/indect-ueberwachung [Stand: 24.09.2009; letzter Zugriff 10.03.2012].
Ernst , Nico (2011): Top 500. Schnellster Supercomputer erreicht 10,5 Petaflops. On- line unter: http://www.golem.de/1111/87756.html [Stand: 15.11.2011; letzter Zugriff 10.03.2012].
HVG/AFP/BRG/DAPD/RTR (2011): Trichet sieht „schwerste Krise seit Zweitem Welt- krieg“. Online unter: http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/trichet-sieht-schwerste-krise-seit-zweitem-weltkrieg/4480630.html [Stand: 09.08.2011; letzter Zugriff 10.03.2012].
Karl, Christine/Ressing, Jens (2011): Hunger und Obdachlosigkeit. Verarmende Staaten von Amerika. Online unter: https://www.ftd.de/politik/international/:hunger- und-obdachlosigkeit-verarmende-staaten-von-amerika/60142152.html [Stand: 14.12.2011; letzter Zugriff 10.03.2012].
Prince, Rosa (2012): George Soros predicts class war and riots. Online unter: http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9036889/George-Soros-predicts- class-war-and-riots.html [Stand: 24.01.2012; letzter Zugriff 10.03.2012].
Talk to Al Jazeera (2011): Slavoj Zizek: Capitalism with Asian values. Online unter:http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2011/10/2011102813360731764.html [Stand: 13.11.2011; letzter Zugriff 10.03.2012].
United States Department of Agriculture (2012): Program Information Report (Key- data). Online unter: http://www.fns.usda.gov/fns/key_data/december-2011.xlsx [Stand: 01.03.2012; letzter Zugriff 10.03.2012].
Zafar, Aylin (2011): Oxford English Dictionary Picks ‘Squeezed Middle’ as Word of the Year. Online unter: http://newsfeed.time.com/2011/11/28/oxford-english- dictionary-picks-squeezed-middle-as-word-of-the-year/ [Stand: 28.11.2011; letzter Zugriff 10.03.2012].
[...]
1 HVG/AFP/BRG/DAPD/RTR (2011): Trichet sieht „schwerste Krise seit Zweitem Weltkrieg“. Online unter: http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/trichet-sieht-schwerste-krise-seit- zweitem-weltkrieg/4480630.html [Stand: 09.08.2011; letzter Zugriff 10.03.2012].
2 Vgl. Dieterich, Heinz (2006): Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Wirtschaft, Gesellschaft und Demokratie nach dem globalen Kapitalismus. Berlin: Kai Homilius Verlag.
3 Ottmann, Henning (2008): Geschichte des politischen Denkens. Die Neuzeit. Die politischen Strömungen im 19. Jahrhundert. Stuttgart: J.B. Metzler. S. 162.
4 Marx, Karl/Engels, Friedrich (1972): Werke, Berlin/DDR: Dietz Verlag. Band 13, S. 9.
5 Ebd., Band 8, Seite 115.
6 Callinicos, Alex (2011 [1983]): Die revolutionären Ideen von Karl Marx. 3. Aufl. Hamburg: VSA. S.
7 Ottmann, Henning (2008). S. 163.
8 Callinicos, Alex (2011 [1983]). S. 142-143.
9 Ebd., S. 143.
10 Ebd.
11 Ebd.
12 Ebd., S. 146.
13 Rogall, Holger (2006). Volkswirtschaftslehre für Sozialwissenschaftler. Eine Einführung. Wiesbaden: VS. S. 57.
14 Kellermann, Paul (2008): Soziologie des Geldes. In Handbuch der Wirtschaftssoziologie. Hrsg. Andrea Maurer. Wiesbaden: VS Verlag, S. 324.
15 Vgl. deutscher Titel: Cockshott, W. Paul/Cottrell, Allin (2006 [1993]): Alternativen aus dem Rechner. Für sozialistische Planung und direkte Demokratie. Köln: PapyRossa.
16 Ebd., S. 21.
17 Ebd., S. 11.
18 Ebd., S. 15.
19 Ebd.
20 Ebd., S. 14.
21 Ebd., S. 20.
22 Ebd., S. 22.
23 Ottmann, Henning (2008). S. 203.
24 Ebd.
25 Hinz, Thomas/Wagner, Simone (2006): Gib und Nimm. Lokale Austauschnetzwerke zwischen sozialer Bewegung und Marktergänzung, in: Soziale Welt 57 (1), S. 65-82. Online unter: http://nbn- resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-18668 [Stand: 10.13.2012; letzter Zugriff 10.03.2012]. S. 12.
26 Cockshott, W. Paul/Cottrell, Allin (2006 [1993]). S. 26.
27 Ebd., S. 27.
28 Ebd.
29 Ebd., S. 32.
30 Ebd.
31 Ebd., S. 33.
32 Ebd., S. 40.
33 Ebd.
34 Ebd., S. 43.
35 Ebd., S. 44.
36 Ebd., S. 70.
37 Ebd., S. 69.
38 Ebd., S. 43.
39 Ebd., S. 50.
40 Ebd.
41 Ebd.
42 Ebd., S. 52.
43 Ebd.
44 Ebd., S. 58.
45 Ebd., S. 59.
46 Ebd.
47 Ebd., S. 56.
48 Ebd., S. 71.
49 Ebd., S. 70.
50 Ebd., S. 77.
51 Ebd.
52 Ebd.
53 Ebd.
54 Ebd., S. 79.
55 Ebd.
56 Ebd., S. 83.
57 Ernst, Nico (2011): Top 500. Schnellster Supercomputer erreicht 10,5 Petaflops. Online unter: http://www.golem.de/1111/87756.html [Stand: 15.11.2011; letzter Zugriff 10.03.2012].
58 Ebd., S. 88.
59 Ebd., S. 90-91.
60 Ebd., S. 91.
61 Ebd., S. 89-90.
62 Ebd., S. 93-94.
63 Ebd., S. 94.
64 Ebd., S. 108.
65 Ebd., S. 99-100.
66 Ebd., S. 11.
67 Ebd.
68 Marx, Karl/Engels, Friedrich (1972): Band 13, S. 9.
69 Rorty, Richard (1999): Failed Prophecies, Glorious Hopes, in: Constellations 6 (2). S. 216.
70 Karl, Christine/Ressing, Jens (2011): Hunger und Obdachlosigkeit. Verarmende Staaten von Amerika. Online unter: https://www.ftd.de/politik/international/:hunger-und-obdachlosigkeit- verarmende-staaten-von-amerika/60142152.html [Stand: 14.12.2011; letzter Zugriff 10.03.2012].
71 United States Department of Agriculture (2011): Program Information Report (Keydata). Online unter: http://www.fns.usda.gov/fns/key_data/december-2011.xlsx [Stand: 01.03.2012; letzter Zugriff 10.03.2012].
72 Zafar, Aylin (2011): Oxford English Dictionary Picks ‘Squeezed Middle’ as Word of the Year. Online unter: http://newsfeed.time.com/2011/11/28/oxford-english-dictionary-picks-squeezed-middle-as-word- of-the-year/ [Stand: 28.11.2011; letzter Zugriff 10.03.2012].
73 Prince, Rosa (2012): George Soros predicts class war and riots. Online unter: http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9036889/George-Soros-predicts-class-war-and- riots.html [Stand: 24.01.2012; letzter Zugriff 10.03.2012].
74 Talk to Al Jazeera (2011): Slavoj Zizek: Capitalism with Asian values. Online unter:
http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2011/10/2011102813360731764.html [Stand: 13.11.2011; letzter Zugriff 10.03.2012].
75 Biermann, Kai (2009): Indect – der Traum der EU vom Polizeistaat. Online unter http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2009-09/indect-ueberwachung [Stand: 24.09.2009; letzter Zu- griff 10.03.2012].
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Der Text behandelt das Thema Arbeitszeit als Geld, untersucht die theoretischen Grundlagen, die praktische Umsetzung und die Aktualität dieses Konzepts. Es wird eine moderne Planungskonzeption auf Basis von Arbeitszeit vorgestellt, die auf der marxistischen Arbeitswerttheorie basiert.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Der Text erörtert den historischen Materialismus und Idealismus als gegensätzliche Erklärungsmodelle für gesellschaftliche Entwicklung. Weiterhin werden die Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen sowie der Gebrauchs- und Tauschwert von Arbeitsprodukten behandelt. Der Unterschied zwischen objektiver und subjektiver Wertlehre wird ebenfalls beleuchtet.
Was ist die Planungskonzeption von Cockshott und Cottrell?
Cockshott und Cottrell stellen eine computergestützte Planungskonzeption vor, die auf der marxistischen Arbeitswerttheorie basiert. Sie argumentieren, dass eine effektive und produktive sozialistische Ökonomie möglich und dem Kapitalismus vorzuziehen ist. Ihre Konzeption beinhaltet die demokratische Kontrolle der Produktionsmittel und die Verwendung von Arbeitszeit als Währung.
Wie unterscheidet sich dieser Ansatz von anderen sozialistischen Konzepten?
Der Ansatz unterscheidet sich von der Sozialdemokratie, Tauschbanken und Tauschringen, da er eine Überwindung des Kapitalismus anstrebt und eine explizite Demokratisierung der Produktionsmittel vorsieht. Anders als der real existierende Sozialismus der Sowjetära wird radikale Demokratie und effiziente Planung vorgeschlagen.
Was sind die grundlegenden Prinzipien der Planungskonzeption?
Die Prinzipien sind, dass arbeitende Menschen die volle Verfügung über den Ertrag ihrer Arbeit erhalten und nur Arbeit als legitime Quelle von Einkommen angesehen wird. Das monetäre System basiert auf Zeit statt auf willkürlichen Währungseinheiten. Einkommensquellen wie Rente, Dividende und Zinsen, die vom Besitz an Vermögen herrühren, werden ausgeschlossen.
Wie wird die Gleichheit und Ungleichheit der Arbeitsfähigkeit berücksichtigt?
Das Planungskonzept geht von der Gleichheit der Menschen aus, berücksichtigt aber auch tatsächliche Unterschiede in der Arbeitsfähigkeit. Ausbildung wird als wertvolle Form der Arbeit angesehen und entsprechend bezahlt. Die Arbeitszeit wird entsprechend der Produktivität kategorisiert, um Anreize richtig zu setzen.
Wie erfolgt die konkrete Planung der Zeitökonomie?
Die Planung erfolgt durch Input-Output-Berechnungen, bei denen der Arbeitsinhalt von Gütern und Dienstleistungen bestimmt wird. Computer werden eingesetzt, um die Berechnungszeit zu reduzieren und die Planung effizienter zu gestalten.
Welche Aktualität hat das Konzept Arbeitszeit als Geld?
Das Konzept wird als aktualisiert betrachtet, da es die objektive Wertlehre des Marxismus in eine konkrete moderne Planungskonzeption einbettet. Die Verbindung von Sozialismus und direkter Demokratie wird als richtungsweisend angesehen. Angesichts der technologischen Fortschritte und der zunehmenden sozialen Ungleichheit gewinnt das Konzept an Relevanz.
Welche Kritik gab es an sozialistischer Planung und wie wird diese im Text entkräftet?
Liberale Wirtschaftstheoretiker wie Hayek und Mises kritisierten, dass niemals genügend Informationen zentral gesammelt und ausgewertet werden können. Der Text entkräftet diese Kritik mit Verweis auf Smartphones mit Internetverbindung und Daten-Portalen, wodurch die Datenerfassung und -auswertung deutlich vereinfacht werden. Die Datenerfassung ist nicht das Problem, sondern das Verarbeiten.
Welche Zukunftsperpektiven werden aufgezeigt?
Der Text geht davon aus, dass die Entwicklung der Produktivkräfte immer mehr in Konflikt mit den kapitalistischen Produktionsverhältnissen gerät. Angesichts von Verelendung und Überwachung wird die Frage aufgeworfen, ob Sozialismus oder Barbarei die Zukunft bestimmen wird.
- Quote paper
- Carl Philipp Trump (Author), 2012, Arbeitszeit als Geld. Marxistische Wertlehre und konkrete sozialistische Planungskonzeption vor dem Hintergrund der globalen Krise des Kapitalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456634