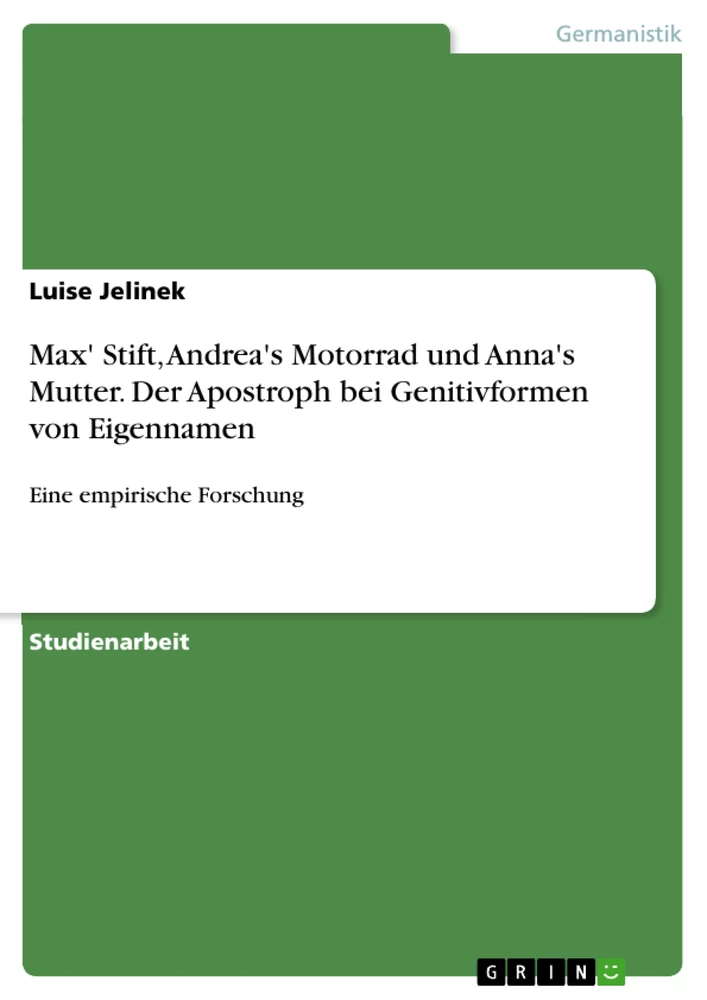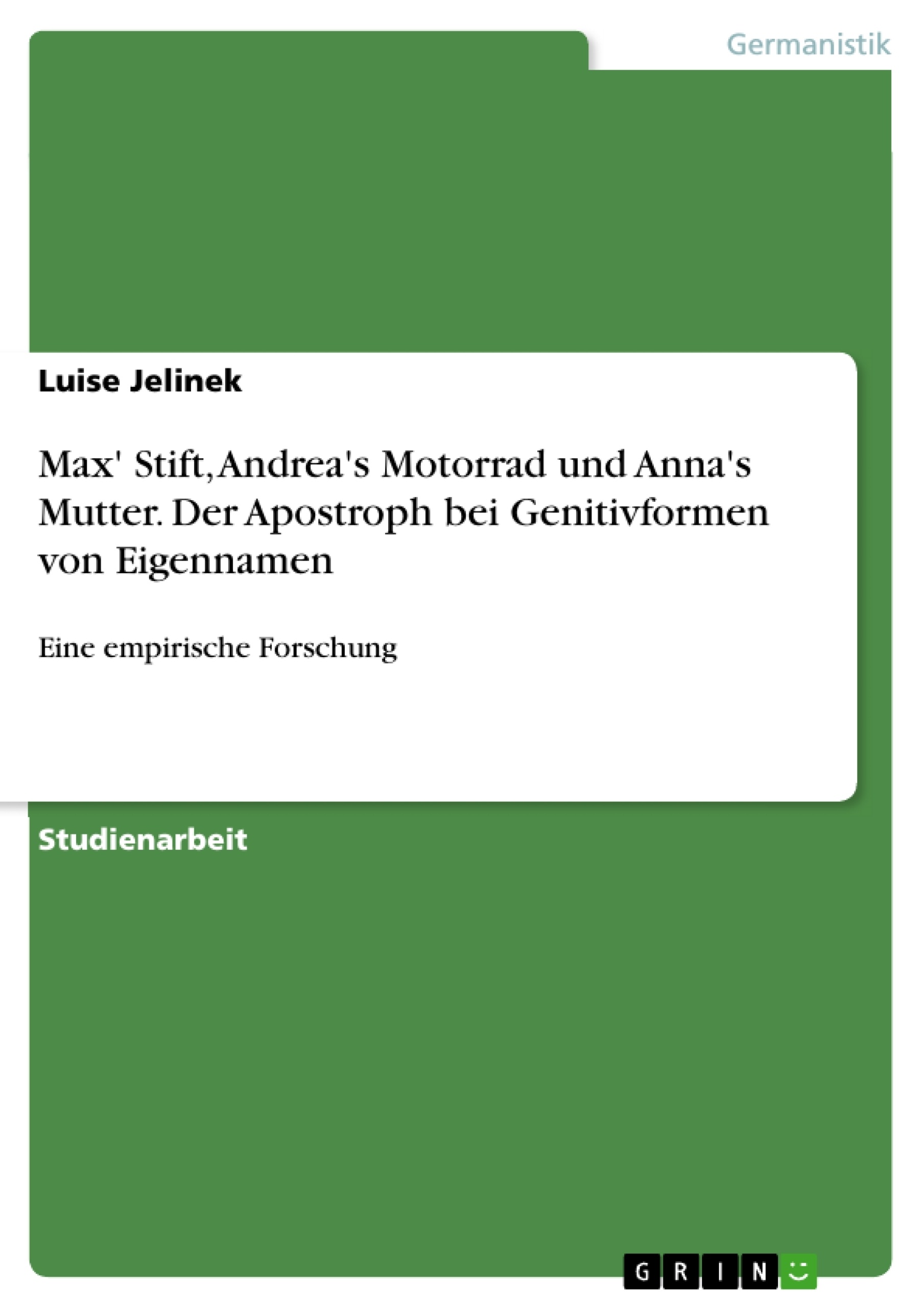In der heutigen Zeit gehört der Apostroph zu einem Thema in der deutschen Sprache, welches ständig neu aufgegriffen wird und in das Diskussionszentrum der Gesellschaft hinein getragen wird. Allein in Zeitschriften und Diskussionsforen findet man eine Vielzahl an Beiträgen, Publikationen und Kommentare über den Apostroph und seine Verwendung. Auch in der Öffentlichkeit trifft man oftmals auf den Apostroph, unter anderem bei Besitzrelationen, wie beispielsweise Petra’s Friseurladen oder Lisa’s Fotostudio.
Diese Apostrophsetzung, auch Genitiv-Apostroph genannt, steht immens in der Kritik der Sprache. Nicht immer ist die Nutzung des Apostrophs einer Genitivkonstruktion legitim und korrekt, sodass man das Phänomen der Apostrophsetzung im Genitiv als sprachlichen Zweifelsfall beschreiben könnte, da es bestimmte Regeln einzuhalten gilt.
In dieser empirischen Arbeit möchte ich mich mit eben diesem Apostroph bei Genitivformen von Eigennamen auseinandersetzen. Die Fragestellung, ob sich die Akzeptanz der korrekten Apostrophsetzung zwischen Studenten im ersten und letzten Semester (positiv) verändert, soll dabei beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund - Der Apostroph
- 2.1 Der Genitiv-Apostroph bei Eigennamen
- 2.2 Normsetzung
- 3. Entwickelte Fragestellung
- 4. Hypothesen
- 5. Methode
- 6. Datenerfassung und Analyse der Ergebnisse
- 7. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese empirische Arbeit untersucht die Akzeptanz der korrekten Apostrophsetzung im Genitiv bei Eigennamen, insbesondere den Vergleich zwischen Studenten des ersten und letzten Semesters. Ziel ist es, herauszufinden, ob sich die Akzeptanz im Studienverlauf positiv verändert.
- Der Apostroph im Deutschen und seine historische Entwicklung.
- Die Verwendung des Genitiv-Apostrophs bei Eigennamen.
- Normen und Regeln der Apostrophsetzung.
- Empirische Untersuchung der Akzeptanz des Genitiv-Apostrophs.
- Analyse der Ergebnisse und Diskussion der Fragestellung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Apostrophs im Deutschen ein und hebt dessen kontroverse Verwendung im Genitiv von Eigennamen hervor. Sie beschreibt den Apostroph als sprachlichen Zweifelsfall und benennt die Forschungsfrage, ob sich die Akzeptanz der korrekten Apostrophsetzung im Studienverlauf verändert. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise der empirischen Untersuchung.
2. Theoretischer Hintergrund - Der Apostroph: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Apostrophs von seinen Anfängen in der Antike bis zur heutigen Verwendung im Deutschen. Es differenziert zwischen verschiedenen Funktionen des Apostrophs, insbesondere der Elision und der Markierung morphologischer Grenzen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung und Problematik des Genitiv-Apostrophs bei Eigennamen, wobei die unterschiedlichen Ansichten und Regeln der Grammatik dargestellt werden. Das Kapitel dient als Grundlage für die nachfolgende empirische Untersuchung.
2.1 Der Genitiv-Apostroph bei Eigennamen: Dieses Unterkapitel konzentriert sich auf die spezifische Verwendung des Apostrophs im Genitiv bei Eigennamen. Es verfolgt die historische Entwicklung dieser Schreibweise, von den Anfängen im 17. Jahrhundert bis hin zu den Diskussionen und Regelungen im 19. und 20. Jahrhundert. Die unterschiedlichen Positionen von Grammatikern und die Entwicklung der Schreibweise werden ausführlich dargestellt, unter Berücksichtigung der Einflüsse von Schriftstellern und der Rechtschreibregeln. Die Komplexität dieser Thematik und ihre Relevanz für die Forschungsfrage wird verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Apostroph, Genitiv, Eigennamen, deutsche Sprache, Sprachwandel, Normsetzung, empirische Forschung, Studenten, Akzeptanz, Orthographie, Elision, Morphologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Akzeptanz der Apostrophsetzung im Genitiv bei Eigennamen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Akzeptanz der korrekten Apostrophsetzung im Genitiv bei Eigennamen, insbesondere im Vergleich zwischen Studenten des ersten und letzten Semesters. Es wird analysiert, ob sich die Akzeptanz im Studienverlauf positiv verändert.
Welche Aspekte des Apostrophs werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Apostrophs im Deutschen, seine verschiedenen Funktionen (Elision, Markierung morphologischer Grenzen), die spezifische Verwendung im Genitiv bei Eigennamen, die unterschiedlichen Ansichten und Regeln der Grammatik zur Apostrophsetzung und die damit verbundenen Normen und Rechtschreibregeln.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Forschungsmethode. Details zur genauen Vorgehensweise sind im Kapitel "Methode" beschrieben.
Welche Fragestellung wird untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Verändert sich die Akzeptanz der korrekten Apostrophsetzung im Genitiv bei Eigennamen im Studienverlauf?
Welche Hypothesen werden aufgestellt?
Die Arbeit beschreibt die aufgestellten Hypothesen im Kapitel "Hypothesen". Konkrete Aussagen zu den Hypothesen finden sich dort.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Hintergrund zum Apostroph (inklusive eines Unterkapitels zum Genitiv-Apostroph bei Eigennamen), die Beschreibung der Fragestellung und Hypothesen, die Methode, die Datenerfassung und -analyse, die Diskussion der Ergebnisse und ein abschließendes Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Zu den Schlüsselwörtern gehören: Apostroph, Genitiv, Eigennamen, deutsche Sprache, Sprachwandel, Normsetzung, empirische Forschung, Studenten, Akzeptanz, Orthographie, Elision, Morphologie.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden bereitgestellt?
Die Arbeit bietet Zusammenfassungen für die Einleitung und das Kapitel zum theoretischen Hintergrund (inklusive Unterkapitel). Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt der jeweiligen Kapitel.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt, um Themen im Zusammenhang mit der deutschen Sprache und Orthographie zu analysieren.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das vollständige Dokument enthält alle Details, inklusive der vollständigen Kapitel.
- Quote paper
- Luise Jelinek (Author), 2018, Max' Stift, Andrea's Motorrad und Anna's Mutter. Der Apostroph bei Genitivformen von Eigennamen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456625