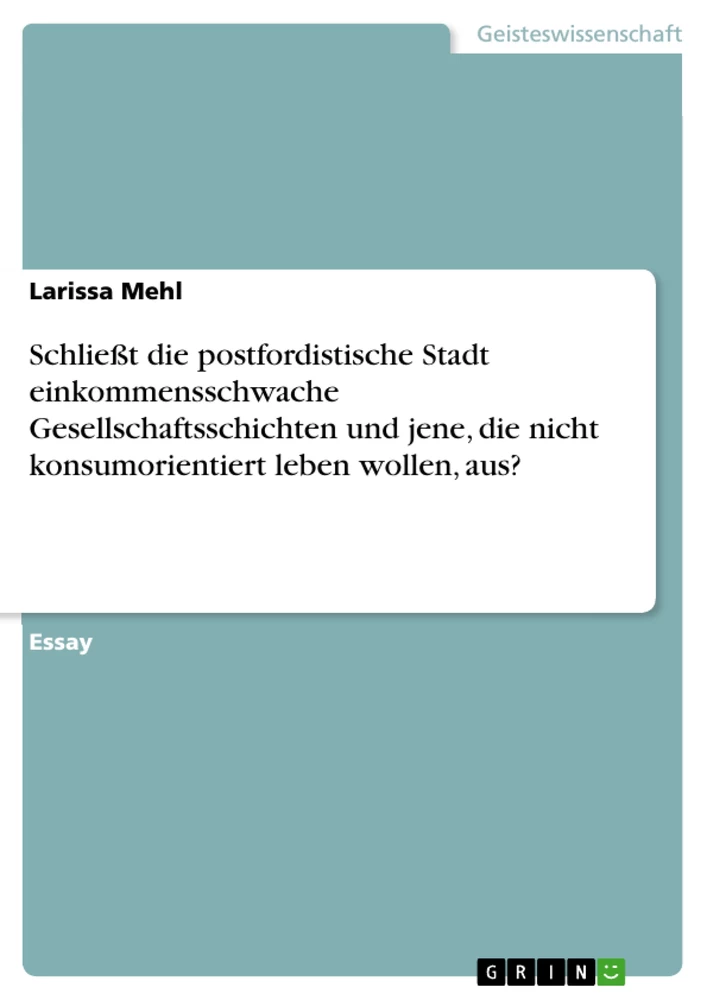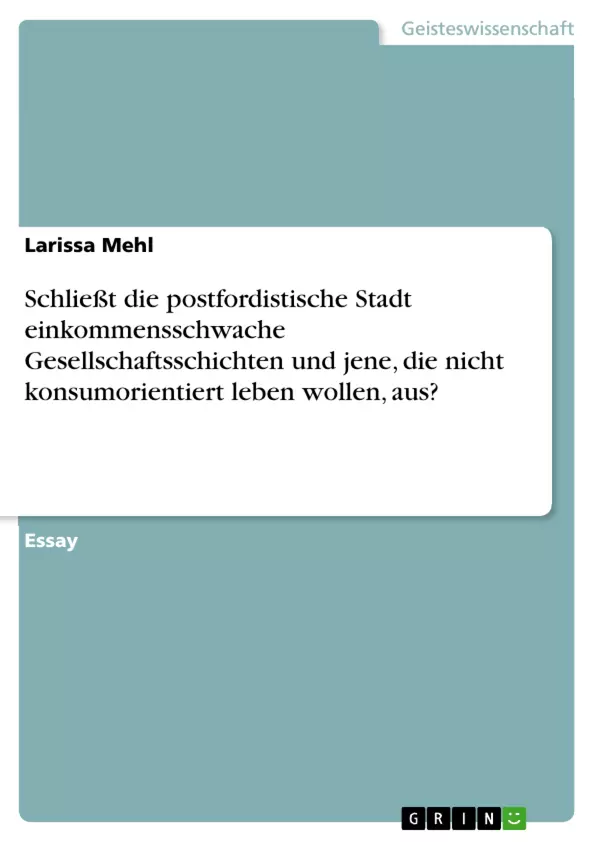Zeichnete sich die Ära des Fordismus noch durch industrielle Massenproduktion, den Aufbau des Sozialstaats und einer Steigerung der Kaufkraft aus, so vollzog sich ab den 1970er Jahren ein grundlegender Wandel dieser Phase dieser kapitalistischen Vergesellschaftungsform. Sich immer weiter entwickelnder technischer Fortschritt führte zu weitreichenden Umbrüchen, und gleichzeitig trafen eine durch die Ölkrisen ausgelöste Inflation und stagnierendes Wirtschaftswachstum aufeinander.
Vor allem die wirtschaftliche Globalisierung schwächte die fordistische Phase der Wirtschaftsstabilität in ihren Grundfesten: Um international mithalten zu können, mussten in der darauffolgenden Ära des Postfordismus, also der Phase nach der fordistischen Stabilitätsphase die sich bis heute vollzieht, Unternehmen ihre Produktionen vermehrt ins Ausland verlagern oder ihre Kosten durch Lohnsenkungen und Kündigungen kürzen.
Inhaltsverzeichnis
- Die postfordistische Stadt
- Exklusion einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen
- Privater Sicherheitsdienst und exklusive Räume
- Aufwertung und Hierarchisierung der Innenstadt
- Orientierung an wirtschaftlichen Maßstäben
- „Personengebundene Ressourcen“ und der Streit um Mitwirkung in der Gestaltung des urbanen Raums
- Exklusion durch die Teilnahme an der Lohnarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, ob die postfordistische Stadt einkommensschwache Gesellschaftsschichten und Menschen, die nicht konsumorientiert leben wollen, ausschließt.
- Die Auswirkungen der postfordistischen Transformation auf die Stadtpolitik
- Die Rolle von kulturellem und materiellem Kapital bei der Gestaltung von Interessen und der Ausgrenzung von Bevölkerungsgruppen
- Die Exklusion von einkommensschwachen Schichten durch Aufwertungsmaßnahmen und Hierarchisierung der Innenstadt
- Die Bedeutung von „personengebundenen Ressourcen“ und die Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Stadtplanung
- Die Exklusion von marginalisierten Gruppen durch die Orientierung an wirtschaftlichen Maßstäben und die Teilnahme an der Lohnarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Bevorzugung kaufkräftiger Einwohnerschichten und die daraus resultierenden Folgen für marginalisierte Bevölkerungsgruppen. Der Fokus liegt auf der Ausrichtung der Stadtpolitik auf Konsum und wirtschaftliches Wachstum.
Das zweite Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen kulturellem und materiellem Kapital und der Realisierung von Interessen. Es wird gezeigt, wie ausschließende Mechanismen in der Stadtpolitik wirken.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Rolle von „personengebundenen Ressourcen“ und der Mitwirkung in der Gestaltung des urbanen Raums. Der Einfluss von lokalen Akteuren und die Folgen der Privatisierung des Immobilienmarktes werden analysiert.
Schlüsselwörter
Postfordismus, Stadtentwicklung, Exklusion, Inklusion, Einkommensschichten, Konsum, Kulturelles Kapital, Materielles Kapital, Personengebundene Ressourcen, Stadtpolitik, Mitbestimmung, Lohnarbeit
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet den Übergang vom Fordismus zum Postfordismus?
Der Übergang war geprägt durch wirtschaftliche Globalisierung, technologischen Fortschritt und Krisen in den 1970ern, die zu Lohnsenkungen, Produktionsverlagerungen und einem Wandel der städtischen Strukturen führten.
Wie wirkt sich die postfordistische Stadtpolitik auf einkommensschwache Schichten aus?
Die Stadtpolitik orientiert sich zunehmend an wirtschaftlichen Maßstäben und kaufkräftigen Zielgruppen, was zur Ausgrenzung und Verdrängung marginalisierter Gruppen führt.
Welche Rolle spielen private Sicherheitsdienste in diesem Kontext?
Sie tragen zur Schaffung exklusiver Räume bei, die bestimmte Bevölkerungsgruppen faktisch ausschließen und die soziale Hierarchisierung im urbanen Raum verstärken.
Was sind „personengebundene Ressourcen“ in der Stadtplanung?
Damit sind individuelle Kapazitäten und Netzwerke gemeint, die darüber entscheiden, wer aktiv an der Gestaltung und Mitbestimmung des urbanen Raums teilnehmen kann.
Führt die Orientierung an Konsum zur Exklusion?
Ja, da die Aufwertung der Innenstädte primär auf Konsum ausgerichtet ist, werden Menschen, die nicht konsumorientiert leben wollen oder können, aus diesen Räumen verdrängt.
- Arbeit zitieren
- Larissa Mehl (Autor:in), 2017, Schließt die postfordistische Stadt einkommensschwache Gesellschaftsschichten und jene, die nicht konsumorientiert leben wollen, aus?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456577