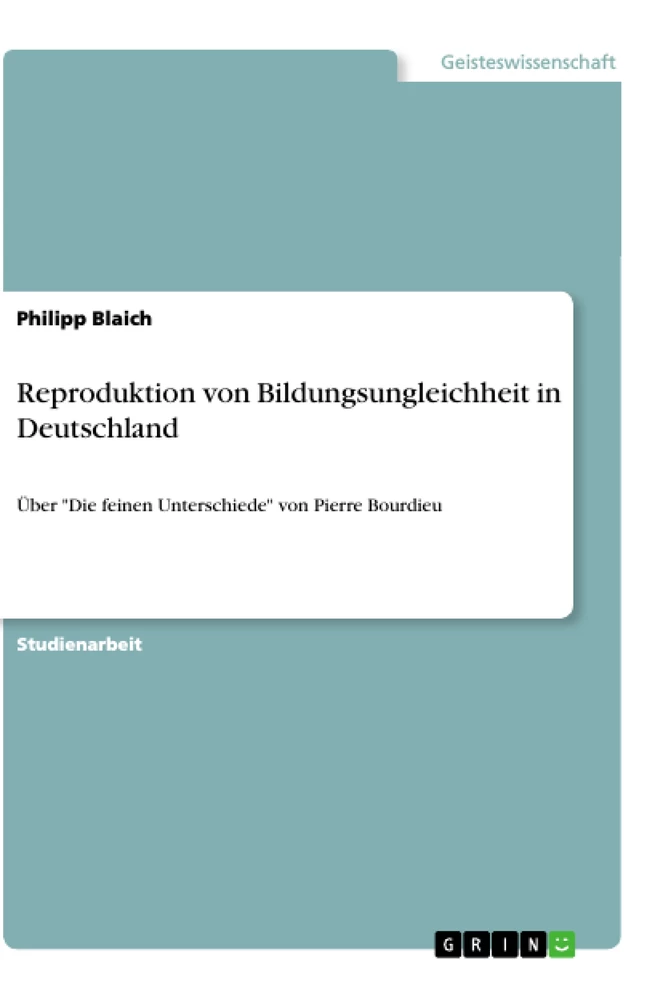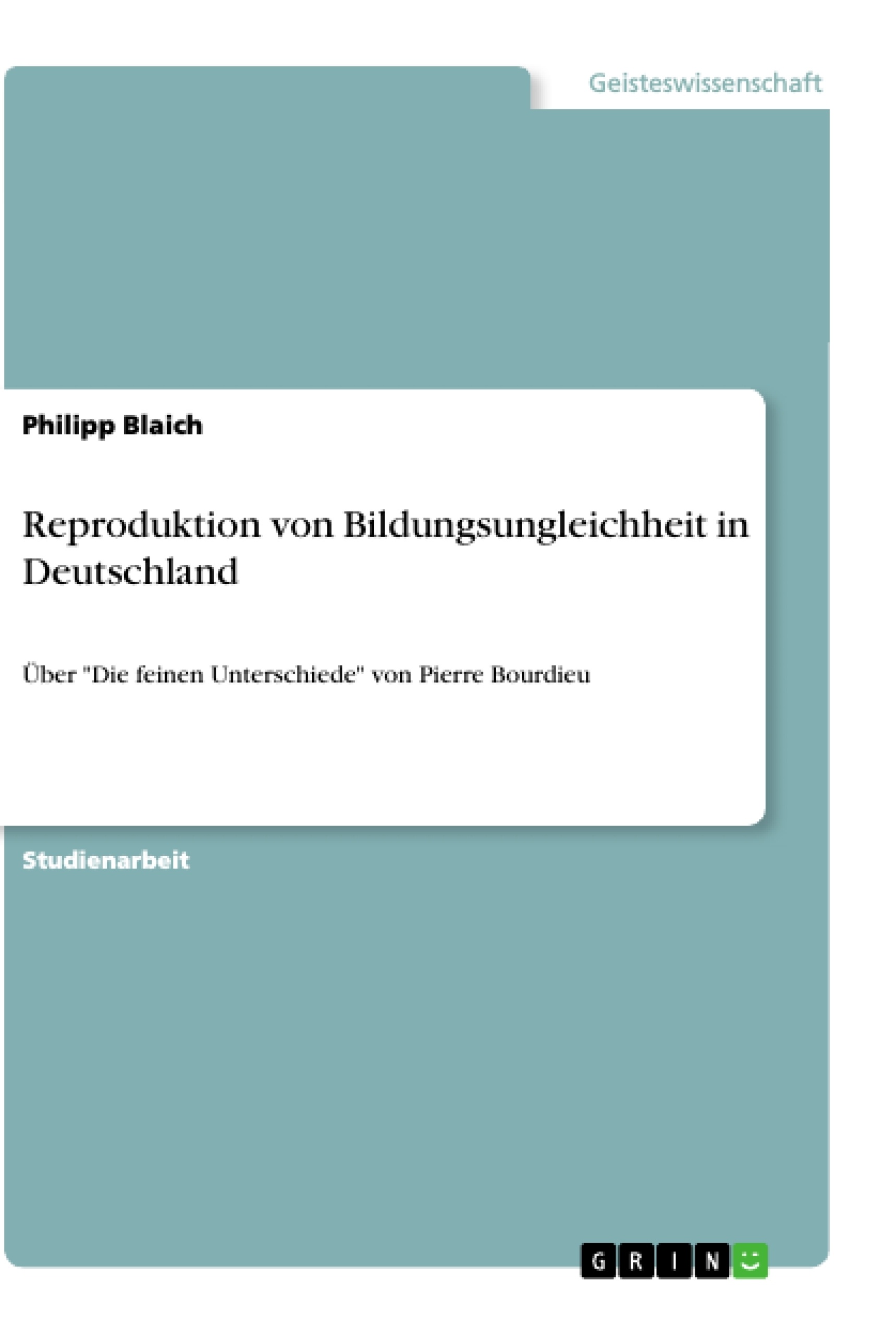Die vorliegende Arbeit untersucht die Bildungsungleichheit in Deutschland aus soziologischer Perspektive. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Pierre Bourdieus "Die feinen Unterschiede“. Zu Beginn dieser Arbeit soll nun der Habitus-Begriff von Bourdieu und dessen Verständnis über die Strukturierung und Chancenverteilung der Gesellschaft und deren Reproduktion angeführt werden.
Das deutsche Bildungssystem ist öfters in der Kritik, gleichzeitig wird doch öfters postuliert, dass "Bildung" der Schlüssel zu "Erfolg" und für die menschliche Entwicklung unabdingbar ist. Ziel dieser Arbeit ist es, anhand von Bourdieus Kapital- und Habitus-Theorie unterschiedliche Lebensstile und Lebensstilwandlungen zu beleuchten und ihre Entstehung aufzuzeigen, sowie zu diskutieren, inwiefern soziale Mobilität möglich ist, und welche Rolle "Bildung" dort spielt. Es soll besprochen werden, was "Bildung" überhaupt bedeutet, welche Verständnisse es über sie gibt, und welchen Faktor sie in Transformationsprozessen der sozialen Mobilität hat; ferner noch, welche Ungleichheit in ihr herrscht, und welche Folgen dies hat. Jenes wird in Anlehnung an Bourdieus Gedanken zum kulturellen Kapital und zur legitimen Kultur, aber auch spezifisch mit Beobachtungen zur Bildung und dem Bildungssystem in Deutschland mit den hiesigen "Besonderheiten" untersucht. Generell wird diese Arbeit auch abbilden, wo Bildungsungleichheit herrscht, und welche Faktoren zu ihr führen, und wie sie sich auf Grund ihrer jetzigen Konstitution und Konzession reproduzieren muss.
Bildung meint nicht allein die formale Erlangung eines schulischen oder akademischen Zertifikats. Denn solche sind an sich nicht aufschlussreich darüber, wieviel sozial verwertbares kulturelles Kapital hinter selbst identischen Zertifikaten (das heißt mit gleichem schulischem Kapital) steckt, denn "einberechnet" wird nicht, welche unterschiedlichen Investitionen (ökonomisch, zeitlich) geleistet worden sind, und wieviel verschiedenes ererbtes und inkorporiertes Kapital hineingeflossen ist, geschweige denn welche Erziehung und Sozialisation neben der Schule geschieht. Das erworbene schulische Kapital als institutionelle Bildung kann also höchst unterschiedlich sein, und daher, allein, ein schlechter Maßstab sein, für das, was man unter Bildung sonst versteht: Prozesse der Veränderung des Verhältnisses vom Menschen zu seiner Welt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Habitus- und Kapitaltheorie, Grundbegriffe
- 2.1 Homo oeconomicus / rational choice
- 3. Bildungsbegriff
- 3.1 Bildungsungleichheit
- 4. Faktoren und Erklärungsmuster
- 4.1 Der Weg zum Zertifikat
- 4.2 Migrationshintergrund und frühkindliche Bildung
- 5. Abschließende Worte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, anhand von Bourdieus Kapital- und Habitustheorie unterschiedliche Lebensstile und deren Entstehung zu untersuchen und zu beleuchten. Des Weiteren soll die Frage diskutiert werden, inwiefern soziale Mobilität möglich ist und welche Rolle „Bildung“ in diesem Zusammenhang spielt.
- Der Einfluss von Bourdieus Kapital- und Habitustheorie auf Lebensstile und soziale Mobilität
- Der Begriff „Bildung“ und seine Bedeutung für die Transformationsprozesse der sozialen Mobilität
- Die Bildungsungleichheit im deutschen Bildungssystem und ihre Folgen
- Der Zusammenhang zwischen kulturellem Kapital und legitimer Kultur im Kontext von Bildung
- Die Faktoren, die zur Reproduktion von Bildungsungleichheit führen
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Einleitung zur Arbeit gegeben. Hier wird die Relevanz von Bildung im Kontext von sozialer Mobilität herausgestellt und die Thematik der Arbeit an Hand von Bourdieus Kapital- und Habitustheorie angekündigt.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Grundbegriffen der Habitus- und Kapitaltheorie. Hier werden die Konzepte des Habitus, der Klassen, der Hysteresis und der Distinktion sowie der Prätention erläutert. Außerdem wird die Rolle des „Homo oeconomicus“ in Bezug auf soziale Praktiken und Entscheidungen beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Bildungsbegriff und der Bildungsungleichheit. Die Arbeit analysiert, welche Verständnisse von „Bildung“ existieren und welche Faktoren zur Bildungsungleichheit beitragen.
Im vierten Kapitel werden verschiedene Faktoren und Erklärungsmuster für die Bildungsungleichheit in Deutschland untersucht. Hier geht es um den Weg zum Zertifikat und den Einfluss von Migrationshintergrund und frühkindlicher Bildung.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit den abschließenden Worten der Arbeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Habitus, Kapital, Bildung, Bildungsungleichheit, soziale Mobilität, Kultur, Lebensstil, Distinktion, Prätention, Migrationshintergrund und frühkindliche Bildung. Diese Themen werden im Kontext der deutschen Gesellschaft und des deutschen Bildungssystems analysiert und diskutiert.
- Quote paper
- Philipp Blaich (Author), 2017, Reproduktion von Bildungsungleichheit in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456378