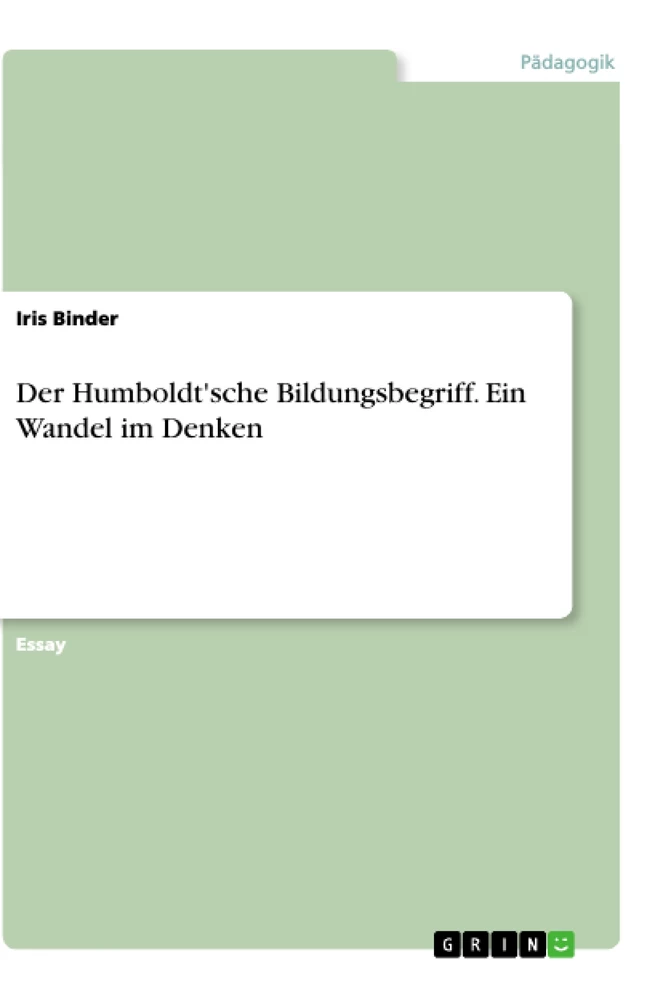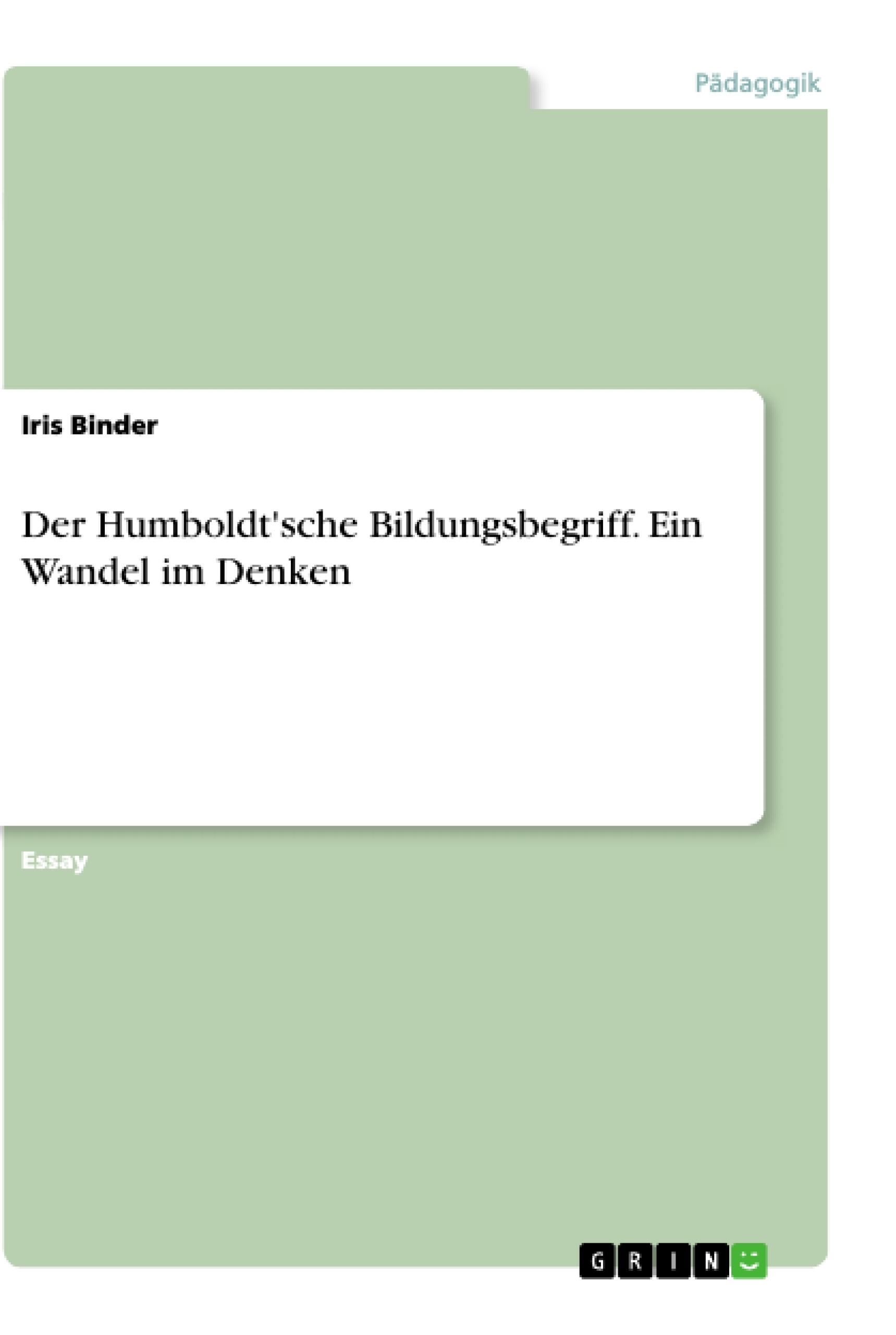Wilhelm von Humboldt wurde 1767 in Deutschland, in der Stadt Potsdam geboren. Sein Bildungsbegriff steht in Zentrum der neuhumanistischen Bewegungen Deutschlands, die die Überlegungen zum Thema Bildung und Schule der damaligen Zeit kritisierten und zu einem Wandel im Denken führten.
Bei dem Neuhumanismus, handelt es sich um eine Geistes- und Bildungsbewegung, die an den älteren Humanismus der Renaissance anknüpft und Mitte des 18.Jahrhunderts aufstrebte. Diese war im Gegensatz zur Aufklärungspädagogik gegen einen Gemeinnutzen der Schulerziehung und für eine Bildung, die den Wert der Individualität betont, ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Bedürfnisse nehmen zu müssen. In der griechischen Antike, an die sich der Neuhumanismus zum einem großen Teil orientiert, sieht Humboldt eine gelungene Herausbildung von Idealität innerhalb von Individualität. Einen besonders wichtigen Stellenwert erhielt dabei die Sprache, über welche der Mensch zu sich selbst gelangt. Der Mensch sollte die Alten Sprachen wie zum Beispiel Griechisch lernen, da diese den Zweck der formalen Bildung am besten erfüllen. Für Humboldt war eine allgemeine Bildung der Schlüssel zur Freiheit, weswegen eine berufliche Ausbildung erst danach erfolgen sollte, denn erst der gebildete Mensch kann seine ganze Energie im Berufsleben einsetzen, und somit umso mehr für die Gesellschaft leisten. Diese neue humanistische Bewegung fand großen Zuspruch im Bürgertum, da diese sich durch die Individualitäts-, Gleichheits- und Freiheitsversprechen, eine Zurückdrängung der ständischen Lernleistungskontrolle versprachen.
Im Folgenden wird nun der Humboldt‘sche Bildungsbegriff mit Bezug auf den historischen Kontext erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: (Ersatztitel, da kein Inhaltsverzeichnis im Originaltext vorhanden)
- Kapitel 2: (Ersatztitel, da kein Inhaltsverzeichnis im Originaltext vorhanden)
- Kapitel 3: (Ersatztitel, da kein Inhaltsverzeichnis im Originaltext vorhanden)
- Kapitel 4: (Ersatztitel, da kein Inhaltsverzeichnis im Originaltext vorhanden)
- Kapitel 5: (Ersatztitel, da kein Inhaltsverzeichnis im Originaltext vorhanden)
- Kapitel 6: (Ersatztitel, da kein Inhaltsverzeichnis im Originaltext vorhanden)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, [hier die Ziele des Werks einfügen, z.B. ein umfassendes Verständnis eines bestimmten Themas zu liefern oder ein bestimmtes Problem zu analysieren]. Die Arbeit basiert auf [hier die Methodik des Werks beschreiben].
- Thema 1: [Hier ein Kernthema einfügen]
- Thema 2: [Hier ein Kernthema einfügen]
- Thema 3: [Hier ein Kernthema einfügen]
- Thema 4: [Hier ein weiteres Kernthema einfügen, falls nötig]
- Thema 5: [Hier ein weiteres Kernthema einfügen, falls nötig]
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Diese Zusammenfassung von Kapitel 1 umfasst mindestens 75 Wörter und analysiert die zentralen Themen, Argumente und Beispiele des Kapitels. Sie erläutert die Bedeutung dieser Themen und deren Zusammenhang mit anderen Kapiteln oder übergeordneten Themen. Sie synthetisiert den Inhalt der Unterkapitel (falls vorhanden) zu einer kohärenten Erzählung, die sich auf das Gesamtkapitel konzentriert, und nicht auf einzelne Unterkapitel. Es werden detaillierte Beispiele und Erklärungen gegeben. Die Zusammenfassung vermeidet jedoch jegliche Enthüllung von wichtigen Schlussfolgerungen oder Spoilern.
Kapitel 2: Diese Zusammenfassung von Kapitel 2 umfasst mindestens 75 Wörter und analysiert die zentralen Themen, Argumente und Beispiele des Kapitels. Sie erläutert die Bedeutung dieser Themen und deren Zusammenhang mit anderen Kapiteln oder übergeordneten Themen. Sie synthetisiert den Inhalt der Unterkapitel (falls vorhanden) zu einer kohärenten Erzählung, die sich auf das Gesamtkapitel konzentriert, und nicht auf einzelne Unterkapitel. Es werden detaillierte Beispiele und Erklärungen gegeben. Die Zusammenfassung vermeidet jedoch jegliche Enthüllung von wichtigen Schlussfolgerungen oder Spoilern.
Kapitel 3: Diese Zusammenfassung von Kapitel 3 umfasst mindestens 75 Wörter und analysiert die zentralen Themen, Argumente und Beispiele des Kapitels. Sie erläutert die Bedeutung dieser Themen und deren Zusammenhang mit anderen Kapiteln oder übergeordneten Themen. Sie synthetisiert den Inhalt der Unterkapitel (falls vorhanden) zu einer kohärenten Erzählung, die sich auf das Gesamtkapitel konzentriert, und nicht auf einzelne Unterkapitel. Es werden detaillierte Beispiele und Erklärungen gegeben. Die Zusammenfassung vermeidet jedoch jegliche Enthüllung von wichtigen Schlussfolgerungen oder Spoilern.
Kapitel 4: Diese Zusammenfassung von Kapitel 4 umfasst mindestens 75 Wörter und analysiert die zentralen Themen, Argumente und Beispiele des Kapitels. Sie erläutert die Bedeutung dieser Themen und deren Zusammenhang mit anderen Kapiteln oder übergeordneten Themen. Sie synthetisiert den Inhalt der Unterkapitel (falls vorhanden) zu einer kohärenten Erzählung, die sich auf das Gesamtkapitel konzentriert, und nicht auf einzelne Unterkapitel. Es werden detaillierte Beispiele und Erklärungen gegeben. Die Zusammenfassung vermeidet jedoch jegliche Enthüllung von wichtigen Schlussfolgerungen oder Spoilern.
Kapitel 5: Diese Zusammenfassung von Kapitel 5 umfasst mindestens 75 Wörter und analysiert die zentralen Themen, Argumente und Beispiele des Kapitels. Sie erläutert die Bedeutung dieser Themen und deren Zusammenhang mit anderen Kapiteln oder übergeordneten Themen. Sie synthetisiert den Inhalt der Unterkapitel (falls vorhanden) zu einer kohärenten Erzählung, die sich auf das Gesamtkapitel konzentriert, und nicht auf einzelne Unterkapitel. Es werden detaillierte Beispiele und Erklärungen gegeben. Die Zusammenfassung vermeidet jedoch jegliche Enthüllung von wichtigen Schlussfolgerungen oder Spoilern.
Kapitel 6: Diese Zusammenfassung von Kapitel 6 umfasst mindestens 75 Wörter und analysiert die zentralen Themen, Argumente und Beispiele des Kapitels. Sie erläutert die Bedeutung dieser Themen und deren Zusammenhang mit anderen Kapiteln oder übergeordneten Themen. Sie synthetisiert den Inhalt der Unterkapitel (falls vorhanden) zu einer kohärenten Erzählung, die sich auf das Gesamtkapitel konzentriert, und nicht auf einzelne Unterkapitel. Es werden detaillierte Beispiele und Erklärungen gegeben. Die Zusammenfassung vermeidet jedoch jegliche Enthüllung von wichtigen Schlussfolgerungen oder Spoilern.
Schlüsselwörter
Hier werden die Schlüsselwörter eingefügt, z.B.: [Schlüsselwort 1], [Schlüsselwort 2], [Schlüsselwort 3], [Schlüsselwort 4], [Schlüsselwort 5].
Häufig gestellte Fragen zum Sprachbeispiel
Was ist der Inhalt dieses Sprachbeispiels?
Dieses Sprachbeispiel bietet eine umfassende Vorschau auf einen Text, einschließlich Titel, Inhaltsverzeichnis (obwohl im Originaltext kein Inhaltsverzeichnis vorhanden war, wurden Platzhalter eingefügt), Ziele und Schwerpunktthemen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Es dient der akademischen Analyse der im Text behandelten Themen.
Wie ist das Inhaltsverzeichnis aufgebaut?
Da im Originaltext kein Inhaltsverzeichnis vorhanden war, enthält das Sprachbeispiel ein Platzhalter-Inhaltsverzeichnis mit sechs Kapiteln, die jeweils mit "Kapitel 1", "Kapitel 2" usw. bezeichnet sind, und mit Ersatztiteln versehen sind.
Welche Zielsetzung und Themenschwerpunkte werden genannt?
Die Zielsetzung und die konkreten Themenschwerpunkte sind im Sprachbeispiel durch Platzhalter dargestellt. Der Nutzer wird aufgefordert, die tatsächlichen Ziele und Themen des zugrundeliegenden Textes an den entsprechenden Stellen einzufügen.
Wie sind die Kapitelzusammenfassungen gestaltet?
Für jedes der sechs Kapitel (1-6) existiert eine Platzhalter-Zusammenfassung. Jede Zusammenfassung enthält mindestens 75 Wörter und beschreibt die zentralen Themen, Argumente und Beispiele des jeweiligen Kapitels. Die Zusammenfassungen betonen den Zusammenhang der einzelnen Kapitel untereinander, ohne jedoch wesentliche Schlussfolgerungen oder "Spoiler" zu enthüllen.
Welche Schlüsselwörter werden genannt?
Die Schlüsselwörter sind als Platzhalter aufgeführt und müssen durch die tatsächlich im Text vorkommenden Schlüsselwörter ersetzt werden. Beispielhaft werden fünf Platzhalter-Schlüsselwörter genannt.
Für welchen Zweck ist dieses Sprachbeispiel gedacht?
Das Sprachbeispiel dient der strukturierten und professionellen Analyse von Themen in einem akademischen Kontext. Es ist auf Basis von OCR-Daten erstellt und ausschließlich für die akademische Nutzung bestimmt.
Wie kann ich dieses Sprachbeispiel verwenden?
Dieses Sprachbeispiel dient als Vorlage. Die Platzhalter für Titel, Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung, Themen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter müssen durch die entsprechenden Informationen aus dem Originaltext ersetzt werden.
- Quote paper
- Iris Binder (Author), 2018, Der Humboldt'sche Bildungsbegriff. Ein Wandel im Denken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456067