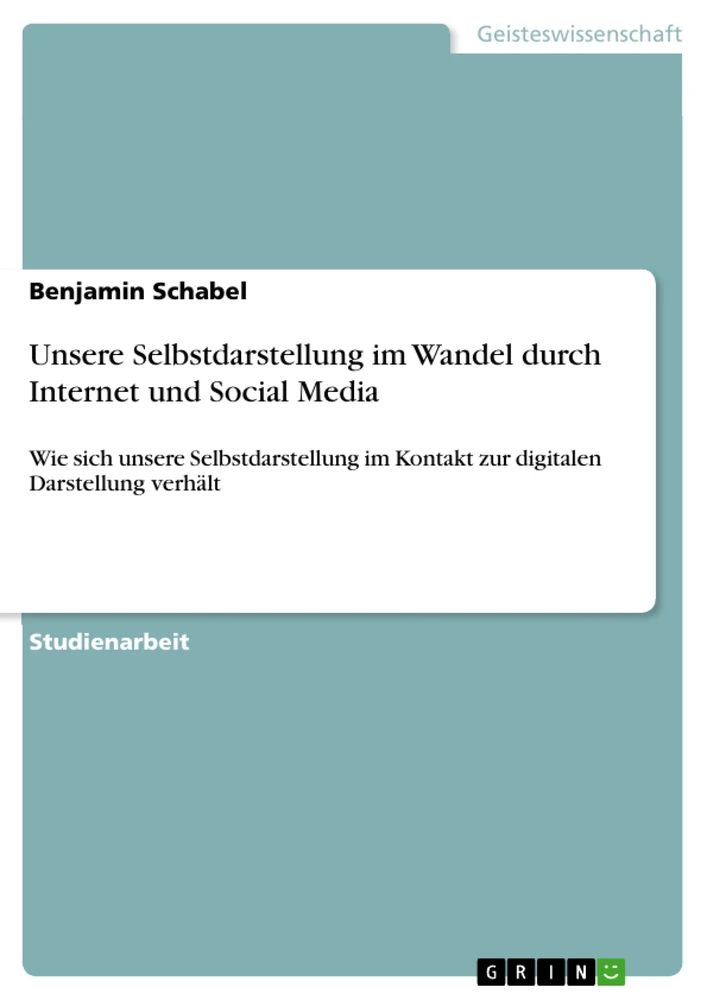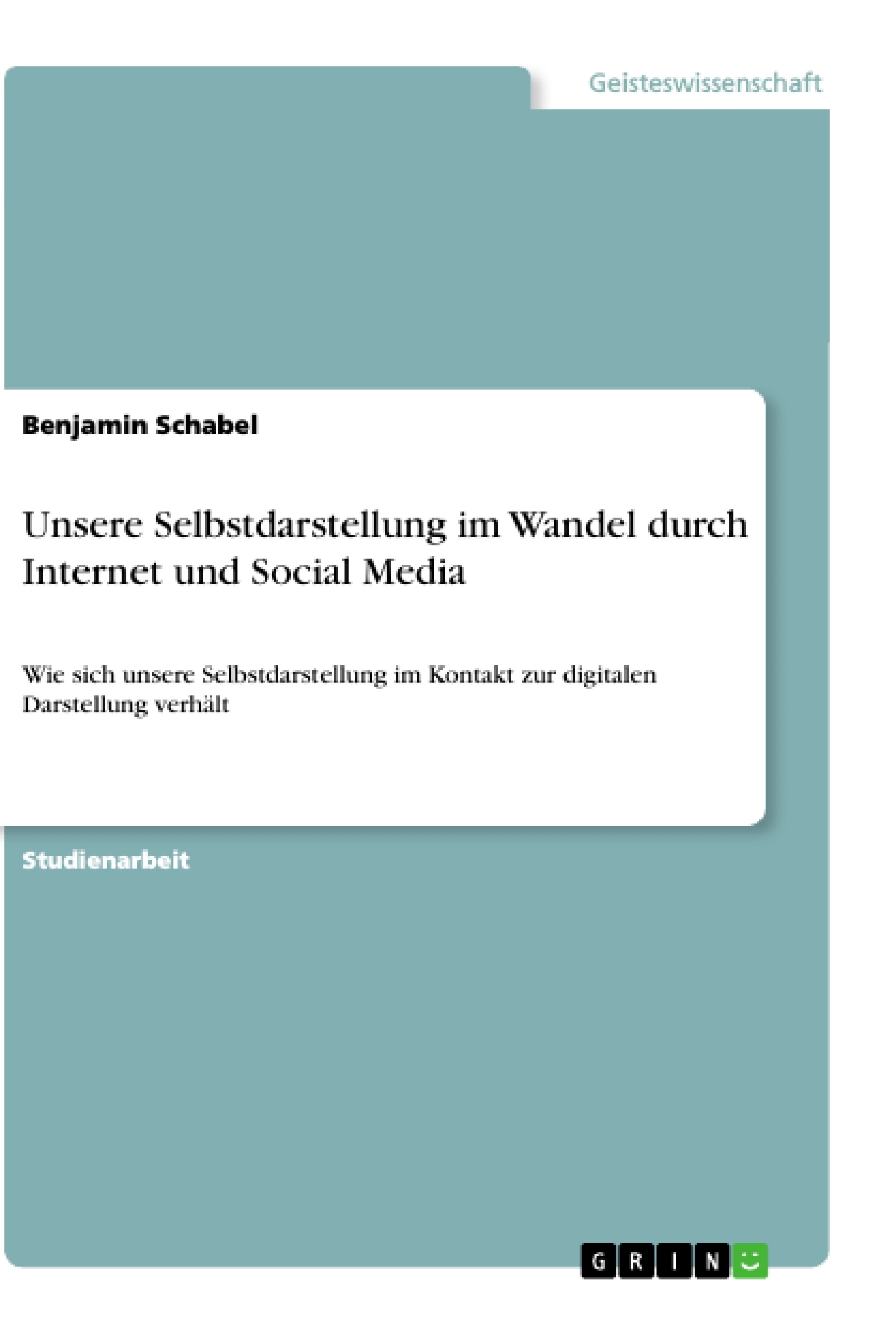Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich damit, wie sich unsere Selbstdarstellung im direkten persönlichen Kontakt zur digitalen Darstellung verhält.
Der heutige Begriff der Selbstdarstellung ist geprägt durch eine medienbasierte Umwelt, in welcher der Mensch durch Selbstinszenierung versucht, sich von der Masse abzuheben. Der Soziologe Goffman geht davon aus, dass Personen, die sich anderen Leuten präsentieren, Selbstdarstellung betreiben. Jede Person, die vor Publikum auftritt, macht sich Gedanken über ihre Wirkung. Spätestens seit Paul Watzlawick wissen wir: „Wir können nicht nicht kommunizieren“.
Selbst die bloße körperliche Anwesenheit wirkt auf unser Gegenüber.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Selbstkonzept
- Selbstwertschätzung
- Selbstdarstellung nach Goffman
- Darstellung
- Fassade
- Persönliche Fassade
- Bühnenbild
- Direkte persönliche Selbstdarstellung und ihre Wirkung
- Virtuelle Selbstdarstellung in digitalen Medien
- Einflussfaktor digitaler Medien
- Social Media
- Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken
- Gefahren durch soziale Netzwerke
- Schnittmenge/Unterschiede der Selbstdarstellung direkt persönlich und digital
- Abschließende Beurteilung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Selbstdarstellung im Wandel durch Internet und Social Media und vergleicht die direkte persönliche Selbstdarstellung mit der digitalen Darstellung. Ziel ist es, Hintergründe und Motive beider Formen zu beleuchten und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herauszuarbeiten.
- Definition und Abgrenzung des Selbstkonzepts und der Selbstwertschätzung
- Analyse der direkten persönlichen Selbstdarstellung und ihrer Wirkung
- Untersuchung der virtuellen Selbstdarstellung in digitalen Medien, insbesondere in sozialen Netzwerken
- Vergleich der Selbstdarstellung in persönlichen und digitalen Kontexten
- Identifizierung von Motiven und Gefahren der digitalen Selbstdarstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Selbstdarstellung im Kontext der medienbasierten Umwelt ein. Sie betont den gesellschaftlichen Druck, sich positiv zu präsentieren, und die Notwendigkeit erfolgreicher Kommunikation. Der Autor kündigt den Aufbau der Arbeit an, der Begriffsdefinitionen, die Analyse der direkten und virtuellen Selbstdarstellung und einen abschließenden Vergleich umfasst. Die Arbeit zielt darauf ab, Motive und Hintergründe der Selbstdarstellung aus beiden Perspektiven zu beleuchten.
Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel liefert Definitionen zentraler Begriffe. Das Selbstkonzept wird als dynamisch und umweltinteragierend beschrieben, wobei das "Ideal-Selbst" als Wunschbild der eigenen Persönlichkeit hervorgehoben wird. Die Selbstwertschätzung wird als Bewertung des Selbstkonzepts definiert und als zeitlich instabiler dargestellt, da sie von Faktoren wie Stimmungsschwankungen beeinflusst wird. Die Definitionen legen die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel.
Direkte persönliche Selbstdarstellung und ihre Wirkung: Dieses Kapitel (welches im Originaltext fehlt, aber aufgrund der Aufgabenstellung hier ergänzt wird) würde die verschiedenen Aspekte der Selbstdarstellung im direkten, persönlichen Kontakt beleuchten. Es würde die bewussten und unbewussten Strategien analysieren, die Individuen einsetzen, um einen bestimmten Eindruck zu hinterlassen. Die Wirkung dieser Strategien auf das Gegenüber und die Rolle von nonverbaler Kommunikation würden detailliert untersucht. Es würde wahrscheinlich auch die Auswirkungen von Selbstwertschätzung und Selbstkonzept auf die persönliche Selbstdarstellung erläutert werden.
Virtuelle Selbstdarstellung in digitalen Medien: Dieses Kapitel (welches im Originaltext fehlt, aber aufgrund der Aufgabenstellung hier ergänzt wird) würde die Selbstdarstellung in digitalen Medien und Social Media Plattformen untersuchen. Es würde die verschiedenen Möglichkeiten der Selbstinszenierung im digitalen Raum analysieren, zum Beispiel die Auswahl von Profilbildern, die Gestaltung von Statusmeldungen und die Interaktion mit anderen Nutzern. Die Einflüsse von Social Media auf das Selbstbild und das Selbstwertgefühl würden thematisiert und die möglichen Gefahren des digitalen Raumes (Cybermobbing, Identitätsdiebstahl, etc.) würden analysiert. Facebook würde als Beispiel für eine Social Media Plattform dienen, um die verschiedenen Strategien und Herausforderungen der Online Selbstdarstellung zu illustrieren.
Schnittmenge/Unterschiede der Selbstdarstellung direkt persönlich und digital: Dieses Kapitel (welches im Originaltext fehlt, aber aufgrund der Aufgabenstellung hier ergänzt wird) würde einen direkten Vergleich zwischen persönlicher und digitaler Selbstdarstellung ziehen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Strategien, Motiven und Auswirkungen würden detailliert analysiert. Es würde wahrscheinlich den Einfluss von Faktoren wie Anonymität, Distanz und der Möglichkeit zur Selbstkontrolle auf die Art und Weise der Selbstdarstellung untersuchen. Die Kapitel würden aufzeigen, inwiefern die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln einander ergänzen oder widersprechen.
Schlüsselwörter
Selbstdarstellung, Selbstkonzept, Selbstwertschätzung, Goffman, digitale Medien, Social Media, virtuelle Identität, persönliche Kommunikation, gesellschaftlicher Druck, Online-Identität, Selbstinszenierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Selbstdarstellung im Wandel durch Internet und Social Media
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Selbstdarstellung im Wandel durch Internet und Social Media. Sie vergleicht die direkte persönliche Selbstdarstellung mit der digitalen Darstellung, beleuchtet Hintergründe und Motive beider Formen und arbeitet Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede heraus.
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert zentrale Begriffe wie Selbstkonzept (als dynamisch und umweltinteragierend beschrieben, mit dem "Ideal-Selbst" als Wunschbild), Selbstwertschätzung (als Bewertung des Selbstkonzepts, beeinflusst von Stimmungsschwankungen) und Elemente der Selbstdarstellung nach Goffman (Darstellung, Fassade, persönliche Fassade, Bühnenbild).
Wie wird die direkte persönliche Selbstdarstellung behandelt?
Die Arbeit analysiert die direkte persönliche Selbstdarstellung und ihre Wirkung. Sie untersucht bewusste und unbewusste Strategien zur Eindruckssteuerung, die Rolle nonverbaler Kommunikation und den Einfluss von Selbstwertschätzung und Selbstkonzept.
Wie wird die virtuelle Selbstdarstellung in digitalen Medien behandelt?
Die Arbeit untersucht die virtuelle Selbstdarstellung in digitalen Medien und sozialen Netzwerken. Sie analysiert Möglichkeiten der Selbstinszenierung (Profilbilder, Statusmeldungen, Interaktionen), den Einfluss von Social Media auf Selbstbild und Selbstwertgefühl und potentielle Gefahren (Cybermobbing, Identitätsdiebstahl etc.). Facebook wird als Beispiel herangezogen.
Wie werden direkte und virtuelle Selbstdarstellung verglichen?
Die Arbeit vergleicht die direkte persönliche und die digitale Selbstdarstellung, analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Strategien, Motiven und Auswirkungen. Der Einfluss von Anonymität, Distanz und Selbstkontrolle auf die Selbstdarstellung wird untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Begriffsdefinitionen (Selbstkonzept, Selbstwertschätzung, Selbstdarstellung nach Goffman), direkter persönlicher Selbstdarstellung und ihrer Wirkung, virtueller Selbstdarstellung in digitalen Medien (inkl. Social Media), Vergleich persönlicher und digitaler Selbstdarstellung und einer abschließenden Beurteilung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstdarstellung, Selbstkonzept, Selbstwertschätzung, Goffman, digitale Medien, Social Media, virtuelle Identität, persönliche Kommunikation, gesellschaftlicher Druck, Online-Identität, Selbstinszenierung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Hintergründe und Motive der Selbstdarstellung in persönlichen und digitalen Kontexten zu beleuchten und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herauszuarbeiten. Sie untersucht den Einfluss digitaler Medien und sozialer Netzwerke auf die Selbstdarstellung und identifiziert mögliche Gefahren der digitalen Selbstdarstellung.
- Quote paper
- Benjamin Schabel (Author), 2018, Unsere Selbstdarstellung im Wandel durch Internet und Social Media, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455793