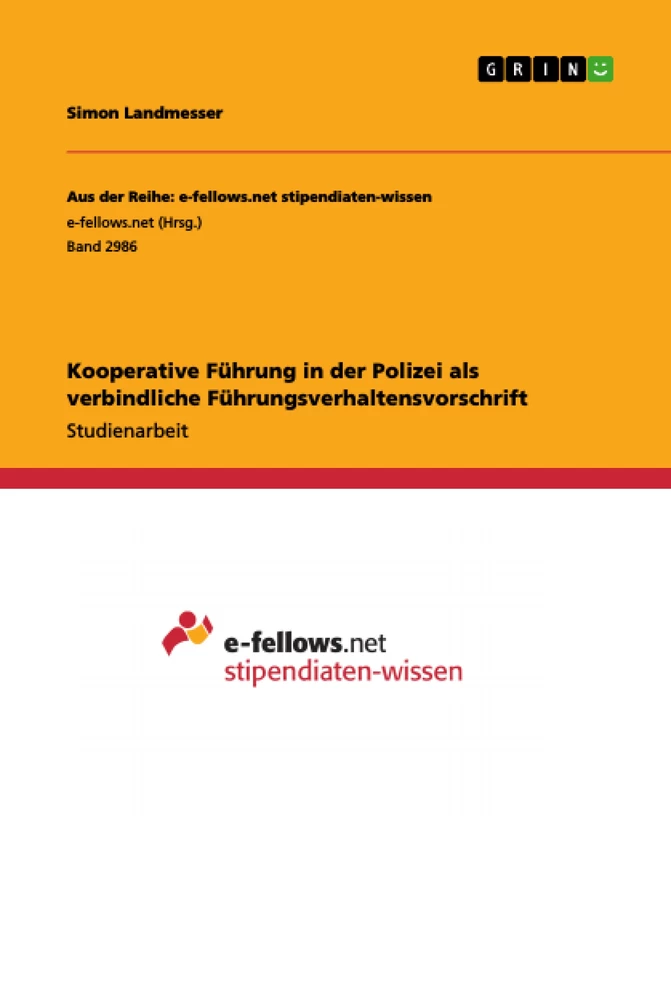Die Polizei ist eine Organisation mit militärischen Wurzeln, die sich durch Über- und Unterordnungsverhältnisse kennzeichnet, die bereits äußerlich anhand der Dienstgrade auf der Uniform sichtbar sind. Nicht selten wird sie als Idealbild für Max Webers Bürokratiemodell gesehen. In der Außenansicht ist es eine Organisation, die sich „über Befehl und Gehorsam organisiert und durch klare hierarchische Strukturen geprägt ist.“
So drängt sich schnell die Vermutung auf, dass in der Polizei ein autoritärer Führungsstil herrscht. Ein Blick in die Polizeidienstvorschrift (PDV) 100, welche verbindliche Grundlage polizeilicher Arbeit für alle Polizeien in Deutschland darstellt, zeichnet jedoch ein anderes Bild. So findet man dort eine klare Regelung, wie in den deutschen Polizeien geführt werden muss. „Das Kooperative Führungssystem (KFS) […] ist verbindliche Führungskonzeption, in der sich aufgaben- und mitarbeiterbezogenes Führungsverhalten ergänzen.“ Kooperative Führung ist also vorgeschrieben. Die Einführung dieser Führungsverhaltensvorschrift war Teil eines Wandels im Führungsverständnis innerhalb der deutschen Polizeien in den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Seit der Einführung hat sich die Forschung im Bereich der Personalführung weiterentwickelt. Außerdem steht die Polizei vor der Herausforderung der Integration der sogenannten Generation Y und Z, welche sich unter anderem durch eine hohe Informationalisierung, Globalität und Flexibilität auszeichnen. Die seit über 30 Jahren geltende Führungsverhaltensvorschrift in den Polizeien wird in den letzten Jahren vermehrt kritisch betrachtet. Vor diesem Hintergrund stellt sich folgende Forschungsfrage: Welche Stärken und Schwächen hat die verbindliche Führungsverhaltensvorschrift zur kooperativen Führung in den Polizeien der Länder und des Bundes?
Zur Beantwortung dieser Frage wird zunächst die kooperative Führung allgemein und das kooperative Führungssystem in der Polizei begrifflich eingeordnet. Anschließend wird die Entstehung und Verbindlichkeit der Führungsverhaltensvorschrift herausgearbeitet und dieses auf Stärken und Schwächen im Kontext mit der Polizei als Organisation analysiert. Alternative Ansätze anhand aktueller Forschungen werden aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffliche Einordnung
- 2.1 Kooperative Führung als Führungsstil
- 2.2 Kooperatives Führungssystem in der Polizei
- 3 Kooperative Führung in der Polizei
- 3.1 Verbindlichkeit des Führungsstils
- 3.1.1 Formal
- 3.1.2 Informell
- 3.2 Analyse der aktuellen Situation
- 3.2.1 Stärken
- 3.2.2 Schwächen
- 3.3 Problem der Vorschrift eines Führungsstils
- 4 Forschungsansätze zu alternativen Lösungsmöglichkeiten
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Stärken und Schwächen der verbindlichen Führungsverhaltensvorschrift zur kooperativen Führung in deutschen Polizeien. Sie analysiert die konzeptionellen Grundlagen und die praktische Umsetzung des kooperativen Führungssystems im Kontext der Polizeiorganisation.
- Begriffliche Einordnung der kooperativen Führung
- Das Kooperative Führungssystem in der Polizei
- Formaler und informeller Aspekt der Verbindlichkeit des Führungsstils
- Analyse der Stärken und Schwächen des Systems
- Alternative Forschungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der kooperativen Führung in der Polizei ein. Sie beschreibt die Polizei als Organisation mit militärischen Wurzeln und traditionell autoritärem Führungsstil, hebt aber die verbindliche Vorschrift des kooperativen Führungssystems (KFS) in der Polizeidienstvorschrift (PDV) 100 hervor. Die Arbeit untersucht die Stärken und Schwächen dieses seit den 1970er Jahren geltenden Systems im Kontext der Herausforderungen durch die Generationen Y und Z und der weiterentwickelten Forschung im Bereich der Personalführung. Die Forschungsfrage wird formuliert.
2 Begriffliche Einordnung: Dieses Kapitel befasst sich mit der begrifflichen Klärung der kooperativen Führung als Führungsstil. Es beschreibt die Einbindung der Mitarbeiter in die Ziel- und Aufgabenfindung, die gleichberechtigte Behandlung von Vorschlägen und die letztendliche Entscheidungsbefugnis der Führungskraft. Das Kapitel verortet den kooperativen Führungsstil im Führungsstilkontinuum nach Tannenbaum/Schmidt und hebt den Vorteil der Nutzung des Wissens und der Erfahrung der Mitarbeiter hervor. Weiterhin wird das kooperative Führungssystem (KFS) in der Polizei detailliert erklärt, einschließlich seiner sechs Kernelemente (Delegation, Beteiligung, Transparenz, Repräsentation, Kontrolle und Leistungsfeststellung/bewertung) und der zugrundeliegenden Annahme des Y-Menschenbildes nach McGregor.
3 Kooperative Führung in der Polizei: Dieses Kapitel analysiert die Verbindlichkeit des kooperativen Führungsstils in der Polizei, sowohl formal (durch die PDV 100 und die Entwicklung des KFS durch Altmann und Berndt) als auch informell. Es untersucht die Stärken und Schwächen des Systems im Kontext der Polizeiorganisation und identifiziert potentielle Probleme, die durch die Vorschrift eines bestimmten Führungsstils entstehen können. Die Kapitelteile zu Stärken und Schwächen werden detailliert beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kooperative Führung, Führungsstil, Polizeidienstvorschrift (PDV) 100, Kooperatives Führungssystem (KFS), Generation Y und Z, Autorität, Partizipation, Stärken, Schwächen, Personalführung, Organisation.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Kooperative Führung in der Polizei
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Stärken und Schwächen der verbindlichen Führungsverhaltensvorschrift zur kooperativen Führung in deutschen Polizeien. Sie analysiert die konzeptionellen Grundlagen und die praktische Umsetzung des kooperativen Führungssystems im Kontext der Polizeiorganisation.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die begriffliche Einordnung der kooperativen Führung, das kooperative Führungssystem in der Polizei, den formalen und informellen Aspekt der Verbindlichkeit des Führungsstils, eine Analyse der Stärken und Schwächen des Systems sowie alternative Forschungsansätze.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffliche Einordnung, Kooperative Führung in der Polizei, Forschungsansätze zu alternativen Lösungsmöglichkeiten und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der kooperativen Führung in der Polizei.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in das Thema der kooperativen Führung in der Polizei ein, beschreibt die Polizei als Organisation mit militärischen Wurzeln und traditionell autoritärem Führungsstil und hebt die verbindliche Vorschrift des kooperativen Führungssystems (KFS) in der Polizeidienstvorschrift (PDV) 100 hervor. Sie beschreibt die Herausforderungen durch die Generationen Y und Z und die weiterentwickelte Forschung im Bereich der Personalführung und formuliert die Forschungsfrage.
Wie wird die kooperative Führung begrifflich eingeordnet?
Kapitel 2 klärt den Begriff der kooperativen Führung als Führungsstil. Es beschreibt die Einbindung der Mitarbeiter in die Ziel- und Aufgabenfindung, die gleichberechtigte Behandlung von Vorschlägen und die letztendliche Entscheidungsbefugnis der Führungskraft. Es verortet den kooperativen Führungsstil im Führungsstilkontinuum nach Tannenbaum/Schmidt und hebt den Vorteil der Nutzung des Wissens und der Erfahrung der Mitarbeiter hervor. Das Kapitel erklärt detailliert das kooperative Führungssystem (KFS) in der Polizei, einschließlich seiner sechs Kernelemente und des zugrundeliegenden Y-Menschenbildes nach McGregor.
Wie wird die kooperative Führung in der Polizei analysiert?
Kapitel 3 analysiert die Verbindlichkeit des kooperativen Führungsstils in der Polizei, sowohl formal (durch die PDV 100 und die Entwicklung des KFS durch Altmann und Berndt) als auch informell. Es untersucht die Stärken und Schwächen des Systems im Kontext der Polizeiorganisation und identifiziert potentielle Probleme, die durch die Vorschrift eines bestimmten Führungsstils entstehen können. Die Stärken und Schwächen werden detailliert beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Kooperative Führung, Führungsstil, Polizeidienstvorschrift (PDV) 100, Kooperatives Führungssystem (KFS), Generation Y und Z, Autorität, Partizipation, Stärken, Schwächen, Personalführung und Organisation.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit behandelt?
Die präzise Forschungsfrage ist nicht explizit im gegebenen Text genannt, aber implizit geht es um die Effektivität und Herausforderungen der Umsetzung des verbindlichen kooperativen Führungsstils in der deutschen Polizei, insbesondere im Hinblick auf seine Stärken, Schwächen und die Kompatibilität mit der Polizeiorganisation und den Erwartungen jüngerer Generationen.
- Quote paper
- Simon Landmesser (Author), 2018, Kooperative Führung in der Polizei als verbindliche Führungsverhaltensvorschrift, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455657