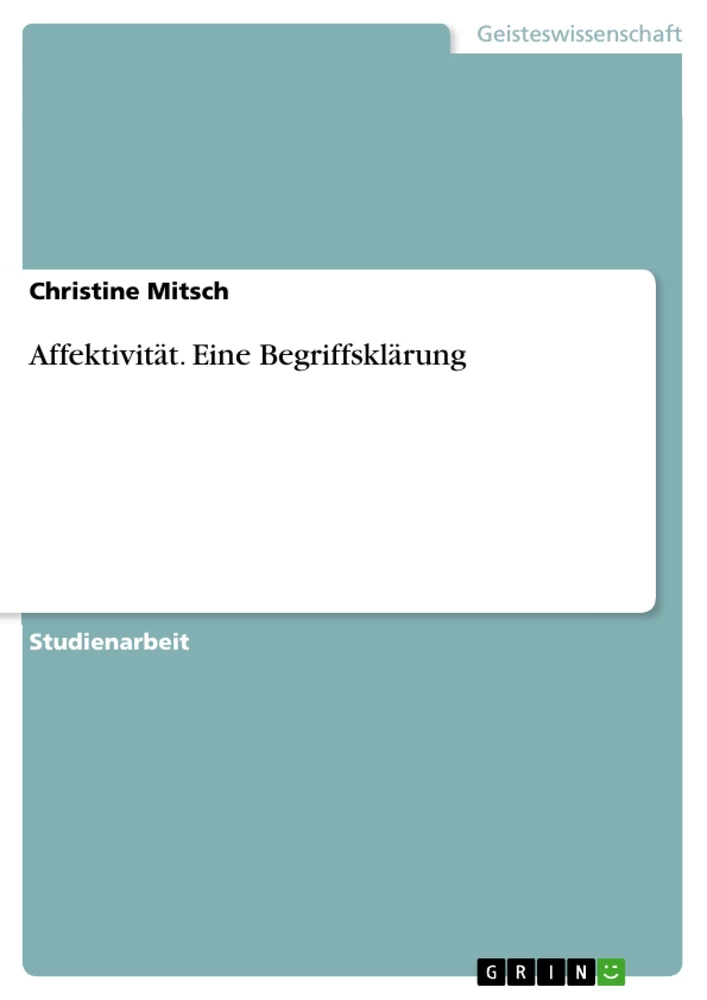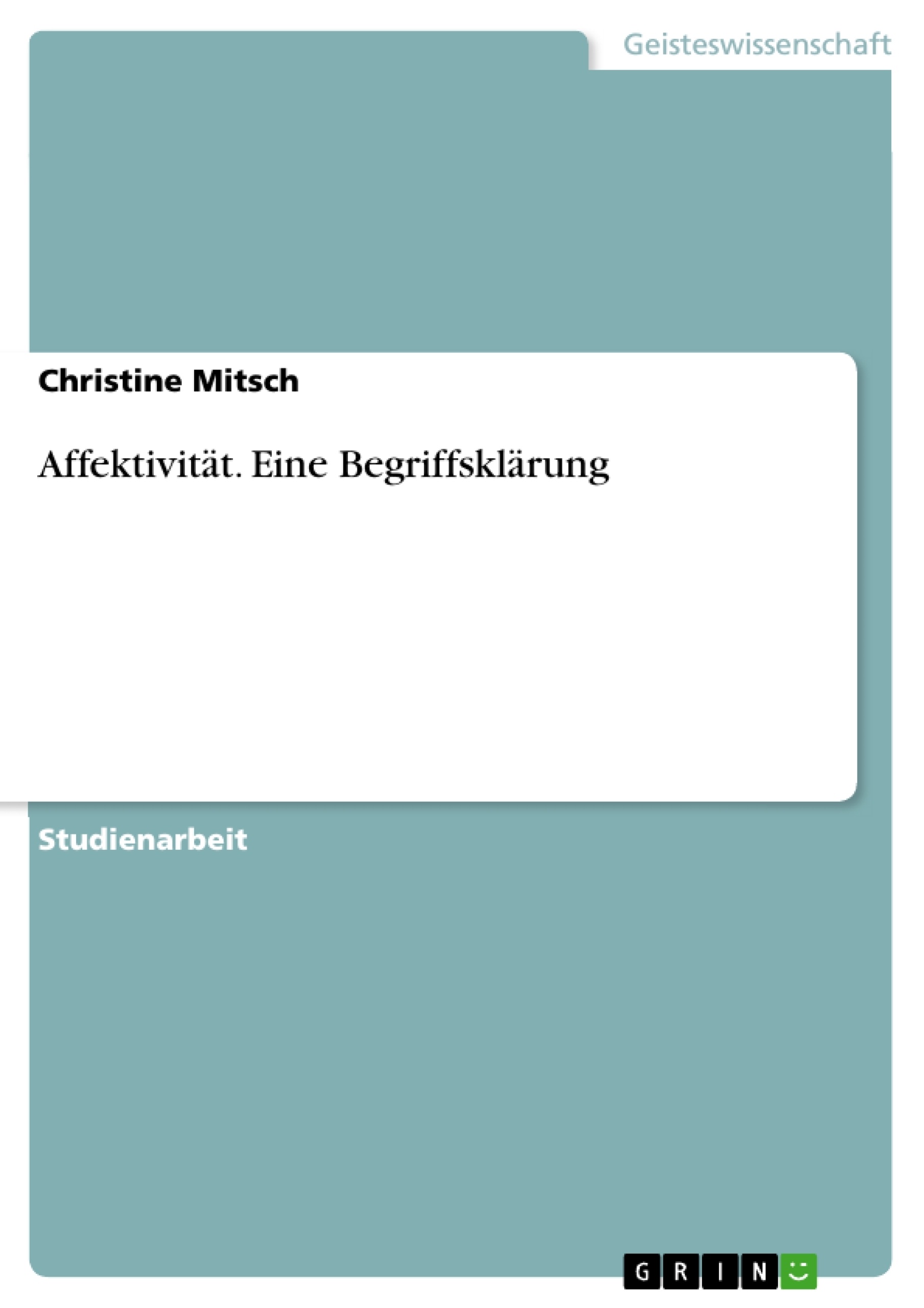Freude, Trauer, Zorn oder Neugier zählen zu den Gefühlen, die unter anderem das menschliche emotionale Erleben bestimmen. Sie können aus äußeren Einflüssen oder psychischen Prozessen im Menschen resultieren. Besonders intensive Ausprägungen dieser Gefühle werden Affekte genannt und können auffällige physische Begleiterscheinungen mit sich tragen, wie zum Beispiel Erröten aus Wut oder lautes Lachen vor Freude. Werden diese Affekte unkontrolliert aufgestaut und gebündelt losgelassen, können sie meist zu erheblichen physischen Schäden für die Umgebung, für andere oder für den/die Betroffene/n selbst führen. Die Folgen dieser Affekte werden Affekthandlungen, oder auch Explosiv- oder Kurzschlusshandlungen genannt und spielen im Strafrecht und der Persönlichkeitspsychologie eine bedeutende Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung
- Auswirkungen der Affektivität
- Affektive Störungen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Kurzbeitrag klärt den Begriff „Affektivität“ im Kontext der Wahrnehmungs- und Medienpsychologie. Ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis für Affektivität, ihre Auswirkungen und mögliche Störungen zu vermitteln.
- Begriffsbestimmung von Affektivität
- Auswirkungen von Affektivität auf körperliche und psychische Funktionen
- Klassifizierung und Charakterisierung affektiver Störungen
- Unterscheidung zwischen primären und sekundären Affektstörungen
- Zusammenhang zwischen Affekten und menschlichem Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Text beginnt mit einer Einführung in das Thema Affektivität, wobei intensive Gefühle wie Freude, Trauer oder Zorn als Beispiele genannt werden. Es wird auf die möglichen physischen Begleiterscheinungen und die potenziellen Folgen unkontrollierter Affekte, insbesondere im Kontext von Affekthandlungen, hingewiesen, die im Strafrecht und der Persönlichkeitspsychologie relevant sind.
Begriffserklärung: Dieses Kapitel erläutert den Begriff der Affektivität nach Eugen Bleuler, der Affekte mit dem gesamten Gefühls- und Gemütsleben, Stimmungen, Emotionen und Triebhaftigkeit verbindet. Affektivität wird als subjektives Erleben von Gefühlen beschrieben, das unser Handeln beeinflusst – positives wird angestrebt, negatives vermieden. Es wird auch der Aspekt der Gefühlsansprechbarkeit hervorgehoben, wobei Betroffene durch Affekte stark erregt und beeinflussbar sind, was zu verzerrter Wahrnehmung der Realität führen kann.
Auswirkungen der Affektivität: Hier werden die Auswirkungen der Affektivität auf körperliche Funktionen wie Motorik, Mimik, Körperhaltung und Gang beschrieben. Kurzzeitige äußerliche Auffälligkeiten wie Erröten, Erbleichen oder Pupillenerweiterung werden als Beispiele genannt. Der Text betont auch den gegenseitigen Einfluss: Körperliche Funktionen können sich wiederum auf das Gemütsleben auswirken (z.B. Schmerzen und Angst).
Affektive Störungen: Dieses Kapitel befasst sich mit affektiven Störungen als Störungen des Gefühls- und Gemütslebens, die sich durch gehobene (manische) oder gedrückte (depressive) Zustände auszeichnen. Unipolare und bipolare Störungen werden als Beispiele genannt. Der Text erläutert den Einfluss starker äußerer und innerer Einflüsse auf Stimmungen und Verstimmungen, die zu einer verzerrten Wahrnehmung führen können. Die Auswirkungen auf Gesundheit und Persönlichkeit werden ebenfalls diskutiert, einschließlich der Rolle affektiver Störungen als Grundsymptom der Schizophrenie.
Zusammenfassung: Der Text fasst den Begriff Affektivität als Erleben von Gefühlen und die darauf folgenden Reaktionen in Form von Stimmungen oder Verstimmungen zusammen. Die Ausprägung der Affektivität variiert von Person zu Person und kann unterschiedliche Auswirkungen auf Körper und Psyche haben.
Schlüsselwörter
Affektivität, Gefühlsansprechbarkeit, Affekte, Emotionen, Stimmungen, Affektive Störungen, unipolare Störungen, bipolare Störungen, Manie, Depression, körperliche Auswirkungen, psychische Auswirkungen, primäre Affektstörungen, sekundäre Affektstörungen.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Affektivität
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Affektivität in der Wahrnehmungs- und Medienpsychologie. Er erklärt den Begriff der Affektivität, beschreibt ihre Auswirkungen auf Körper und Psyche, und behandelt verschiedene Arten von affektiven Störungen. Der Text enthält eine Einleitung, eine Begriffserklärung, einen Abschnitt zu den Auswirkungen der Affektivität, einen zu affektiven Störungen und eine abschließende Zusammenfassung. Schlüsselbegriffe und ein Inhaltsverzeichnis erleichtern den Zugriff auf die Informationen.
Was versteht man unter Affektivität?
Der Text definiert Affektivität nach Eugen Bleuler als das gesamte Gefühls- und Gemütsleben, einschließlich Stimmungen, Emotionen und Triebhaftigkeit. Es beschreibt das subjektive Erleben von Gefühlen, das unser Handeln beeinflusst – positive Gefühle werden angestrebt, negative vermieden. Ein wichtiger Aspekt ist die Gefühlsansprechbarkeit: Wie stark ist eine Person durch Affekte beeinflussbar und erregbar? Eine hohe Gefühlsansprechbarkeit kann zu verzerrter Wahrnehmung führen.
Welche Auswirkungen hat Affektivität auf den Körper?
Affektivität beeinflusst körperliche Funktionen wie Motorik, Mimik, Körperhaltung und Gang. Der Text nennt Beispiele wie Erröten, Erbleichen oder Pupillenerweiterung. Es wird betont, dass der Einfluss wechselseitig ist: Körperliche Zustände (z.B. Schmerzen) können sich wiederum auf das Gemütsleben auswirken.
Welche Arten von affektiven Störungen werden beschrieben?
Der Text beschreibt affektive Störungen als Störungen des Gefühls- und Gemütslebens, die sich durch gehobene (manische) oder gedrückte (depressive) Zustände auszeichnen. Unipolare und bipolare Störungen werden als Beispiele genannt. Starke äußere und innere Einflüsse können Stimmungen und Verstimmungen beeinflussen und zu einer verzerrten Wahrnehmung führen. Die Auswirkungen auf die Gesundheit und Persönlichkeit werden ebenfalls diskutiert, inklusive der Rolle affektiver Störungen als Grundsymptom bei Schizophrenie.
Was ist der Unterschied zwischen primären und sekundären Affektstörungen?
Der Text unterscheidet zwischen primären und sekundären Affektstörungen, definiert diese aber nicht explizit. Es wird lediglich die Unterscheidung erwähnt als ein Thema, das behandelt werden sollte.
Welche Schlüsselwörter sind im Text relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Affektivität, Gefühlsansprechbarkeit, Affekte, Emotionen, Stimmungen, Affektive Störungen, unipolare Störungen, bipolare Störungen, Manie, Depression, körperliche Auswirkungen, psychische Auswirkungen, primäre Affektstörungen, sekundäre Affektstörungen.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist strukturiert mit einer Einleitung, einer Begriffserklärung, einem Abschnitt zu den Auswirkungen der Affektivität, einem Abschnitt zu affektiven Störungen und einer Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Liste der Schlüsselwörter erleichtern die Navigation.
- Citar trabajo
- Christine Mitsch (Autor), 2018, Affektivität. Eine Begriffsklärung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455397