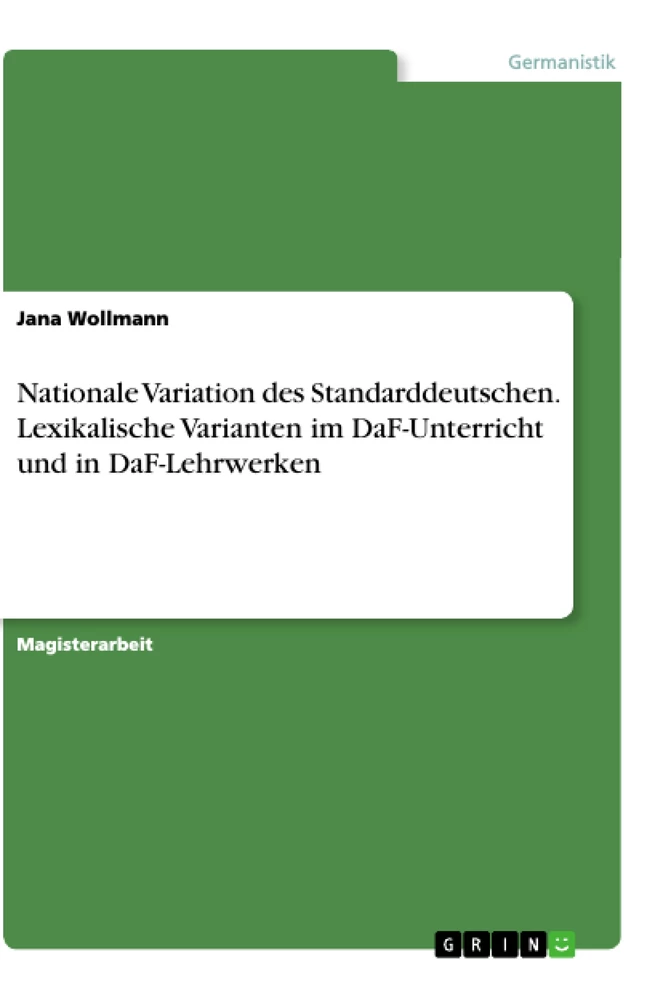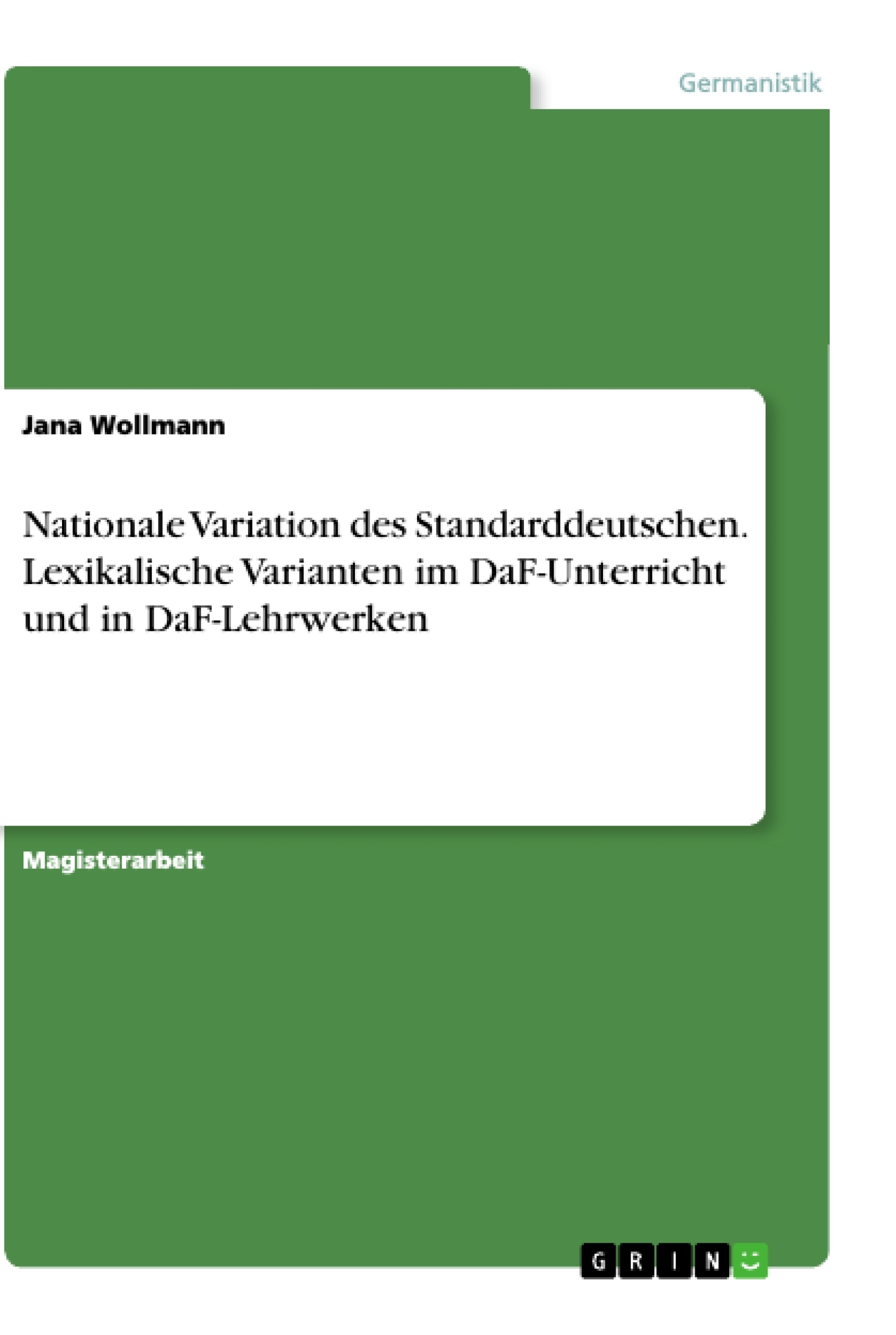In der vorliegenden Arbeit befassen wir uns mit der Erscheinung des Plurizentrismus in der deutschen Sprache und der nationalen Variation in dem lexikalischen Bereich. Lexikalische Varianten wecken das besondere Interesse, da die Besonderheiten in den einzelnen deutschsprachigen Ländern gerade ein Zentrum der plurizentrischen Sprache ausmachen. Sie finden sich insbesondere im Wortschatz einer Sprache. Der Schwerpunkt liegt in der Präsentation aller drei Standardvarietäten des Deutschen: österreichischen, schweizerischen und bundesdeutschen.
Mit dem Thema setzen wir uns vor allem aus der Sicht des Deutschen als Fremdsprache auseinander. Dabei soll den Fragen auf den Grund gegangen werden, welches Deutsch sollte im Rahmen des DaF-Unterrichts gelehrt werden und wie viel Variation verträgt ein DaF-Unterricht bzw. ein DaF-Lehrwerk? Inwiefern sei die Vermittlung der nationalen Varianten im Unterricht relevant. Ob und unter welchen Bedingungen sollten diese nationalen Varianten des Deutschen im DaF-Unterricht berücksichtigt werden? Welche Rolle spielen dabei die DaF-Lehrer als Normvermittler?
Das sind die Fragen, die nicht gleich und eindeutig beantwortet werden können. Das Thema interessiert uns als die Deutschlehrer, weil der DaF-Lehrer, der vor allem als Sprachexperte vor den Lernenden auftritt, über verschiedene sprachliche Register und über Kenntnisse von der nationalen und regionalen Variation verfügen müsste. Es soll mehr Bewusstsein dafür geweckt werden, dass es sich bei der deutschen Standardsprache keinesfalls um eine einheitliche und variationsfreie Sprache handelt, sondern um ein Gefüge aus den drei gleichwertigen Standardvarietäten. Wir hoffen, dass in der Zukunft mehr Aufmerksamkeit gegenüber den allen nationalen Varietäten geschenkt wird und die Plurizentrität der deutschen Sprache mehr betont wird.
Jede lebende Sprache schließt in sich eine Vielfalt unterschiedlichen Erscheinungsformen ein. Die Mannigfaltigkeit der deutschen Sprache ist ein Beispiel dazu. Die Vielfalt von Dialekten und Varietäten, verschiedener Gruppensprachen, Varianten der gesprochenen und geschriebenen Sprache ist kennzeichnend für sie. Deutsch gehört auch zur Gruppe der Sprachen, die in unterschiedlichen Nationen gesprochen werden, in jeweiliger Nation besondere Formen auf allen sprachlichen Ebenen gebildet haben und über mehrere kodifizierte Standardvarietäten verfügen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Deutsch als eine plurizentrische, plurinationale und plurireale Sprache
- 1.1 Varietät und Varianten
- 1.2 Standardvarietät
- 1.3 Das Dialekt-Standard-Kontinuum
- 1.4 Nationale Standardvarietät von Österreich
- 1.5 Nationale Standardvarietät von der Schweiz
- 1.6 Nationale Standardvarietät von Deutschland
- 1.7 Sprachsituation in den Halbzentren
- 1.8 Asymmetrie zwischen den Vollzentren
- 1.9 Zusammenfassung
- 2. Variation Norm - Standard
- 2.1 Variation
- 2.2 Sprachnormen und ihre Funktionen
- 2.3 Zum Begriff Standard und seiner Grenzbestimmung
- 3. Nationale lexikalische Variation im Rahmen des DaF-Unterrichts
- 3.1 Argumente für die Vermittlung der nationalen Varianten im DaF-Unterricht
- 3.2 Argumente dagegen
- 3.3 Der plurizentrische Ansatz im DaF-Unterricht
- 3.4 DaF- vs. DaZ-Unterricht
- 4. Nationale lexikalische Variation in DaF-Lehrwerken
- 4.1 Verwendung authentischer Materialien
- 4.2 Additiver vs. integrativer Ansatz
- 4.3 Ausgewählte Lehrwerke
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Plurizentrismus der deutschen Sprache und die damit verbundene nationale lexikalische Variation, insbesondere im Kontext des Deutsch als Fremdsprache (DaF)-Unterrichts. Es werden die drei nationalen Standardvarietäten (Österreich, Schweiz, Deutschland) verglichen und deren Bedeutung für den DaF-Unterricht diskutiert. Die zentrale Frage ist, wie der plurizentrische Ansatz im DaF-Unterricht und in DaF-Lehrwerken umgesetzt werden kann.
- Plurizentrismus der deutschen Sprache
- Nationale lexikalische Variation im Deutschen
- Der Umgang mit Varietäten im DaF-Unterricht
- Analyse von DaF-Lehrwerken bezüglich der Berücksichtigung nationaler Varianten
- Didaktische Implikationen des Plurizentrismus für den DaF-Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Plurizentrismus der deutschen Sprache ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf die nationale lexikalische Variation und deren Bedeutung für den DaF-Unterricht. Sie hebt die Bedeutung der drei Standardvarietäten (Österreich, Schweiz, Deutschland) hervor und benennt zentrale Forschungsfragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Einleitung stellt die Forschungslücke dar, die diese Arbeit zu schließen versucht, nämlich die umfassende Betrachtung der nationalen Varianten im DaF-Unterricht und die Analyse ihrer Berücksichtigung in Lehrwerken.
1. Deutsch als eine plurizentrische, plurinationale und plurireale Sprache: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in die Konzepte von Plurizentrizität, Varietät und Standardvarietät im Deutschen. Es definiert die Begriffe und differenziert zwischen den nationalen Standardvarietäten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Es wird auf die sprachliche Situation in den Halbzentren eingegangen und die Asymmetrie zwischen den Sprachzentren analysiert. Das Kapitel bildet die theoretische Grundlage für die folgenden Kapitel und stellt die Vielfalt der deutschen Sprache dar. Es beleuchtet den historischen Kontext der Etablierung des Begriffs "plurizentrische Sprache" und zeigt die Bedeutung von Wissenschaftlern wie Clyne und Ammon auf.
2. Variation Norm - Standard: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Begriffen Variation, Norm und Standard und ihren Beziehungen zueinander. Es analysiert, wie diese Konzepte im Kontext des Plurizentrismus der deutschen Sprache zu verstehen sind und welche Implikationen sie für den DaF-Unterricht haben. Es legt den Fokus auf die verschiedenen Normen und deren Funktionen in den drei Standardvarietäten und wie diese ineinander greifen. Es wird zudem die komplexe Interaktion zwischen Standardsprache und nicht-Standardvarietäten beleuchtet.
3. Nationale lexikalische Variation im Rahmen des DaF-Unterrichts: Kapitel 3 widmet sich der Frage, wie die nationale lexikalische Variation im DaF-Unterricht berücksichtigt werden sollte. Es diskutiert Argumente für und gegen die Vermittlung nationaler Varianten und präsentiert den plurizentrischen Ansatz als didaktisches Konzept. Es untersucht den Unterschied zwischen DaF- und DaZ-Unterricht im Umgang mit Varietäten und analysiert bestehende Forschungsergebnisse. Es werden konkrete Umsetzungsmöglichkeiten des plurizentrischen Ansatzes im Unterricht erörtert.
4. Nationale lexikalische Variation in DaF-Lehrwerken: Das vierte Kapitel analysiert die Berücksichtigung nationaler Varianten in DaF-Lehrwerken. Es untersucht den Stellenwert des plurizentrischen Ansatzes bei der Auswahl von Lernmaterialien und beleuchtet die Frage, inwieweit die nationalen Varianten in Lehrwerken berücksichtigt werden. Es wird die Rolle authentischer Materialien diskutiert, und es werden verschiedene didaktische Ansätze (additiv vs. integrativ) verglichen. Konkrete Beispiele aus ausgewählten Lehrwerken werden analysiert.
Schlüsselwörter
Plurizentrismus, nationale Standardvarietäten, Deutsch als Fremdsprache (DaF), lexikalische Variation, Varietäten, Sprachnormen, Standardsprache, DaF-Unterricht, DaF-Lehrwerke, didaktische Implikationen, Österreichisches Deutsch, Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, pluriregional, Sprachbewusstsein.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Nationale Lexikalische Variation im DaF-Unterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Plurizentrismus der deutschen Sprache und die damit verbundene nationale lexikalische Variation, insbesondere im Kontext des Deutsch als Fremdsprache (DaF)-Unterrichts. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der drei nationalen Standardvarietäten (Österreich, Schweiz, Deutschland) und der Diskussion ihrer Bedeutung für den DaF-Unterricht. Zentrale Frage ist die Umsetzung des plurizentrischen Ansatzes im DaF-Unterricht und in DaF-Lehrwerken.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Plurizentrismus der deutschen Sprache, nationale lexikalische Variation im Deutschen, der Umgang mit Varietäten im DaF-Unterricht, Analyse von DaF-Lehrwerken bezüglich der Berücksichtigung nationaler Varianten und didaktische Implikationen des Plurizentrismus für den DaF-Unterricht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Eine Einleitung, ein Kapitel über Deutsch als plurizentrische, plurinationale und plurireale Sprache (inkl. Varietäten, Standardvarietäten und den nationalen Standardvarietäten von Deutschland, Österreich und der Schweiz), ein Kapitel zu Variation, Norm und Standard, ein Kapitel zur nationalen lexikalischen Variation im DaF-Unterricht (inkl. Argumente für und gegen die Vermittlung nationaler Varianten und dem plurizentrischen Ansatz) und ein Kapitel zur nationalen lexikalischen Variation in DaF-Lehrwerken (inkl. Analyse von Lehrwerken und didaktischen Ansätzen).
Was versteht man unter Plurizentrismus der deutschen Sprache?
Plurizentrismus beschreibt die Tatsache, dass Deutsch in verschiedenen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz) als Nationalsprache mit jeweils eigenen Standardvarietäten existiert. Diese Varietäten weisen nationale Unterschiede in Wortschatz, Grammatik und Aussprache auf.
Welche Bedeutung hat der Plurizentrismus für den DaF-Unterricht?
Der Plurizentrismus hat erhebliche Bedeutung für den DaF-Unterricht. Die Frage ist, wie die nationalen Varietäten im Unterricht berücksichtigt werden sollen. Die Arbeit diskutiert Argumente für und gegen die explizite Vermittlung nationaler Varianten und präsentiert den plurizentrischen Ansatz als didaktisches Konzept, der die Vielfalt der deutschen Sprache berücksichtigt.
Wie wird der plurizentrische Ansatz in DaF-Lehrwerken umgesetzt?
Die Arbeit analysiert die Berücksichtigung nationaler Varianten in DaF-Lehrwerken. Dabei wird untersucht, ob und wie der plurizentrische Ansatz in der Auswahl von Lernmaterialien und der Darstellung der Sprache umgesetzt wird. Die Rolle authentischer Materialien und verschiedene didaktische Ansätze (additiv vs. integrativ) werden verglichen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Plurizentrismus, nationale Standardvarietäten, Deutsch als Fremdsprache (DaF), lexikalische Variation, Varietäten, Sprachnormen, Standardsprache, DaF-Unterricht, DaF-Lehrwerke, didaktische Implikationen, Österreichisches Deutsch, Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, pluriregional, Sprachbewusstsein.
Welche Forschungslücke schließt diese Arbeit?
Die Arbeit schließt die Forschungslücke einer umfassenden Betrachtung der nationalen Varianten im DaF-Unterricht und der Analyse ihrer Berücksichtigung in Lehrwerken.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit beantwortet?
Die Arbeit befasst sich mit der zentralen Frage, wie der plurizentrische Ansatz im DaF-Unterricht und in DaF-Lehrwerken umgesetzt werden kann. Diese Frage wird durch die Analyse der nationalen Standardvarietäten, der Diskussion unterschiedlicher didaktischer Ansätze und der Untersuchung von DaF-Lehrwerken beantwortet.
- Quote paper
- Jana Wollmann (Author), 2013, Nationale Variation des Standarddeutschen. Lexikalische Varianten im DaF-Unterricht und in DaF-Lehrwerken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455197