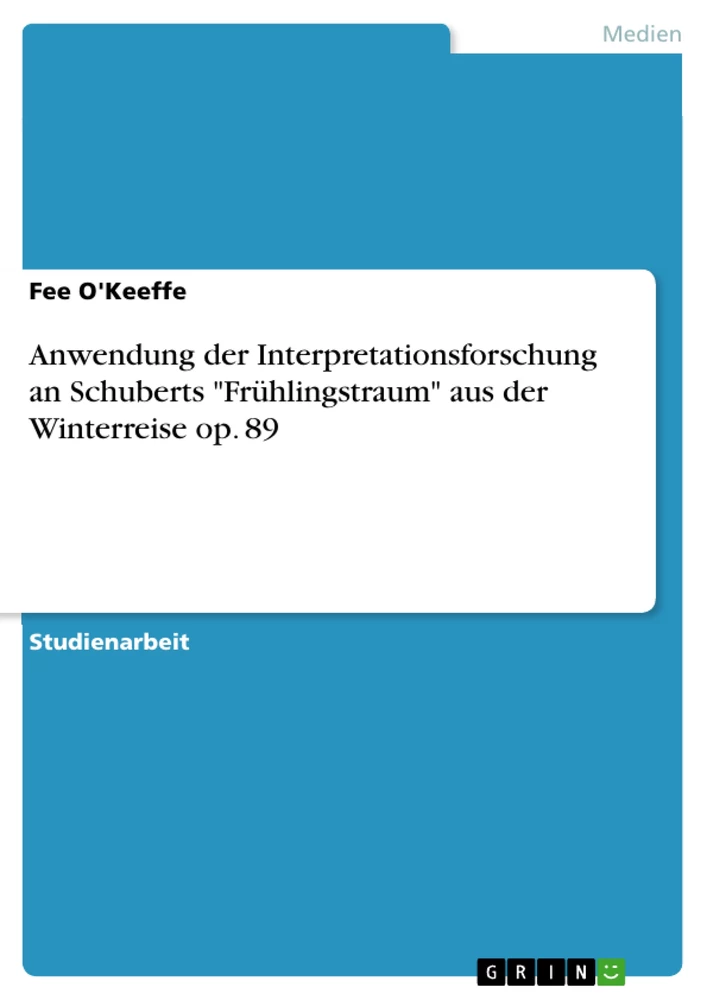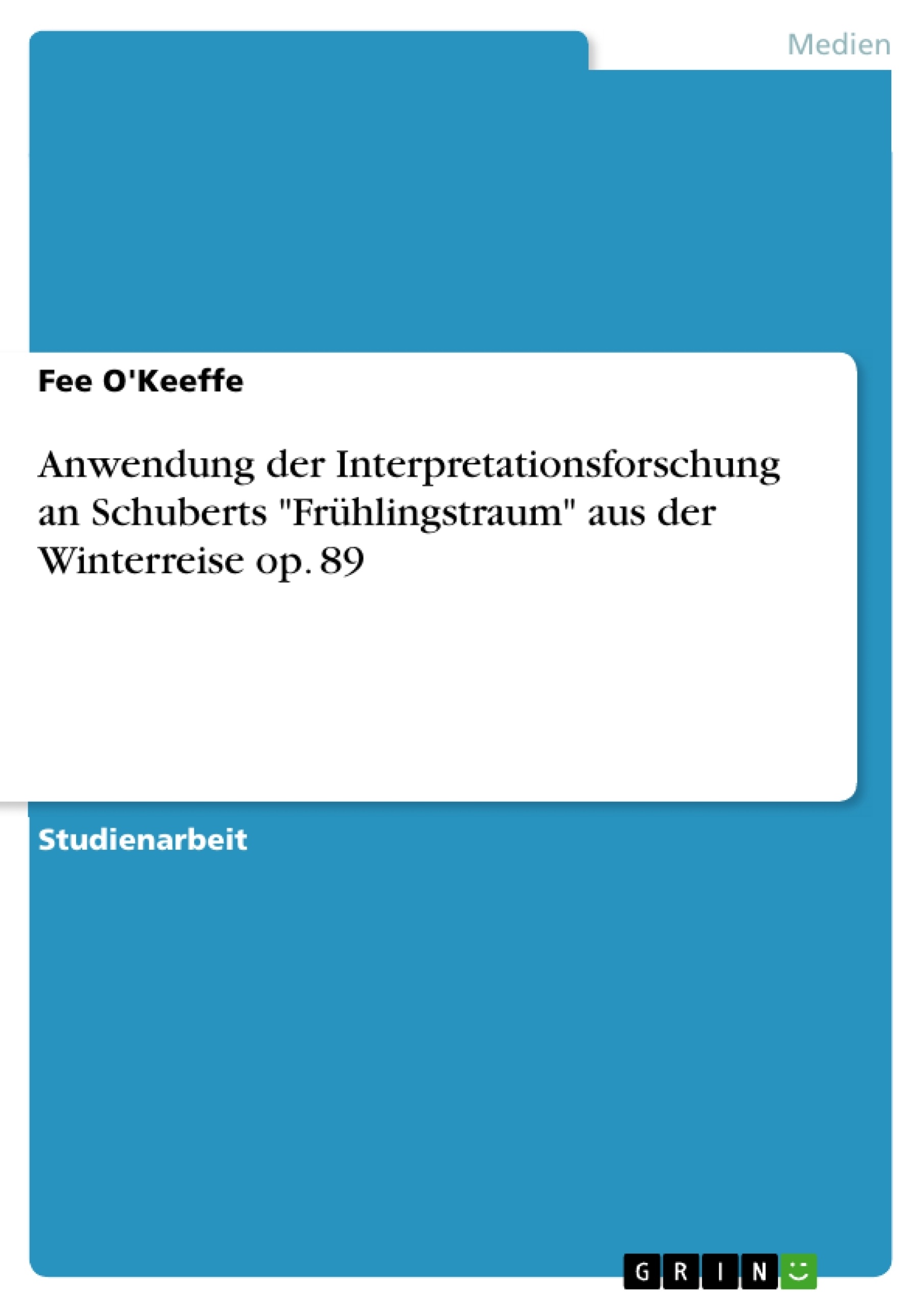Was ist Interpretationsforschung und welche Erkenntnisse lassen sich mit ihrer Hilfe über Musikstücke gewinnen?
Mit diesen zwei Frageansätzen lässt sich kurz und knapp der Inhalt der vorliegenden Arbeit umreißen: hier soll es darum gehen, den noch recht jungen Zweig der Musikwissenschaft "Interpretationsforschung" mit seinen Inhalten und Zielen kurz vorzustellen.
Im Anschluss daran soll Schuberts "Frühlingstraum" aus der Winterreise, op. 89, in Gestalt verschiedener Einspielungen untersucht werden, um einen praktischen Beitrag zur Interpretationsforschung zu leisten.
Anders als in den anderen Zweigen der schönen Künste ist in der Musik das „Werk“ schwer zu fassen. Es hat keinen Bestand in Form eines vom Künstler zum Beispiel selbst geschaffenen Bildes oder einer Statue. Was aber ist „das“ musikalische Werk? Die Interpretationsforschung operiert mit einem offenen Werkbegriff. Für sie besteht nicht „das“ musikalische Werk, erst recht nicht in Form seiner schriftlichen Codierung, des Notentextes. Stattdessen ist das Werk ein musikalisches, klingendes Erzeugnis mit hohem Facettenreichtum und ist hierin stets angewiesen auf seine vortragenden Interpreten.
Eben diese Angewiesenheit auf seine Interpreten setzt das Werk stets einer hohen Subjektivität aus. Denn jede Vortragsweise – mag sie gelungen sein oder nicht– ist nur eine von vielen Möglichkeiten, den Notentext zu decodieren und der Autorintention, also der Idee des Komponisten, nachzuspüren.
In diesem Spannungsfeld zwischen Autorintention und Interpretensubjektivität bewegt sich nun die Interpretationsforschung. Beides ist im hohen Maße abhängig voneinander „insofern eine kompositorische Autorintention ohne eine sie deutende Interpretensubjektivität tot bliebe“ – da das Werk nicht zum Erklingen käme und damit keinen Bestand hätte – „eine Interpretensubjektivität ohne Autorintention aber gegenstandlos“ – in anderen Worten, dass die Grenze des Facettenreichtums eines Werkes eingehalten werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte
- Interpretationsforschung
- Eine kurze Analyse
- Die Einspielungen
- Die Herangehensweise
- Die einzelnen Interpretationen
- Die Interpretationen im Vergleich
- Schlusswort
- Anhang
- Frühlingstraum von Wilhelm Müller
- Analyseübersicht
- Einspielungen nach Jahr sortiert
- Einspielungen nach Dauer sortiert
- Diskographie
- Bariton und Tenor
- Sopran und Mezzosopran
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat zum Ziel, die Interpretationsforschung als Teilgebiet der Musikwissenschaft vorzustellen und anhand verschiedener Einspielungen von Schuberts "Frühlingstraum" aus der "Winterreise" zu veranschaulichen. Es wird untersucht, wie Interpreten den Notentext in ihrer eigenen subjektiven Weise umsetzen und wie sich diese Interpretationen im Vergleich zueinander darstellen.
- Einführung in die Interpretationsforschung und ihren Werkbegriff
- Analyse von Schuberts "Frühlingstraum"
- Vergleichende Betrachtung verschiedener Interpretationen des Liedes
- Die Rolle der Interpretensubjektivität
- Der Einfluss von historischem Kontext und Tradition auf die Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Worte: Die Einleitung skizziert den Inhalt der Arbeit, der sich auf die Interpretationsforschung und deren Anwendung auf Schuberts "Frühlingstraum" konzentriert. Es werden die zentralen Fragestellungen formuliert, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen: Was ist Interpretationsforschung und welche Erkenntnisse lassen sich durch sie über Musikstücke gewinnen?
Interpretationsforschung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Interpretationsforschung und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus dem offenen Werkbegriff in der Musik ergeben. Es wird der Spannungsbogen zwischen Autorintention und Interpretensubjektivität diskutiert und die Rolle des historischen Kontextes und der Interpretationstradition hervorgehoben. Die Interpretationsforschung wird als ein Prozess der Erforschung der verschiedenen Facetten eines musikalischen Werkes im Laufe seiner Geschichte dargestellt.
Eine kurze Analyse: Diese kurze Analyse des "Frühlingstraums" konzentriert sich auf die Hauptmerkmale des Liedes, die für die unterschiedlichen Interpretationen relevant sind. Es wird die dreiteilige Struktur des Liedes beschrieben und die musikalischen Elemente, wie z.B. die Harmonik, kurz angerissen, um den interpretatorischen Freiraum für die Sänger und Pianisten zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Interpretationsforschung, Schubert, Winterreise, Frühlingstraum, Musikwissenschaft, Interpretensubjektivität, Autorintention, musikalische Analyse, Einspielungen, Vergleich, historischer Kontext, Tradition.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Interpretationsforschung am Beispiel von Schuberts Frühlingstraum"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Interpretationsforschung im Bereich der Musikwissenschaft anhand verschiedener Einspielungen von Franz Schuberts "Frühlingstraum" aus der "Winterreise". Sie beleuchtet, wie Interpreten den Notentext subjektiv umsetzen und wie sich diese Interpretationen vergleichen lassen. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Einführung in die Interpretationsforschung, eine kurze Analyse des "Frühlingstraums", einen Vergleich verschiedener Interpretationen, ein Schlusswort, sowie einen Anhang mit der Liedtext, Übersichten der Einspielungen und eine Diskographie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der Interpretationsforschung, wie den Werkbegriff, die Autorintention, die Interpretensubjektivität, den Einfluss des historischen Kontextes und der Tradition auf die Interpretation. Sie analysiert Schuberts "Frühlingstraum" und vergleicht verschiedene Interpretationen dieses Liedes, um die Bandbreite interpretatorischer Möglichkeiten aufzuzeigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitende Worte, Interpretationsforschung, Eine kurze Analyse des Frühlingstraums, Die Einspielungen (inkl. Herangehensweise, Einzelinterpretationen und Vergleich), Schlusswort, Anhang (mit Frühlingstraum-Text, Analyseübersicht, Einspielungslisten sortiert nach Jahr und Dauer) und Diskographie (Bariton/Tenor und Sopran/Mezzosopran).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Interpretationsforschung als Teilgebiet der Musikwissenschaft vorzustellen und anhand des "Frühlingstraums" zu veranschaulichen. Sie möchte zeigen, wie Interpreten den Notentext individuell gestalten und wie sich diese individuellen Interpretationen im Vergleich zueinander darstellen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Interpretationsforschung, Schubert, Winterreise, Frühlingstraum, Musikwissenschaft, Interpretensubjektivität, Autorintention, musikalische Analyse, Einspielungen, Vergleich, historischer Kontext, Tradition.
Was wird im Kapitel "Eine kurze Analyse" behandelt?
Das Kapitel "Eine kurze Analyse" konzentriert sich auf die Hauptmerkmale des "Frühlingstraums", die für die verschiedenen Interpretationen relevant sind. Es beschreibt die dreiteilige Struktur des Liedes und skizziert kurz musikalische Elemente wie die Harmonik, um den interpretatorischen Freiraum für Sänger und Pianisten zu verdeutlichen.
Wie wird der historische Kontext berücksichtigt?
Der historische Kontext und die Interpretationstradition spielen eine wichtige Rolle in der Arbeit. Sie beeinflussen die Art und Weise, wie ein Musikstück interpretiert wird und werden im Kontext der Interpretationsforschung diskutiert.
Was beinhaltet der Anhang?
Der Anhang enthält den vollständigen Text von Schuberts "Frühlingstraum", Übersichten der analysierten Einspielungen (sortiert nach Jahr und Dauer) und eine detaillierte Diskographie mit Angaben zu den Interpreten (Bariton/Tenor und Sopran/Mezzosopran).
- Quote paper
- Fee O'Keeffe (Author), 2017, Anwendung der Interpretationsforschung an Schuberts "Frühlingstraum" aus der Winterreise op. 89, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455152