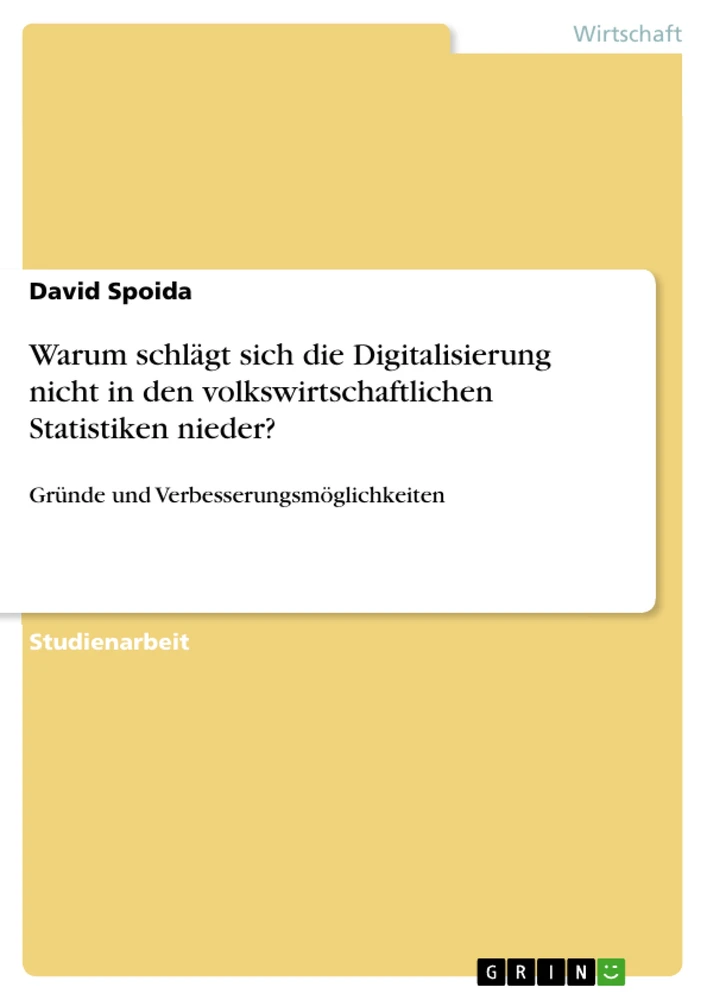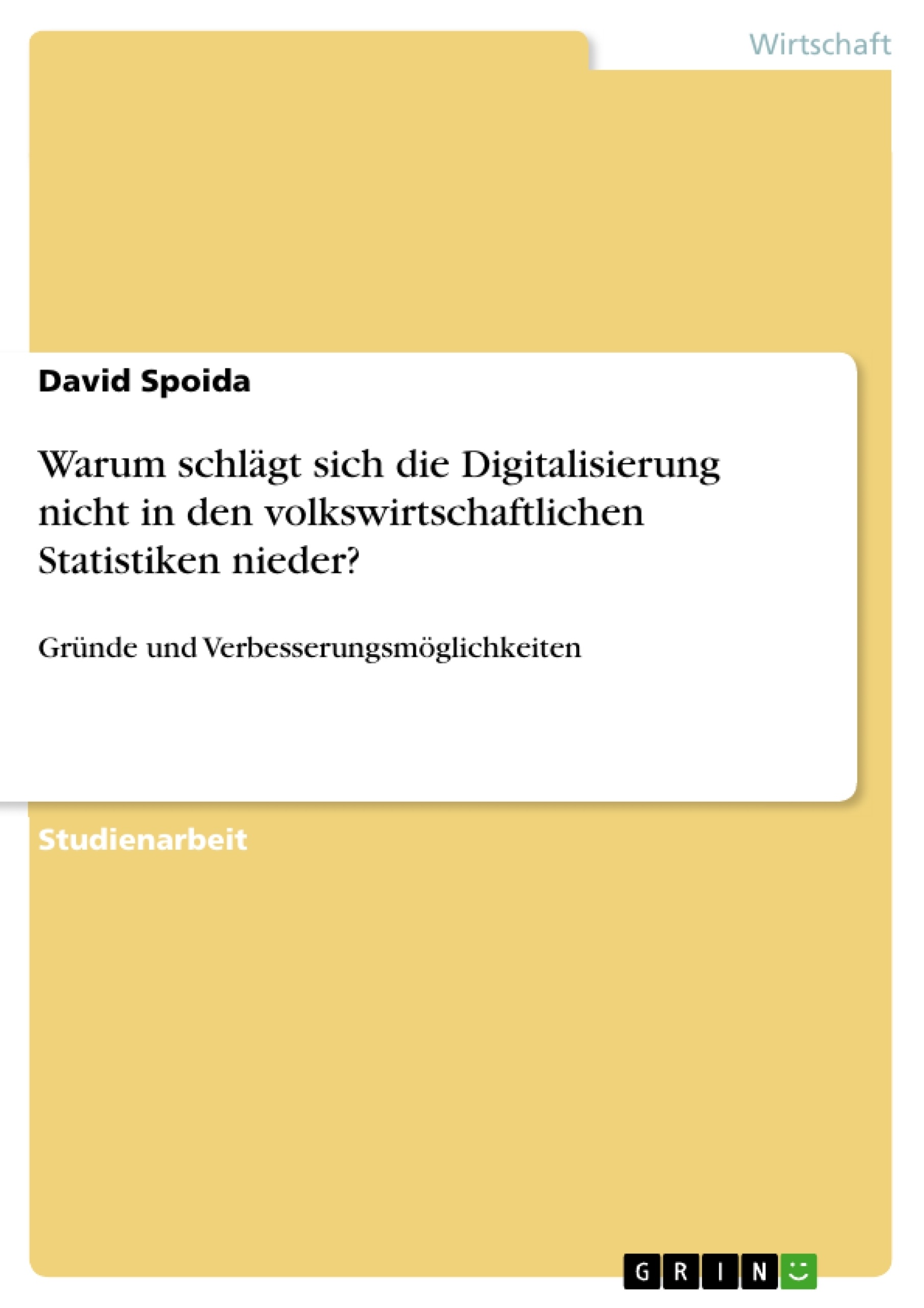Die Digitalisierung bietet den Wirtschaftssubjekten einer Volkswirtschaft große Chancen. Für Haushalte ist es die intelligente Vernetzung der Heimtechnik, für Unternehmen bieten sich neue Möglichkeiten, die Kundenbedürfnisse noch besser zu befriedigen und Prozesse zu optimieren. Auch den Staaten könnte die Digitalisierung zusätzliches Wirtschaftswachstums bringen. Begleitet werden die Chancen jedoch auch von Risiken wie Cyber-Kriminalität, hohen Investments zu Beginn und einer mangelnden Grundausbildung im Bereich Digitalisierung. Dabei sind die ökonomischen Effekte vielseitig. Diese zeigen sich beispielsweise in den sinkenden Transaktionskosten für die Haushalte.
Trotz oft positiver wirtschaftlicher Effekte wird die Digitalisierung nicht ausreichend von der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) erfasst und stellt im Zuge dessen die Aussagekraft des BIPs in Frage. Grund dafür sind bspw. kostenlose Online Nachrichtenportale, die Printmedien ablösen. Durch Online-Portale hat die Gesellschaft einen schnelleren, günstigeren und einfacheren Zugang zu Informationen. Die sinkende Nachfrage nach Printmedien führt in diesem Bereich zu Umsatzrückgängen. Dieser Rückgang führt wiederum zu einer geringeren Wertschöpfung der Marktwerte.
Nicht nur digitale Produkte, sondern auch der Wert von Daten oder User-Generated-Content lassen die Konsumentenrente auf der einen Seite steigen, auf der anderen Seite aber das BIP sinken. Würde man etwa die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten für kostenlose digitale Produkte analysieren, könnte man darüber die Konsumentenrente abbilden. Außerdem trägt die Digitalisierung durch die steigenden Konsumentenrenten zum wachsenden subjektiven Wohlbefinden der Menschheit bei. Im Rahmen der Glücksforschung kann man feststellen, welche Faktoren die Menschen wirklich glücklicher macht. Dadurch könnte man die Veränderung des subjektiven Wohlbefindens feststellen.
Das BIP als Indikator für Wohlstand ist eine unabdingbare Größe zur Feststellung von Wirtschaftswachstum. Gleichwohl ist die Aussagekraft aber begrenzt und sollte daher durch die Veränderung der Konsumentenrente und des subjektiven Wohlbefindens ergänzt werden. Dieser Umstand würde die Effekte der Digitalisierung berücksichtigen und eine vollständige Abbildung der komplexen Realität gewährleisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die ökonomischen Effekte der Digitalisierung
- Sinkende Transaktionskosten für Privatpersonen und Unternehmen
- Sinkende Grenzkosten
- Schnelle Multiplikation
- Grenzenlose Reichweite
- Grundlagen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
- Bruttoinlandsprodukt
- Das Wohlbefinden der Gesellschaft als Indikator
- Gründe für die volkswirtschaftliche Nichterfassung der Digitalisierung
- Der Wert der Informationen und Daten
- Neue digitale Produkte und Dienstleistungen
- Interaktionen sind wichtiger als Transaktionen
- Die steigende Rechenleistung und der Trend zu Cloud-Servern
- Digitale Plattformen und Self-Service
- Der Wertbeitrag der Sharing Economy
- Die Steueroptimierung von multinationalen Unternehmen
- Umstrukturierungskosten zu Gunsten der Digitalisierung
- Die verzögerte Wirkung von GPT
- Verbesserungsmöglichkeiten
- Ermittlung der Zahlungsbereitschaft
- Zeiterfassung
- Glücksforschung
- Digitale Produkte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Gründe, warum sich die Digitalisierung nicht ausreichend in den volkswirtschaftlichen Statistiken widerspiegelt. Sie analysiert die ökonomischen Effekte der Digitalisierung und die Herausforderungen bei deren Erfassung in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Ziel ist es, Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um die Auswirkungen der Digitalisierung genauer zu erfassen.
- Ökonomische Effekte der Digitalisierung (z.B. sinkende Transaktionskosten, steigende Rechenleistung)
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und deren Limitationen bezüglich der Digitalisierung
- Herausforderungen bei der Bewertung digitaler Güter und Dienstleistungen
- Der Einfluss von Digitalisierung auf das gesellschaftliche Wohlbefinden
- Möglichkeiten zur Verbesserung der statistischen Erfassung der Digitalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt die Problematik der unzureichenden Erfassung der Digitalisierung in volkswirtschaftlichen Statistiken. Sie skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit.
Die ökonomischen Effekte der Digitalisierung: Dieses Kapitel beleuchtet die zentralen ökonomischen Effekte der Digitalisierung, wie sinkende Transaktionskosten, fallende Grenzkosten, schnelle Multiplikationseffekte und eine grenzenlose Reichweite. Es wird dargelegt, wie diese Effekte Unternehmen und Konsumenten beeinflussen und welche Herausforderungen sie für die ökonomische Modellierung darstellen. Die Darstellung veranschaulicht die grundlegende Transformation, die die Digitalisierung in der Wirtschaft bewirkt.
Grundlagen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die Grundlagen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) und erläutert wichtige Kennzahlen wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Es wird insbesondere auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die die Digitalisierung für die traditionelle VGR mit sich bringt, da diese auf physischen Gütern und Transaktionen basiert. Der Fokus liegt auf der Problematik, immaterielle Güter und Dienstleistungen adäquat zu erfassen und das gesellschaftliche Wohlbefinden angemessen abzubilden.
Gründe für die volkswirtschaftliche Nichterfassung der Digitalisierung: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Gründe, warum die Digitalisierung in der VGR nur unzureichend erfasst wird. Es werden Themen wie die Schwierigkeit der Bewertung von Informationen und Daten, die Herausforderungen bei der Erfassung neuer digitaler Produkte und Dienstleistungen, die Bedeutung von Interaktionen gegenüber Transaktionen, der Einfluss steigender Rechenleistung und Cloud-Computing, der Wertbeitrag der Sharing Economy und die Steueroptimierung multinationaler Unternehmen diskutiert. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, die zeigen, wie komplex die Berücksichtigung der Digitalisierung in ökonomischen Modellen ist.
Verbesserungsmöglichkeiten: Das Kapitel geht auf verschiedene Möglichkeiten ein, die Erfassung der Digitalisierung in der VGR zu verbessern. Es werden Lösungsansätze wie die Ermittlung der Zahlungsbereitschaft für digitale Güter, die Erfassung der Zeiteinsparungen durch digitale Technologien, der Einbezug der Glücksforschung und die Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften digitaler Produkte in der Statistik diskutiert. Die Kapitel unterstreicht die Notwendigkeit innovativer Messmethoden, um den tatsächlichen Wertbeitrag der Digitalisierung für die Wirtschaft und Gesellschaft abzubilden.
Schlüsselwörter
Digitale Transformation, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Bruttoinlandsprodukt, Digitalisierung, Informationsökonomie, Immaterielle Güter, Datenbewertung, Sharing Economy, Cloud Computing, Statistische Erfassung, Produktivitätsmessung, Wohlfahrtsmessung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Die Volkswirtschaftliche Nichterfassung der Digitalisierung
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht, warum die Digitalisierung in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) unzureichend erfasst wird. Sie analysiert die ökonomischen Effekte der Digitalisierung und die Herausforderungen bei deren Erfassung in der VGR, um Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Welche ökonomischen Effekte der Digitalisierung werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet zentrale ökonomische Effekte wie sinkende Transaktionskosten, fallende Grenzkosten, schnelle Multiplikationseffekte und grenzenlose Reichweite. Es wird gezeigt, wie diese Effekte Unternehmen und Konsumenten beeinflussen und welche Herausforderungen sie für die ökonomische Modellierung darstellen.
Welche Grundlagen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung werden behandelt?
Die Hausarbeit gibt einen Überblick über die Grundlagen der VGR und wichtige Kennzahlen wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Es werden die Schwierigkeiten erläutert, die die Digitalisierung für die traditionelle VGR mit sich bringt, insbesondere die adäquate Erfassung immaterieller Güter und Dienstleistungen und die Abbildung des gesellschaftlichen Wohlbefindens.
Warum wird die Digitalisierung in der VGR nicht ausreichend erfasst?
Die Arbeit analysiert verschiedene Gründe, darunter die Schwierigkeit der Bewertung von Informationen und Daten, die Erfassung neuer digitaler Produkte und Dienstleistungen, die Bedeutung von Interaktionen gegenüber Transaktionen, der Einfluss steigender Rechenleistung und Cloud-Computing, der Wertbeitrag der Sharing Economy und die Steueroptimierung multinationaler Unternehmen.
Welche Verbesserungsmöglichkeiten zur Erfassung der Digitalisierung werden vorgeschlagen?
Die Hausarbeit schlägt Lösungsansätze vor, wie die Ermittlung der Zahlungsbereitschaft für digitale Güter, die Erfassung der Zeiteinsparungen durch digitale Technologien, der Einbezug der Glücksforschung und die Berücksichtigung spezifischer Eigenschaften digitaler Produkte in der Statistik. Es wird die Notwendigkeit innovativer Messmethoden betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Digitale Transformation, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Bruttoinlandsprodukt, Digitalisierung, Informationsökonomie, Immaterielle Güter, Datenbewertung, Sharing Economy, Cloud Computing, Statistische Erfassung, Produktivitätsmessung, Wohlfahrtsmessung.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zu den ökonomischen Effekten der Digitalisierung, den Grundlagen der VGR, den Gründen für die unzureichende Erfassung der Digitalisierung, Verbesserungsmöglichkeiten und ein Fazit.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel ist es, die Gründe für die unzureichende Erfassung der Digitalisierung in der VGR aufzuzeigen und Verbesserungsmöglichkeiten für eine genauere Erfassung der Auswirkungen der Digitalisierung zu präsentieren.
- Quote paper
- David Spoida (Author), 2018, Warum schlägt sich die Digitalisierung nicht in den volkswirtschaftlichen Statistiken nieder?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455121