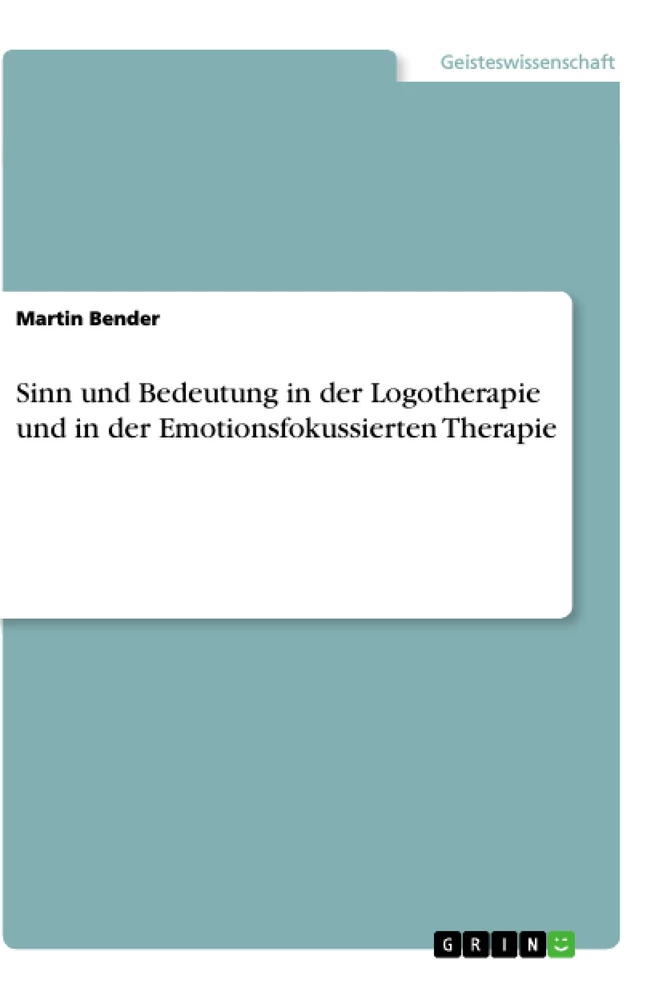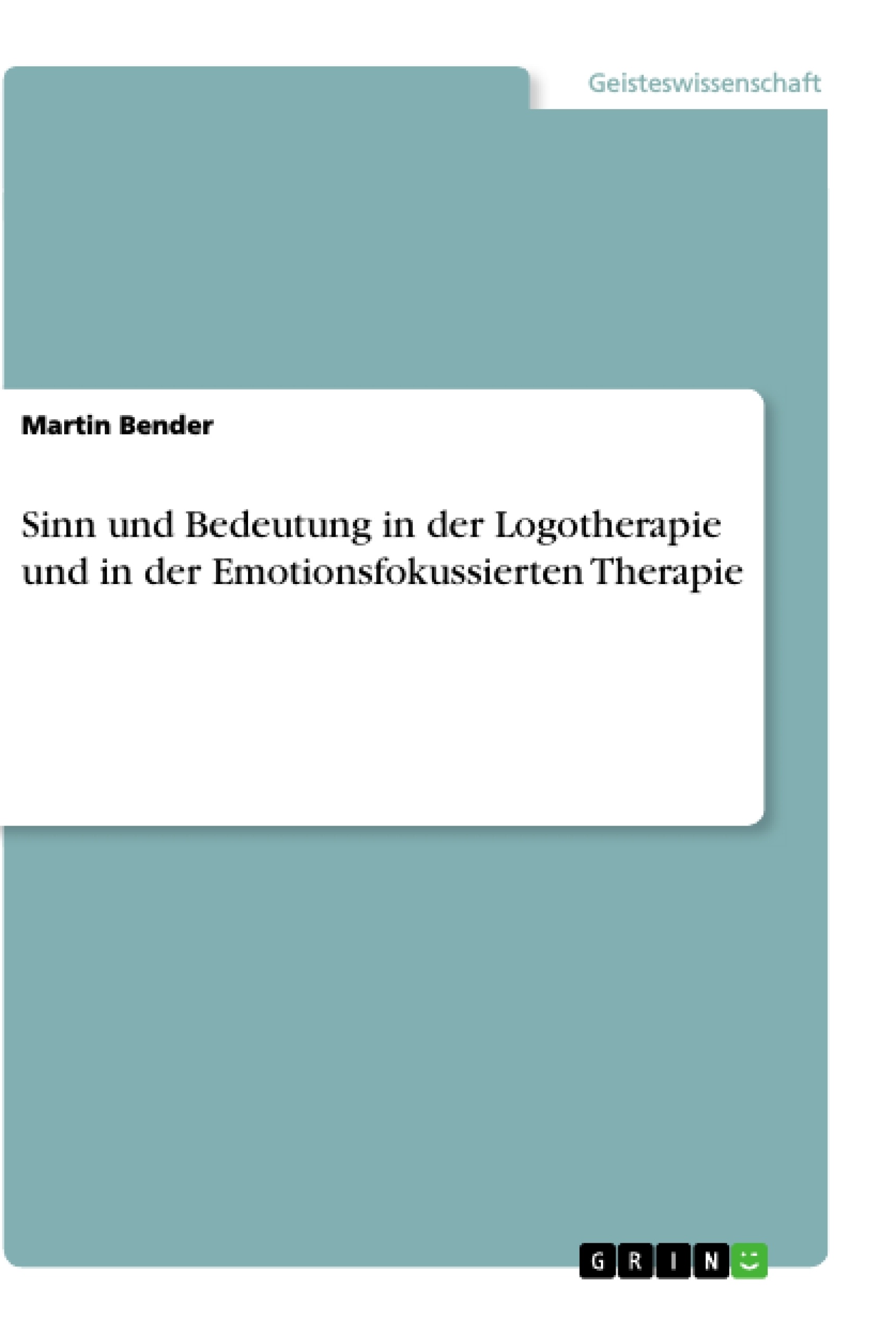Immer wieder sehen sich Psychotherapeuten in der Praxis mit existentiellen Fragen konfrontiert, auf die sie in ihrer Ausbildung nur unzureichend oder gar nicht vorbereitet wurden. Zudem gibt es nur wenige Veröffentlichungen, die sich praxisorientiert mit existentiellen Themen in "hinreichender Breite" disziplinübergreifend befassen (Petzold).
Die Logotherapie Viktor E. Frankls und die Emotionsfokussierte Therapie Leslie S. Greenbergs sind in diesem Kontext von besonderer Bedeutung. Frankl hat als "pragmatischer Denker" mit seinem Ansatz einer sinnzentrierten Psychotherapie einen "wesentlichen Beitrag" für die Psychotherapie geleistet, fand aber "nicht die Anerkennung, die er verdient" (Yalom). Die Emotionsfokussierte Therapie Greenbergs - ein moderner, integrativer, aus der Prozessforschung entstandener Ansatz - bezieht existentielle Themen ausdrücklich in die therapeutische Arbeit mit ein und sieht in dem Willen "Bedeutung im Leben zu finden unsere Hauptmotivation zu leben" (Greenberg).
Im Einzelnen wird die Konzeptualisierung von "Sinn" und "Bedeutung" in Logotherapie und Emotionsfokussierter Therapie kritisch untersucht sowie die Umsetzung der Konzepte in therapeutische Praxis. Ein systematischer Vergleich arbeitet nicht nur die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ansätze heraus, sondern auch ihre impliziten philosophischen Setzungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Thematische Einführung
- 1.1 Sinn und Bedeutung in der Psychotherapie
- 1.2 Philosophische Perspektiven von Sinn und Bedeutung
- 1.3 Erkenntnisleitende Fragestellungen und Aufbau der Arbeit
- 2.0 Logotherapie und Existenzanalyse
- 2.1 Terminologie
- 2.2 Kritik des Psychologismus (Entstehungshintergrund I)
- 2.3 Existenzanalytische Anthropologie
- 2.3.1 Konstituentien des menschlichen Daseins
- 2.3.1.1 Geistigkeit
- 2.3.1.2 Freiheit
- 2.3.1.3 Verantwortung
- 2.3.2 Konzeptualisierung von Sinn
- 2.3.2.1 Der „Wille zum Sinn“
- 2.3.2.2 Sinnkonzepte
- 2.3.2.2.1 Sinn im Leben (partikulärer Sinn)
- 2.3.2.2.2 Sinn des Lebens
- 2.3.2.2.3 Über-Sinn (Sinn des Ganzen)
- 2.3.2.3 Sinnfindung
- 2.3.2.3.1 „Sinnorgan“ Gewissen
- 2.3.2.3.2 Sinnwahrnehmung als Gestaltwahrnehmung
- 2.3.2.3.3 Werte verwirklichen
- 2.3.2.3.3.1 Wertkategorien (Wertetrias)
- 2.3.2.4 Sinnfindungsstörungen
- 2.3.2.4.1 Existentielle Frustration
- 2.3.2.4.2 Existentielles Vakuum
- 2.3.2.4.3 Noogene Neurose
- 2.3.3 Logotherapie und Religion
- 2.4 Praxis der Logotherapie
- 2.4.1 Entstehungshintergrund II
- 2.4.2 Logotherapeutische Prinzipien
- 2.4.3 Logotherapeutische Methodik
- 2.4.3.1 Improvisation und Beziehung
- 2.4.3.2 Pflichten des Arztes
- 2.4.3.3 Sokratischer Dialog
- 2.4.3.4 Logotherapeutische Methoden
- 2.4.3.4.1 Paradoxe Intention
- 2.4.3.4.2 Dereflexion
- 2.5 Kritische Würdigung
- 3.0 Emotionsfokussierte Therapie
- 3.1 Terminologie
- 3.2 Entstehungshintergrund und Problemstellung
- 3.3 Theoretische Grundlagen der Emotionsfokussierten Therapie
- 3.3.1 Perspektiven der Kognitionswissenschaften
- 3.3.2 Perspektiven der Emotionsforschung
- 3.3.2.1 Biologische Aspekte
- 3.3.2.2 Sozio-kulturelle Aspekte
- 3.3.3 Konzeptualisierung von Bedeutung
- 3.3.3.1 Emotionale Schemata
- 3.3.3.2 Emotionsarten und ihre Funktion
- 3.3.3.2.1 Primär adaptive Emotionen
- 3.3.3.2.2 Primär maladaptive Emotionen
- 3.3.3.2.3 Sekundäre Emotionen
- 3.3.3.2.4 Instrumentelle Emotionen
- 3.3.3.3 Dialektischer Konstruktivismus
- 3.3.3.3.1 Theoretischer Kontext
- 3.3.3.3.2 Beschreibung des dialektisch-konstruktivistischen Modells
- 3.3.3.4 Dysfunktion und Veränderungsprinzipien
- 3.3.3.4.1 Mangel an emotionalem Gewahrsein
- 3.3.3.4.2 Maladaptive emotionale Schemata
- 3.3.3.4.3 Regulation von Emotionen
- 3.3.3.4.4 Narrative Konstruktion und existentielle Bedeutungserschaffung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Umgang mit Sinnfragen in der Logotherapie und der Emotionsfokussierten Therapie. Ziel ist es, die unterschiedlichen Konzeptualisierungen von „Sinn“ und „Bedeutung“ in beiden Therapieansätzen zu vergleichen und deren Implikationen für die therapeutische Praxis aufzuzeigen.
- Konzeptualisierung von Sinn in der Logotherapie
- Konzeptualisierung von Bedeutung in der Emotionsfokussierten Therapie
- Vergleich der therapeutischen Ansätze
- Implikationen für die Praxis
- Philosophische Grundlagen beider Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Thematische Einführung: Dieses einführende Kapitel legt den Grundstein für die gesamte Arbeit, indem es die Relevanz von Sinnfragen in der psychotherapeutischen Praxis herausstellt und die Forschungslücke bezüglich praktikabler Umsetzungen sinntheoretischer Einsichten aufzeigt. Es skizziert den begriffsgeschichtlichen Hintergrund von "Sinn des Lebens" und führt die beiden zentralen Therapieansätze – Logotherapie und Emotionsfokussierte Therapie – ein. Die Kapitel 2 und 3 werden als Hauptteile der Arbeit angekündigt, in denen die jeweiligen Therapieansätze detailliert untersucht werden.
2.0 Logotherapie und Existenzanalyse: Dieses Kapitel widmet sich der Logotherapie Viktor Frankls. Es beleuchtet die existenzanalytische Anthropologie, die den Menschen als auf objektive Werte ausgerichtet beschreibt, und definiert den "Willen zum Sinn" als zentralen Aspekt. Die Konzeptualisierung von Sinn, verschiedene Sinnkonzepte (Sinn im Leben, Sinn des Lebens, Über-Sinn) und Sinnfindungsstörungen (existentielle Frustration, existentielles Vakuum, noogene Neurose) werden ausführlich erörtert. Die Rolle des Gewissens bei der Sinnwahrnehmung und die Bedeutung der Verwirklichung von Werten werden ebenfalls behandelt. Schließlich werden die logotherapeutische Praxis, Methodik und Prinzipien vorgestellt.
3.0 Emotionsfokussierte Therapie: Das Kapitel beschreibt die Emotionsfokussierte Therapie nach Leslie S. Greenberg. Es erläutert den dialektisch-konstruktivistischen Ansatz, der einen Mittelweg zwischen Relativismus und Realismus sucht. Die Bedeutung von Emotionen für die Bedeutungsfindung und die Konzeptualisierung von Bedeutung als im dialektisch-konstruktivistischen Prozess entdeckter und geschaffener werden, steht im Zentrum. Die Unterscheidung zwischen primär adaptiven und maladaptiven Emotionen, sowie sekundären und instrumentellen Emotionen wird erklärt. Schließlich werden die Prinzipien der Veränderung und der therapeutische Prozess skizziert.
Schlüsselwörter
Logotherapie, Emotionsfokussierte Therapie, Sinn, Bedeutung, Existenzanalyse, dialektischer Konstruktivismus, Willen zum Sinn, Emotionen, Werte, Sinnfindung, Sinnfindungsstörungen, therapeutische Praxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Logotherapie und Emotionsfokussierte Therapie im Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Logotherapie und die Emotionsfokussierte Therapie im Hinblick auf ihren Umgang mit Sinnfragen. Sie untersucht die unterschiedlichen Konzeptualisierungen von "Sinn" und "Bedeutung" in beiden Therapieansätzen und deren Auswirkungen auf die therapeutische Praxis. Ein Schwerpunkt liegt auf den philosophischen Grundlagen beider Ansätze.
Welche Therapieansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Logotherapie nach Viktor Frankl und die Emotionsfokussierte Therapie nach Leslie S. Greenberg. Beide Ansätze befassen sich mit der Bedeutung von Sinn und Emotionen für das psychische Wohlbefinden, jedoch aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer einführenden Darstellung der Relevanz von Sinnfragen in der Psychotherapie und einer Einführung in die beiden Therapieansätze. Es folgen zwei Hauptkapitel, die sich jeweils einer Therapieform widmen: Kapitel 2 behandelt die Logotherapie und Existenzanalyse ausführlich, Kapitel 3 die Emotionsfokussierte Therapie. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Was sind die zentralen Themen der Logotherapie in dieser Arbeit?
Im Kapitel zur Logotherapie werden die existenzanalytische Anthropologie, der "Wille zum Sinn", verschiedene Sinnkonzepte (Sinn im Leben, Sinn des Lebens, Über-Sinn), Sinnfindungsstörungen (existentielle Frustration, existentielles Vakuum, noogene Neurose), die Rolle des Gewissens, die Bedeutung der Verwirklichung von Werten, sowie die logotherapeutische Praxis, Methodik und Prinzipien behandelt.
Was sind die zentralen Themen der Emotionsfokussierten Therapie in dieser Arbeit?
Das Kapitel zur Emotionsfokussierten Therapie erläutert den dialektisch-konstruktivistischen Ansatz, die Bedeutung von Emotionen für die Bedeutungsfindung, die Konzeptualisierung von Bedeutung als im dialektisch-konstruktivistischen Prozess entdeckter und geschaffener Größe. Die Unterscheidung zwischen primär adaptiven und maladaptiven Emotionen, sowie sekundären und instrumentellen Emotionen wird erklärt. Schließlich werden die Prinzipien der Veränderung und der therapeutische Prozess skizziert.
Wie werden Sinn und Bedeutung in den beiden Therapieansätzen konzeptualisiert?
Die Arbeit vergleicht die unterschiedlichen Konzeptualisierungen von "Sinn" in der Logotherapie und "Bedeutung" in der Emotionsfokussierten Therapie. Während die Logotherapie den "Willen zum Sinn" als zentralen Aspekt betont und verschiedene Sinn-Ebenen unterscheidet, fokussiert die Emotionsfokussierte Therapie auf die Bedeutung von Emotionen für die Bedeutungsfindung und den dialektisch-konstruktivistischen Prozess der Bedeutungserschaffung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie die unterschiedlichen Konzeptualisierungen von Sinn und Bedeutung in der Logotherapie und der Emotionsfokussierten Therapie zu unterschiedlichen therapeutischen Vorgehensweisen führen. Ein genauer Vergleich der Ansätze und deren Implikationen für die Praxis wird geliefert. Die philosophischen Grundlagen beider Ansätze werden ebenfalls kritisch gewürdigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Logotherapie, Emotionsfokussierte Therapie, Sinn, Bedeutung, Existenzanalyse, dialektischer Konstruktivismus, Willen zum Sinn, Emotionen, Werte, Sinnfindung, Sinnfindungsstörungen, therapeutische Praxis.
- Quote paper
- Martin Bender (Author), 2019, Sinn und Bedeutung in der Logotherapie und in der Emotionsfokussierten Therapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455112