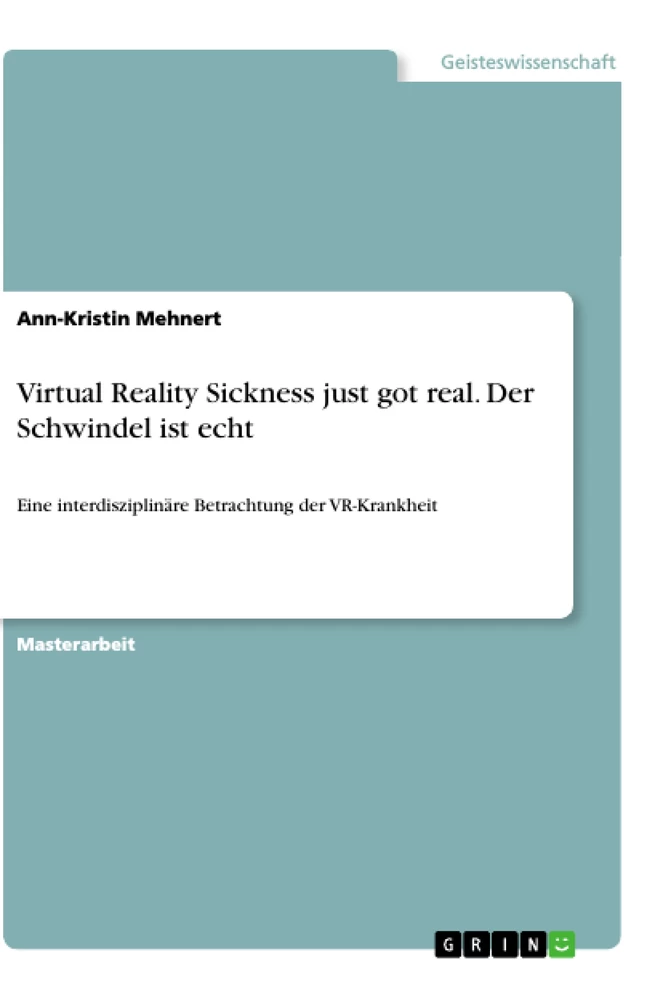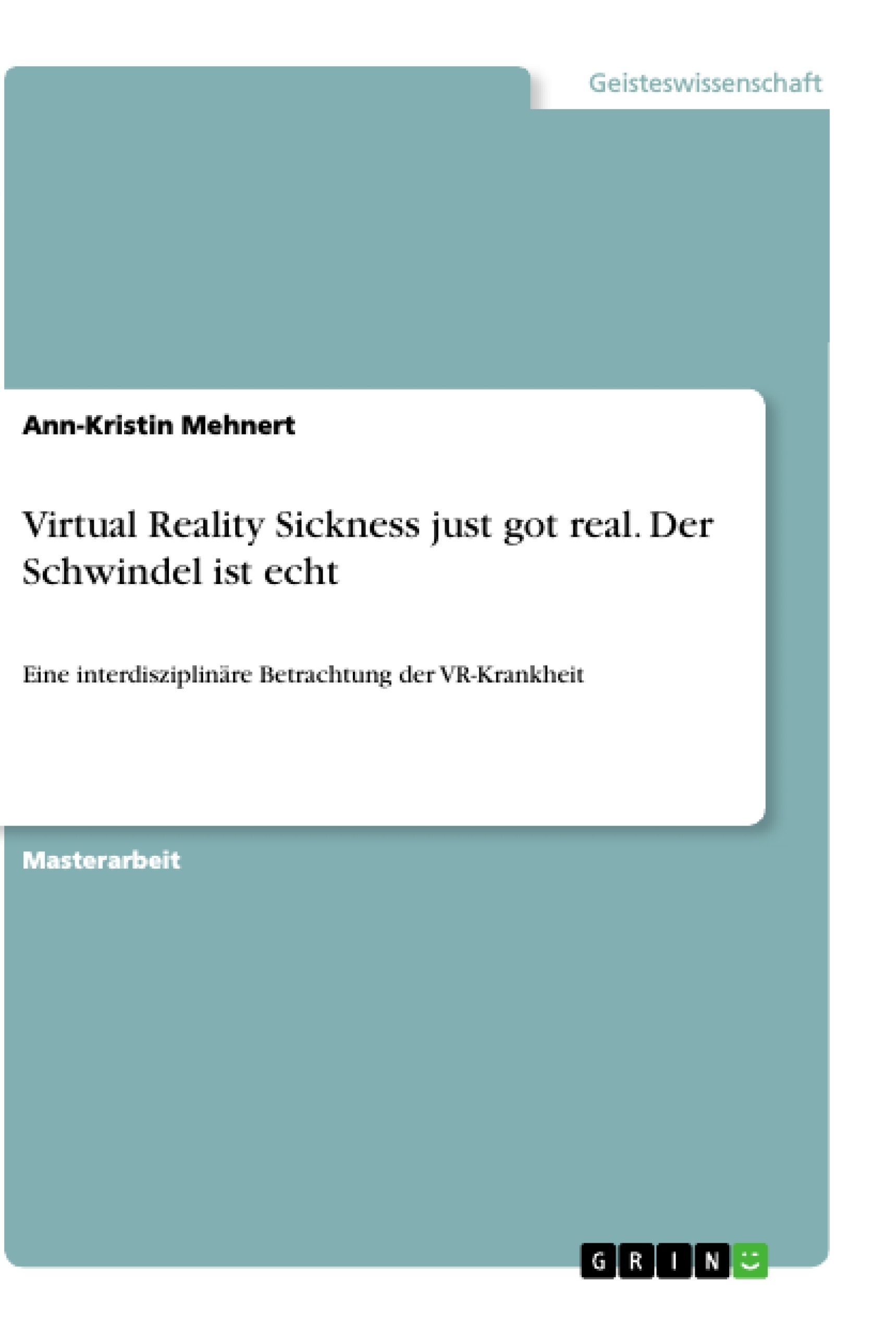Nachdem sie zuvor schon für gescheitert erklärt worden war, wurde die virtuelle Realität im Jahr 2012 wiederbelebt und seitdem boomt der VR-Markt. Virtual Reality ist der Megatrend, und mittlerweile wird aus dem Hype Ernst: 2016 sind die ersten für Heimanwender erschwinglichen VR-Brillen auf den Markt gekommen, die jetzt auch diesen kommerziellen Kundenkreis in virtuelle Umgebungen abtauchen lassen.
Ungewollter Nebeneffekt dieser Entwicklung ist die VR-Krankheit, die eine ernst zu nehmende Herausforderung für Produzenten wie für Konsumenten darstellt. Auf Herstellerseite könnte sie dem erhofften Durchbruch und vor allem der festen Etablierung von Virtual Reality im Wege stehen und die erwünschten Produktivitätssteigerungen somit beeinträchtigen. Beim Rezipienten kann sich die VR-Krankheit wiederum nicht nur negativ auf das Erlebnis von VR-Inhalten aus-wirken, sondern nach Meinung einiger Studien gar ein potentielles Gesundheits- und Sicherheitsproblem darstellen.
Die zentrale Fragestellung besteht darin zu untersuchen, welche technischen Gegenmaßnahmen die Industrie ergreift, um die VR-Krankheit zu unterbinden und auf welche Diagnostik sie sich dabei stützt. In erster Linie gilt es also herauszustellen, was die Industrie nach jetzigem Erkenntnisstand als Ursachen vermutet und welche Entscheidungen sie auf Grundlage dieser Vermutung trifft. Eine kritische Auseinandersetzung mit Richtigkeit und Vollständigkeit des diesbezüglichen immer noch im Fluss befindlichen aktuellen Meinungsstandes ist hingegen nicht das zentrale Thema der vorliegenden Arbeit.
So greifen einzelne Hersteller im Umgang mit den Beschwerden in der virtuellen Realität neben technischen Anpassungen auch zu didaktischen Maßnahmen, die sowohl Konsumenten als auch Spieleprogrammierer und -designer betreffen. Beispielsweise gibt Oculus für den Konsumenten mittlerweile einen dreistufigen Komfort-Grad als Äquivalent für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der VR-Krankheit an und veröffentlichte für Spieleentwickler einen Leitfaden namens „Oculus Best Practices“ zur bestmöglichen designtechnischen Handhabung der VR-Krankheit. Dabei gilt es zu analysieren, inwiefern sich in den von den Herstellern herausgegebenen Empfehlungen für Spieleentwickler, FAQ und Komforteinstufungen Parallelen zu den bisher ausgemachten Einflussfaktoren, aufgestellten Ursachen-Theorien und Diagnostiken erkennen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Zentrale Fragestellung und Zielsetzung
- 1.2. Aufbau und Methodik der Arbeit
- 2. Virtuelle Realität
- 2.1. Begriffsannäherung
- 2.2. Abgrenzung zur erweiterten und gemischten Realität
- 2.3. Hardware
- 2.3.1. Ein- und Ausgabegeräte
- 2.3.2. Eingabegeräte
- 2.3.3. Ausgabegeräte
- 3. Präsenzerleben als Indikator für das Immersionspotential
- 3.1. Lebendigkeit bzw. Realitätsnähe
- 3.2. Interaktivität
- 4. Virtuelle Realitäts-Krankheit
- 4.1. Theorien zu den Ursachen der VR-Krankheit
- 4.1.1. Sensor-Konflikt-Theorie
- 4.1.2. Theorie der posturalen Instabilität
- 4.1.3. Vergiftungstheorie
- 4.2. Abgrenzung zur Motion-, Simulator-, Gaming- und Cyber Sickness
- 4.3. Beschwerden der VR-Krankheit
- 4.3.1. Symptomatische Beschwerden
- 4.3.2. Folgeerscheinungen
- 4.4. Einflussfaktoren der VR-Krankheit
- 4.5. Technische Gegenmaßnahmen der Industrie
- 4.5.1. Hardware
- 4.5.2. Software
- 4.5.3. Neue Ansätze zur Unterbindung der VR-Krankheit
- 5. Diskussion der Gegenmaßnahmen
- 5.1. Vor dem Hintergrund der Ursachen-Theorien und Einflussfaktoren
- 5.2. Vor dem Hintergrund der Immersion und des Präsenzerlebens
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der VR-Krankheit, einem unerwünschten Nebeneffekt des VR-Booms. Die Arbeit untersucht die technischen Gegenmaßnahmen, die die Industrie ergreift, um diese Krankheit zu unterbinden. Dabei wird die Diagnostik, auf die sich die Hersteller stützen, analysiert und die Vermutungen der Industrie über die Ursachen der VR-Krankheit beleuchtet. Darüber hinaus wird der Zusammenhang zwischen VR-Krankheit, Immersion, Präsenzerleben und Vektion untersucht, um die Einflussfaktoren der Krankheit besser zu verstehen.
- Technischen Gegenmaßnahmen zur Unterbindung der VR-Krankheit
- Diagnostik der VR-Krankheit
- Vermutungen der Industrie über die Ursachen der VR-Krankheit
- Zusammenhang zwischen VR-Krankheit, Immersion, Präsenzerleben und Vektion
- Einflussfaktoren der VR-Krankheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der VR-Krankheit ein, beschreibt die zentrale Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit sowie den Aufbau und die Methodik. Kapitel zwei beleuchtet die virtuelle Realität, erklärt den Begriff und grenzt ihn von erweiterten und gemischten Realitäten ab. Es geht zudem auf die Hardwarekomponenten von VR-Systemen ein, einschließlich Ein- und Ausgabegeräte, Eingabegeräte und Ausgabegeräte. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Präsenzerleben als Indikator für das Immersionspotential und untersucht die Aspekte der Lebendigkeit und Interaktivität. Kapitel vier analysiert die Ursachen und Symptome der VR-Krankheit, beleuchtet verschiedene Theorien und Abgrenzungen zu ähnlichen Krankheitsbildern, sowie Einflussfaktoren und technische Gegenmaßnahmen der Industrie.
Schlüsselwörter
Virtual Reality, VR-Krankheit, Sensor-Konflikt-Theorie, Immersionspotential, Präsenzerleben, Vektion, Technische Gegenmaßnahmen, Hardware, Software, Einflussfaktoren.
- Quote paper
- Ann-Kristin Mehnert (Author), 2017, Virtual Reality Sickness just got real. Der Schwindel ist echt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/454955