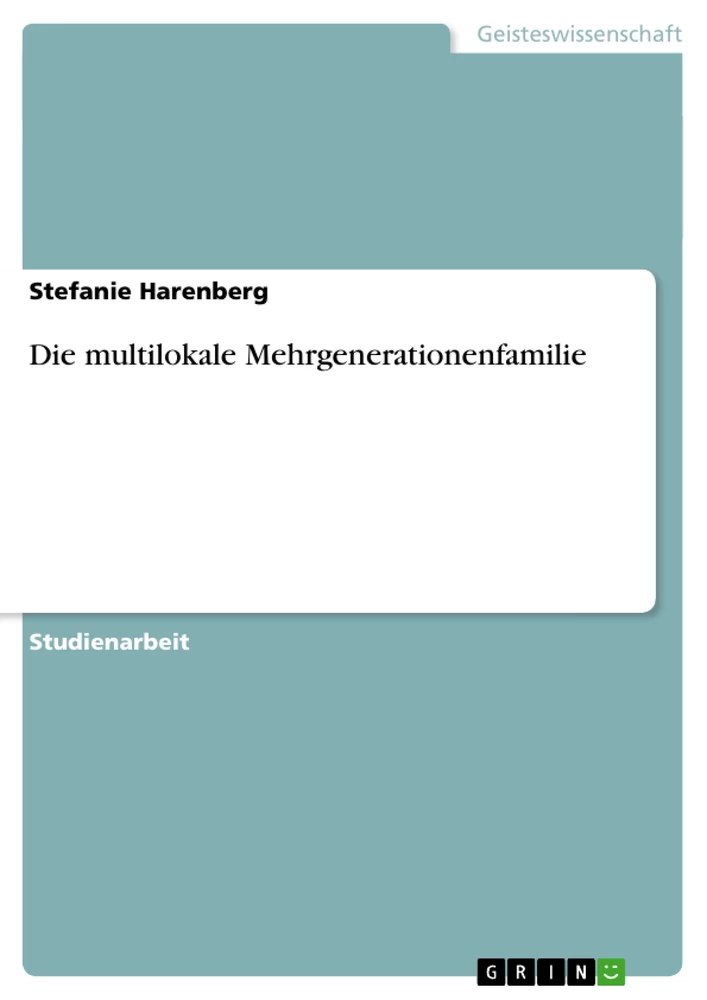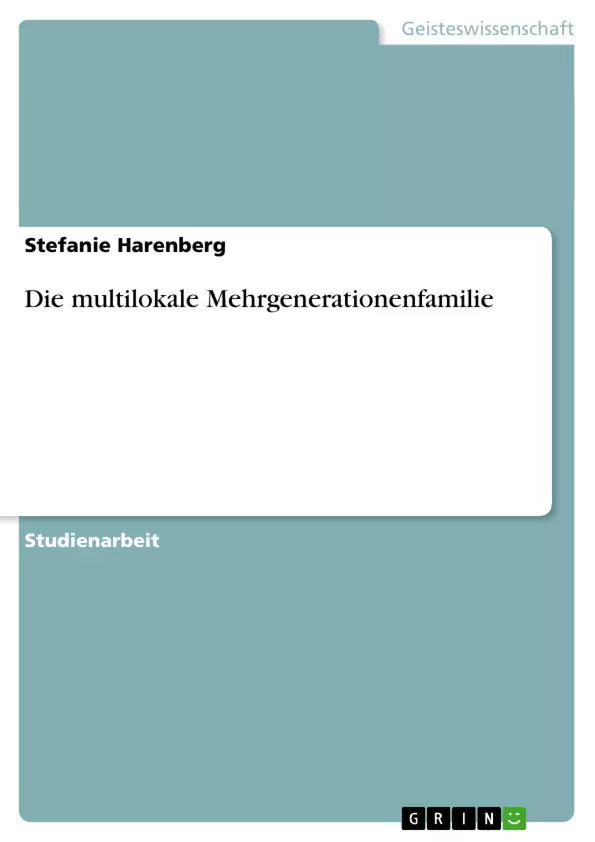Spricht man heute von Familie, das Individuum von „sich und seiner Familie“, so kann damit eine Fülle von Gruppenstrukturen gemeint sein, die sich deutlich von der, in der Gesellschaft oft als „die Familie“ angesehene neolokale Gattenfamilie, unterscheidet. Gemeint sein kann:
Die Adoptivfamilie, die Ehe ohne Trauschein, eine eheähnliche Beziehung, die Ein-Eltern-Familie, eine Großfamilie, die Kernfamilie, eine kinderlose Ehe, eine Kommune, eine Lebensabschnittspartnerschaft, eine Patchwork-Familie, eine Pflegefamilie, eine SOS-Kinderdorf-Familie, eine Stieffamilie, die Wohngemeinschaft oder eine Zwei-Kern- Familie.
Häufig findet man nicht das heterosexuelle, in erster Ehe verheiratete Paar mit durchschnittlich zwei Kindern vor, sondern stößt auf eine Vielzahl anderer Familienformen. Angesichts dieser Fülle von Bezeichnungen für verschiedene Strukturen innerhalb einer verwandtschaftlichen oder nicht- verwandtschaftlichen Gruppe und der Tatsache, dass in amtlichen Statistiken zunehmend so genannte Singlehaushalte zu finden sind, liegt die Vermutung nahe „die Familie“ sei in einer Krise oder bereits vor ihrem Zerfall. Dass in Zeiten eines großen demografischen Wandels, zunehmender Mobilität und einer Individualisierung der Familie nicht länger am Bild der traditionellen Familie, in der Eltern und Kinder am gleichen Ort bis zur Vollendung der Ausbildung des Nachwuchses leben, in der Kinder nach dem Auszug eine eigene Familie gründen und schon statistisch dann nicht mehr als Familie gelten, festgehalten werden kann, ist eine logische Konsequenz.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Familie - gestern und heute
- 2.1. Die Familie der Vergangenheit - Groß-, neolokale Kern-,,,Normalfamilie\"?
- 2.2. Bedingungen von Multilokalität - Der demografische Wandel
- 2.3. Zum Begriff der multilokalen Mehrgenerationenfamilie
- 3. Bedingungen und Begrifflichkeiten
- 3.1. Das Problem der amtlichen Statistik
- 3.2. Die Netzwerktheoretische Analyse
- 4. Der Familienzyklus - Anordnung, Einordnung und Auswirkungen
- 4.1. Der Familienzyklus - ein veraltetes Modell?
- 5. Immaterielle und materielle Transferleistungen in multilokalen Mehrgenerationenfamilien
- 5.1. Einführung
- 5.2. Immaterielle Transfers - Solidarität und Fürsorge
- 5.3. Materielle Transfers
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die multilokale Mehrgenerationenfamilie als eine sich verändernde Familienform im Kontext des demografischen Wandels und der zunehmenden Individualisierung. Ziel ist es, ein umfassenderes Verständnis dieser Familienstruktur zu entwickeln und gängige Missverständnisse, die sich aus traditionellen Familienmodellen und amtlicher Statistik ergeben, zu korrigieren.
- Veränderung des Familienbegriffs im Laufe der Zeit
- Herausforderungen der amtlichen Statistik bei der Erfassung multilokaler Familien
- Bedeutung der Netzwerktheorie zur Analyse von Familienbeziehungen
- Der Familienzyklus als Modell und seine Grenzen im Kontext multilokaler Familien
- Immaterielle und materielle Transferleistungen innerhalb multilokaler Mehrgenerationenfamilien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und zeigt die Vielfalt moderner Familienstrukturen auf, die sich deutlich von dem traditionellen Bild der neolokalen Kernfamilie unterscheiden. Sie kritisiert die vereinfachende Darstellung in amtlichen Statistiken und betont die Notwendigkeit, den Begriff der Familie neu zu definieren, um den Veränderungen durch demografischen Wandel und zunehmende Mobilität Rechnung zu tragen. Die Arbeit kündigt ihre weitere Vorgehensweise an, welche die Analyse der multilokalen Mehrgenerationenfamilie im Fokus hat.
2. Die Familie - gestern und heute: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Familienbegriffs und vergleicht traditionelle Familienstrukturen mit modernen Formen. Es analysiert die Herausforderungen des demografischen Wandels und der zunehmenden Mobilität für Familienstrukturen und führt den Begriff der multilokalen Mehrgenerationenfamilie ein, der sich auf räumlich getrennte, aber dennoch verbundene Generationen bezieht. Der Abschnitt unterstreicht, dass räumliche Trennung nicht zwingend mit mangelnder Solidarität einhergehen muss.
3. Bedingungen und Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel befasst sich mit den methodischen Herausforderungen der Erforschung multilokaler Mehrgenerationenfamilien. Es kritisiert die Grenzen amtlicher Statistiken, die ein ungenaues Bild der Realität zeichnen, und schlägt die netzwerktheoretische Analyse als geeignetere Methode zur Abbildung von Beziehungen vor. Der Abschnitt betont die Notwendigkeit, über die rein räumliche Nähe hinaus die Komplexität der Beziehungen innerhalb der Familie zu betrachten.
4. Der Familienzyklus - Anordnung, Einordnung und Auswirkungen: Dieses Kapitel untersucht die Anwendbarkeit des traditionellen Familienzyklus-Modells auf moderne Familienstrukturen. Es hinterfragt die Adäquatheit dieses Modells im Hinblick auf die veränderten Lebensläufe und räumlichen Gegebenheiten multilokaler Familien. Der Abschnitt diskutiert kritisch die Grenzen des Modells und plädiert für eine flexiblere Betrachtung des Familienzyklus.
5. Immaterielle und materielle Transferleistungen in multilokalen Mehrgenerationenfamilien: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die verschiedenen Formen der Unterstützung, die innerhalb multilokaler Mehrgenerationenfamilien ausgetauscht werden. Es differenziert zwischen immateriellen Leistungen wie Fürsorge und Solidarität und materiellen Leistungen wie finanzielle Unterstützung. Der Abschnitt analysiert die Bedeutung dieser Transferleistungen für den Zusammenhalt der Familie und für das Wohlbefinden der einzelnen Mitglieder, unter Berücksichtigung der räumlichen Distanzen.
Schlüsselwörter
Multilokale Mehrgenerationenfamilie, Familienwandel, demografischer Wandel, Netzwerktheorie, Familienzyklus, immaterielle Transfers, materielle Transfers, Solidarität, räumliche Distanz, amtliche Statistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Multilokale Mehrgenerationenfamilien"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht multilokale Mehrgenerationenfamilien als eine sich verändernde Familienform im Kontext des demografischen Wandels und der zunehmenden Individualisierung. Sie zielt darauf ab, ein umfassenderes Verständnis dieser Familienstruktur zu entwickeln und gängige Missverständnisse zu korrigieren, die sich aus traditionellen Familienmodellen und amtlicher Statistik ergeben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Veränderung des Familienbegriffs im Laufe der Zeit, die Herausforderungen der amtlichen Statistik bei der Erfassung multilokaler Familien, die Bedeutung der Netzwerktheorie zur Analyse von Familienbeziehungen, den Familienzyklus als Modell und seine Grenzen im Kontext multilokaler Familien sowie immaterielle und materielle Transferleistungen innerhalb multilokaler Mehrgenerationenfamilien.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Die Familie - gestern und heute, Bedingungen und Begrifflichkeiten, Der Familienzyklus - Anordnung, Einordnung und Auswirkungen, Immaterielle und materielle Transferleistungen in multilokalen Mehrgenerationenfamilien und Zusammenfassung. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der multilokalen Mehrgenerationenfamilie.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit kritisiert die Grenzen amtlicher Statistiken und schlägt die netzwerktheoretische Analyse als geeignetere Methode zur Abbildung von Familienbeziehungen vor. Sie betont die Notwendigkeit, über die rein räumliche Nähe hinaus die Komplexität der Beziehungen innerhalb der Familie zu betrachten.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, dass der traditionelle Familienbegriff und die damit verbundenen statistischen Erfassungsmethoden unzureichend sind, um die Realität multilokaler Mehrgenerationenfamilien abzubilden. Sie betont die Bedeutung von immateriellen und materiellen Transferleistungen für den Zusammenhalt dieser Familienformen trotz räumlicher Distanzen und plädiert für eine flexiblere Betrachtung des Familienzyklus.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Multilokale Mehrgenerationenfamilie, Familienwandel, demografischer Wandel, Netzwerktheorie, Familienzyklus, immaterielle Transfers, materielle Transfers, Solidarität, räumliche Distanz und amtliche Statistik.
Welche Kritikpunkte werden angesprochen?
Die Arbeit kritisiert die vereinfachende Darstellung von Familienstrukturen in amtlichen Statistiken und die Grenzen des traditionellen Familienzyklus-Modells im Kontext moderner, multilokaler Familienstrukturen. Sie weist auf die Notwendigkeit hin, den Familienbegriff neu zu definieren und alternative Analysemethoden, wie die Netzwerktheorie, zu verwenden.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler*innen, die sich mit Familiensoziologie, Demografie und Netzwerkforschung befassen, sowie für Praktiker*innen in der Sozialarbeit und Familienberatung. Sie bietet wichtige Einblicke in die Herausforderungen und Chancen multilokaler Mehrgenerationenfamilien.
- Quote paper
- Stefanie Harenberg (Author), 2005, Die multilokale Mehrgenerationenfamilie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45465