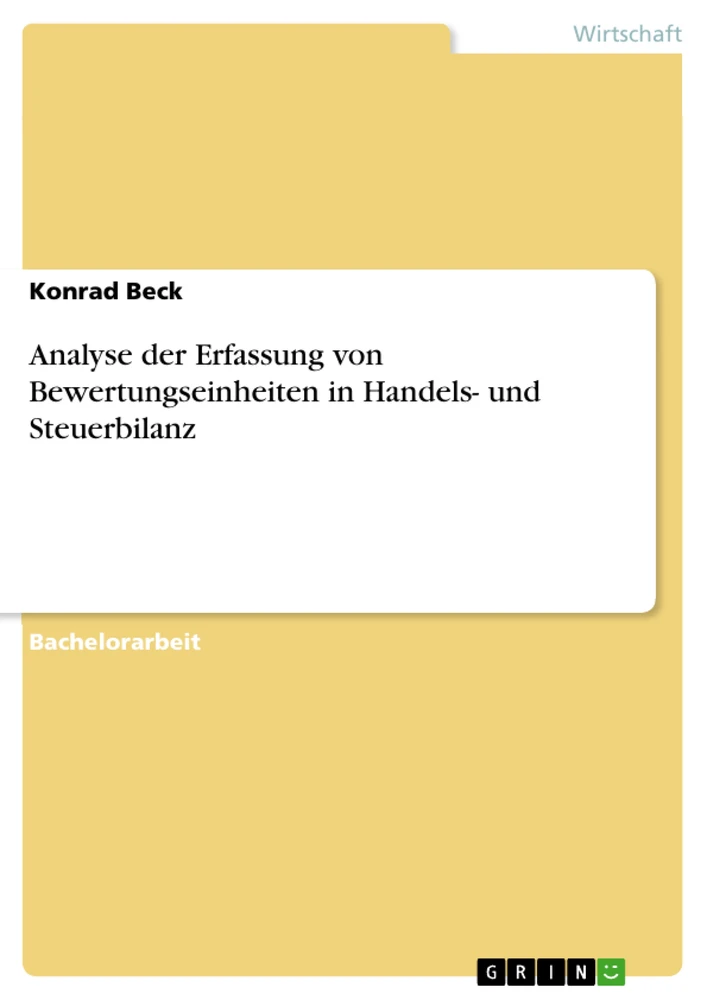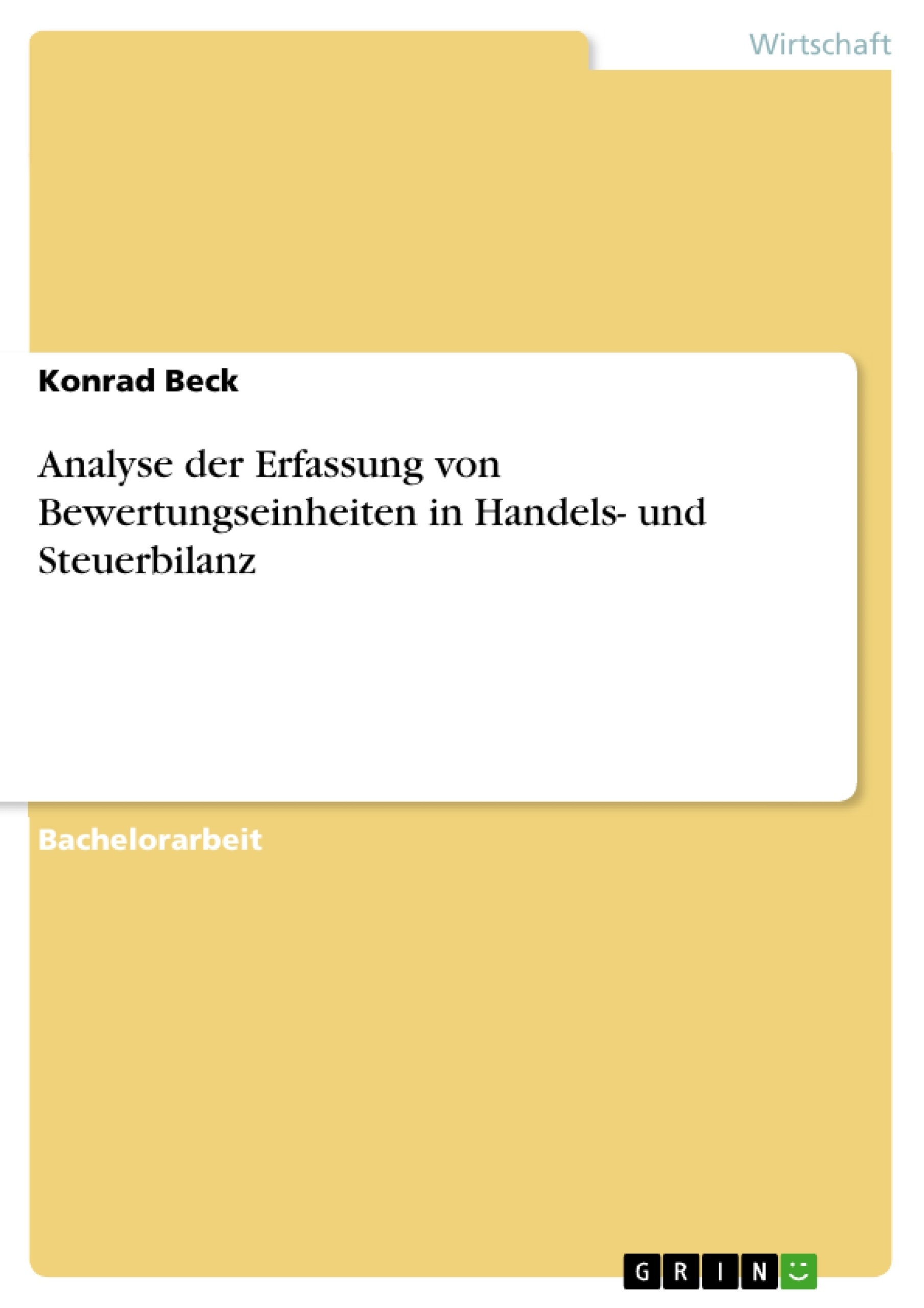Das Hauptziel dieser Arbeit ist aufzuzeigen, ob die Bildung von Bewertungseinheiten eine sinnvolle Methode ist, um sich vor Risiken des unternehmerischen Alltags abzusichern.
In der Bachelor-Arbeit werden zunächst der Begriff und die Grundidee der Bewertungseinheit geklärt. Zudem soll aufgezeigt werden, welche Arten von Geschäften gegenseitige Sicherungsbeziehungen eingehen können. Man spricht hier in der Regel von einem Grundgeschäft, das durch ein Sicherungsgeschäft abgesichert wird. Dieser Vorgang wird auch als hedging bezeichnet und ist ebenfalls in der internationalen Rechnungslegung (IAS; IFRS) geregelt. In der Bilanzierungspraxis unterscheidet man 3 Arten von Bewertungseinheiten (Hedges): micro hedge, macro hedge, portfolio hedge. Diese 3 Arten werden beschrieben und differenziert. Nach dieser allgemeinen Einführung in das Gebiet der Bewertungseinheiten wird verstärkt auf die Bilanzierungsfähigkeit von Hedges eingegangen. Alle Voraussetzungen, die für eine wirksame Bildung und bilanzielle Darstellung von Bewertungseinheiten erfüllt werden müssen, werden unter diesem Punkt genau aufgelistet und beschrieben. Darauffolgend wird die konkrete Bilanzierung von Bewertungseinheiten thematisiert. Hierbei gibt es eine klare Untertrennung zwischen Handels- und Steuerbilanz. Die Bilanzierung wird hierbei anschaulich und umfangreich anhand von Fallbeispielen dargelegt, um dem Thema „Analyse der Erfassung von Bewertungseinheiten in Handels- und Steuerbilanz“ gerecht zu werden. Demzufolge werden auch die Auswirkungen auf Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung aufgezeigt. Nach diesen ausführlichen Fallbeispielen schließt die Arbeit mit dem Fazit ab. In diesem letzten Résumé sind die wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Erarbeitung im Rahmen der Bachelorarbeit festgehalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
- 2.1. Inhalt
- 2.2. Ziele
- 3. Grundsätze von Bewertungseinheiten
- 3.1. Begriff und Grundidee
- 3.2. Absicherungsfähige Grundgeschäfte
- 3.3. Mögliche Sicherungsinstrumente
- 4. Arten von Bewertungseinheiten
- 4.1. micro hedges
- 4.2. macro hedges
- 4.3. portfolio hedges
- 5. Voraussetzungen für die Bildung von Bewertungseinheiten
- 5.1. Vorliegen vergleichbarer Risiken
- 5.2. Effektivität der Sicherungsbeziehung
- 5.2.1. Anwendung von Methoden zur Effektivitätsbestimmung
- 5.3. Sicherungsabsicht und Dokumentation
- 6. Bilanzielle Abbildung von Bewertungseinheiten
- 6.1. Abbildung in Handelsbilanz
- 6.2. Abbildung in Steuerbilanz
- 6.2.1. Zielsetzung des § 5 (1a) EStG
- 6.2.2. Ansatz in Steuerbilanz nach § 5 (1a) EStG
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Erfassung von Bewertungseinheiten in Handels- und Steuerbilanzen. Das Hauptziel besteht darin, die Sinnhaftigkeit von Bewertungseinheiten als Risikominderung im unternehmerischen Alltag zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Thematik primär aus handelsrechtlicher Perspektive, berücksichtigt aber auch die steuerlichen Implikationen. Eine praxisnahe Darstellung durch Beispiele soll die Verständlichkeit gewährleisten.
- Die rechtlichen Grundlagen der Bewertungseinheiten im Kontext des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG).
- Die verschiedenen Arten von Bewertungseinheiten (micro, macro, portfolio hedges) und deren Charakteristika.
- Die Voraussetzungen für die Bildung und bilanzielle Darstellung von Bewertungseinheiten.
- Die bilanzielle Abbildung von Bewertungseinheiten in Handels- und Steuerbilanzen.
- Die steuerlichen Folgen der Bildung von Bewertungseinheiten.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Risikominimierung im unternehmerischen Alltag ein und stellt die Bewertungseinheiten als ein Instrument zur Risikominderung vor. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Erfassung von Bewertungseinheiten in Handels- und Steuerbilanzen und kündigt die methodische Vorgehensweise an, die auf Gesetzestexten aus Handels- und Steuerrecht basiert und durch praxisnahe Beispiele veranschaulicht wird. Das Ziel ist eine umfassende und nachvollziehbare Darstellung des Themas.
2. Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz: Dieses Kapitel dient als Vorwort und erläutert das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) von 2009. Es hebt wichtige Inhalte und Hauptziele des Gesetzes hervor und bereitet den Leser auf die detaillierte Behandlung von Bewertungseinheiten vor. Der Fokus liegt auf der gesetzlichen Verankerung der Bewertungseinheiten, die zuvor zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zählten.
3. Grundsätze von Bewertungseinheiten: Dieses Kapitel klärt den Begriff und die Grundidee von Bewertungseinheiten. Es beschreibt absicherungsfähige Grundgeschäfte und mögliche Sicherungsinstrumente, wobei der Begriff des Hedging (Absicherung) im Kontext der internationalen Rechnungslegung (IAS/IFRS) erläutert wird. Der Abschnitt legt die Grundlage für das Verständnis der weiteren Kapitel, indem er die grundlegenden Konzepte und Zusammenhänge definiert.
4. Arten von Bewertungseinheiten: Hier werden die drei Arten von Bewertungseinheiten – micro hedges, macro hedges und portfolio hedges – differenziert beschrieben. Dieses Kapitel vertieft das Verständnis der verschiedenen Arten von Absicherungsstrategien und ihrer Anwendung in der Praxis. Die Unterscheidung der Arten ist essentiell für die korrekte Anwendung und bilanzielle Abbildung.
5. Voraussetzungen für die Bildung von Bewertungseinheiten: Dieses Kapitel listet und beschreibt die Voraussetzungen auf, die für eine wirksame Bildung und bilanzielle Darstellung von Bewertungseinheiten erfüllt sein müssen. Es behandelt die Notwendigkeit vergleichbarer Risiken und die Effektivität der Sicherungsbeziehung, einschließlich der Anwendung von Methoden zur Effektivitätsbestimmung sowie die Sicherungsabsicht und deren Dokumentation. Dieser Abschnitt ist zentral für die rechtliche und bilanzielle Zulässigkeit von Bewertungseinheiten.
6. Bilanzielle Abbildung von Bewertungseinheiten: Dieses Kapitel thematisiert die konkrete Bilanzierung von Bewertungseinheiten, getrennt nach Handels- und Steuerbilanz. Es zeigt anhand von Fallbeispielen die Auswirkungen auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung auf. Die detaillierte Darstellung der bilanzrechtlichen und steuerrechtlichen Behandlung ist der Kern der Arbeit und verdeutlicht die praktischen Implikationen.
Schlüsselwörter
Bewertungseinheiten, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuerbilanz, Handelsbilanz, Risikomanagement, Hedging, micro hedge, macro hedge, portfolio hedge, § 5 (1a) EStG, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB), Sicherungsbeziehung, Effektivitätsbestimmung.
Häufig gestellte Fragen zu "Bewertungseinheiten in Handels- und Steuerbilanzen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Erfassung von Bewertungseinheiten in Handels- und Steuerbilanzen. Sie untersucht die Sinnhaftigkeit von Bewertungseinheiten als Instrument zur Risikominderung im unternehmerischen Alltag und analysiert die Thematik aus handelsrechtlicher und steuerlicher Perspektive.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen der Bewertungseinheiten im Kontext des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), die verschiedenen Arten von Bewertungseinheiten (micro, macro, portfolio hedges), die Voraussetzungen für deren Bildung und bilanzielle Darstellung, sowie die bilanzielle Abbildung in Handels- und Steuerbilanzen inklusive der steuerlichen Folgen.
Was ist das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und welche Rolle spielt es?
Das BilMoG von 2009 bildet den rechtlichen Rahmen für die Behandlung von Bewertungseinheiten. Die Arbeit erläutert wichtige Inhalte und Ziele des BilMoG im Bezug auf Bewertungseinheiten, die zuvor zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zählten.
Welche Arten von Bewertungseinheiten gibt es?
Die Arbeit unterscheidet zwischen drei Arten von Bewertungseinheiten: micro hedges, macro hedges und portfolio hedges. Jedes dieser Hedge-Verfahren wird detailliert beschrieben und ihre jeweiligen Charakteristika und Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis erläutert.
Welche Voraussetzungen müssen für die Bildung von Bewertungseinheiten erfüllt sein?
Die Bildung von Bewertungseinheiten setzt das Vorliegen vergleichbarer Risiken, die Effektivität der Sicherungsbeziehung (inkl. Anwendung von Methoden zur Effektivitätsbestimmung), sowie eine dokumentierte Sicherungsabsicht voraus. Diese Voraussetzungen sind essentiell für die rechtliche und bilanzielle Zulässigkeit.
Wie werden Bewertungseinheiten in der Handels- und Steuerbilanz abgebildet?
Die Arbeit beschreibt die konkrete bilanzielle Abbildung von Bewertungseinheiten sowohl in der Handelsbilanz als auch in der Steuerbilanz. Anhand von Beispielen werden die Auswirkungen auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung veranschaulicht. Der Fokus liegt auf der detaillierten Darstellung der handels- und steuerrechtlichen Behandlung.
Welche steuerlichen Folgen hat die Bildung von Bewertungseinheiten?
Die Arbeit beleuchtet die steuerlichen Implikationen der Bildung von Bewertungseinheiten, insbesondere im Kontext von § 5 (1a) EStG. Die Zielsetzung und der Ansatz in der Steuerbilanz nach dieser gesetzlichen Regelung werden detailliert erklärt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bewertungseinheiten, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuerbilanz, Handelsbilanz, Risikomanagement, Hedging, micro hedge, macro hedge, portfolio hedge, § 5 (1a) EStG, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB), Sicherungsbeziehung, Effektivitätsbestimmung.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit basiert auf Gesetzestexten aus Handels- und Steuerrecht und wird durch praxisnahe Beispiele veranschaulicht, um eine umfassende und nachvollziehbare Darstellung zu gewährleisten.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die Arbeit enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen, welche einen umfassenden Überblick über die behandelten Themen bieten.
- Quote paper
- Konrad Beck (Author), 2014, Analyse der Erfassung von Bewertungseinheiten in Handels- und Steuerbilanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/454195