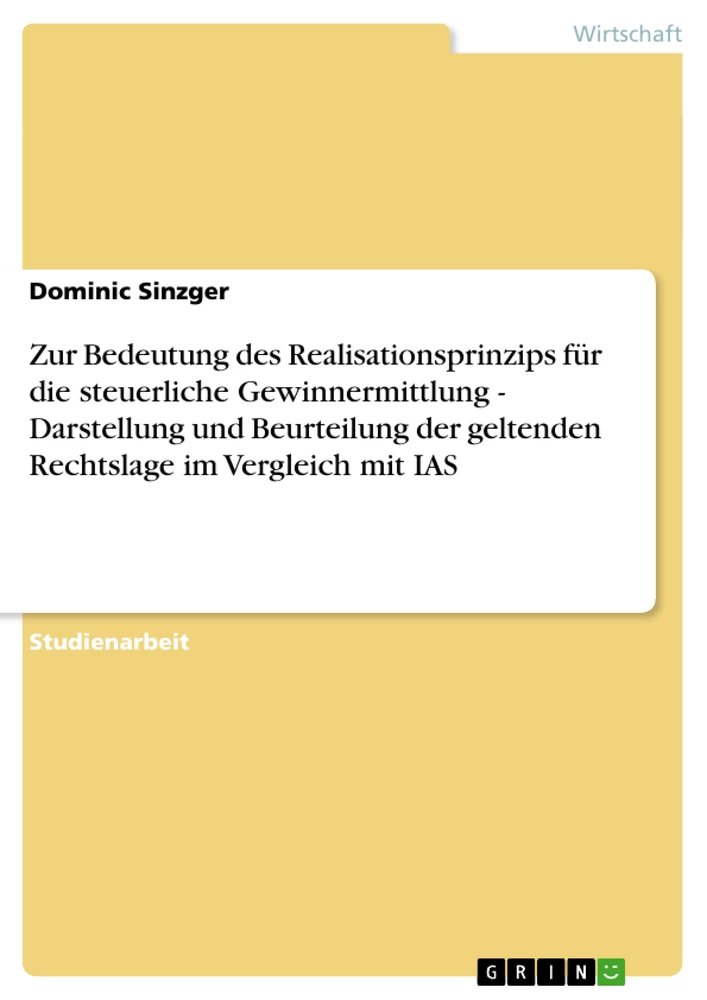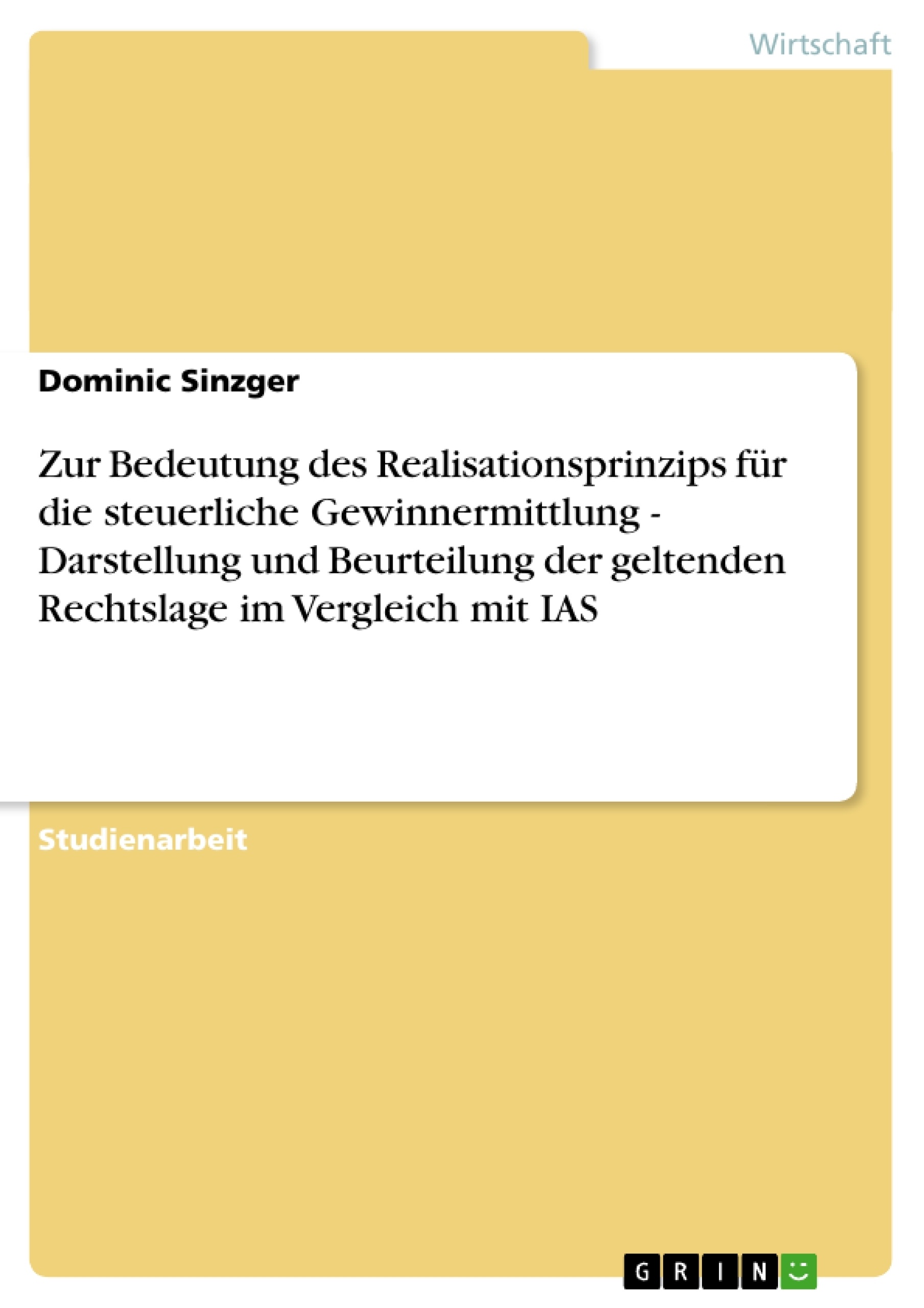Erstmals in der Geschichte der deutschen Rechnungslegung kam das Realisations-prinzip durch die Aktienrechtsnovelle von 1884 zum Vorschein. Ab diesem Zeit-punkt war es Aktiengesellschaften untersagt, Vermögensgegenstände höher als zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten anzusetzen, um dadurch zu verhindern, dass noch nicht durch den Umsatz realisierte Gewinne zur Ausschüttung gelangen konnten. Für die Steuerbilanz wurde das Realisationsprinzip mit der Gesetzesnovel-lierung von 1921 eingeführt und gilt seit dem Bilanzrichtliniengesetz von 1985 in Deutschland rechtsformunabhängig. Heute ist es als Ausfluss des Vorsichtsprinzips wesentlicher Bestandteil der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Durch die in den letzten Jahren zunehmende Internationalisierung der Rechnungslegung und die dadurch vertretenen unterschiedlichen Auffassungen über die Realisation von Gewinnen, wurden auch in Deutschland die Diskussionen über das Realisationsprin-zips wieder neu entfacht. Ziel dieser Arbeit ist es, die Bedeutung des Realisations-prinzips für die steuerliche Gewinnermittlung zu erörtern und die geltende Rechtsla-ge mit den internationalen Vorschriften zu vergleichen. Im ersten Teil werden die Grundlagen der steuerlichen Gewinnermittlung sowie die Bedeutung des bilanzrecht-lichen Realisationsprinzips für das Steuerrecht erläutert. Im zweiten Teil werden die Auffassungen und Vorschriften der internationalen Rechnungslegung nach IAS/IFRS bezüglich des Realisationsprinzips im Rahmen der periodengerechten Erfolgsermitt-lung dargestellt, mit den handelsrechtlichen Vorschriften verglichen und kritisch gewürdigt. Dabei wird hauptsächlich auf die Unterschiede bei der Gewinnermittlung des umsatzorientierten Kerngeschäfts der Unternehmen eingegangen. Im Mittelpunkt der Arbeit steht hierbei die Behandlung mehrperiodischer Fertigungsaufträge bzw. Dienstleistungen. Auf die nach internationalen Standards zulässige Aktivierung selbst erstellter immaterieller Vermögenswerte sowie auf die international zulässige Neubewertung von Sach- und Finanzanlagen soll im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden. Als Schlusspunkt der Arbeit werden noch mögliche Auswir-kungen der internationalen Rechnungslegung auf das deutsche Realisationsprinzip erörtert, sowie in einem abschließenden Fazit für die Beibehaltung des deutschen Realisationsprinzips plädiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung: Das Realisationsprinzip 1884 und heute
- Gewinnermittlung nach EStG
- Methoden der steuerlichen Gewinnermittlung
- Relevanz der handelsrechtlichen GoB für die Steuerbilanz
- Inhalt und Bedeutung des Realisationsprinzips nach HGB
- Zeitpunkt der Ertragserfassung im deutschen Bilanzrecht
- Realisationszeitpunkt bei Liefer- und Veräußerungsgeschäften
- Realisationszeitpunkt in anderen Fällen
- Gewinnermittlung nach IAS im Vergleich zum HGB
- „Accrual Principle“ und Realisationsprinzip nach IAS
- Zeitpunkt der erfolgswirksamen Ertragserfassung nach IAS
- Erträge nach IAS 18
- Langfristige Fertigung und mehrperiodische Dienstleistungen
- „Completed-Contract Method“
- „Percentage-of-Completion Method“
- Würdigung und Vergleich der beiden Modelle
- Zeitlich nachgelagerte Ertragserfassung
- Verknüpfung von Ertrags- und Aufwandserfassung
- Zukünftige Bedeutung des handelsrechtlichen Realisationsprinzips im Kontext einer Ausrichtung der dt. Rechnungslegung an internationale Standards
- Anwendung von IAS/IFRS in Deutschland
- „Revenue Recognition“ - Mögliche Änderungen bei der Ertragsermittlung nach IFRS im Hinblick auf eine Relevanz für die steuerliche Gewinnermittlung
- Plädoyer für das deutsche Realisationsprinzip
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung des Realisationsprinzips für die steuerliche Gewinnermittlung in Deutschland und vergleicht die deutsche Rechtslage mit den internationalen Standards nach IAS/IFRS. Das Ziel ist es, die Relevanz des Prinzips im Kontext der periodengerechten Erfolgsrechnung zu beleuchten und seine zukünftige Bedeutung angesichts der Internationalisierung der Rechnungslegung zu diskutieren.
- Das Realisationsprinzip im deutschen Steuerrecht und Handelsrecht
- Vergleich des Realisationsprinzips mit dem „Accrual Principle“ nach IAS/IFRS
- Unterschiede in der Gewinnermittlung bei mehrperiodischen Leistungen (Fertigungsaufträge, Dienstleistungen)
- Auswirkungen internationaler Rechnungslegungsstandards auf das deutsche Realisationsprinzip
- Bewertung und Plädoyer für das deutsche Realisationsprinzip
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Das Realisationsprinzip 1884 und heute: Die Einführung beleuchtet die historische Entwicklung des Realisationsprinzips, beginnend mit seiner erstmaligen Erwähnung in der Aktienrechtsnovelle von 1884 bis zu seiner heutigen Bedeutung als wesentlicher Bestandteil der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Die Arbeit hebt die zunehmende Bedeutung des internationalen Vergleichs im Kontext der Globalisierung hervor und begründet die Notwendigkeit einer Gegenüberstellung der deutschen Rechtslage mit den internationalen Vorschriften nach IAS/IFRS. Der Fokus liegt auf der Gewinnermittlung im umsatzorientierten Kerngeschäft, insbesondere bei mehrperiodischen Fertigungsaufträgen und Dienstleistungen. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Argumentationslinie, welche die Bedeutung des Realisationsprinzips für die steuerliche Gewinnermittlung analysiert und mit internationalen Standards vergleicht.
Gewinnermittlung nach EStG: Dieses Kapitel beschreibt die Methoden der steuerlichen Gewinnermittlung nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) und erläutert die Relevanz der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) für die Steuerbilanz. Es wird der Inhalt und die Bedeutung des Realisationsprinzips nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) detailliert dargestellt, einschließlich des Zeitpunkts der Ertragserfassung bei Liefer- und Veräußerungsgeschäften sowie in anderen Fällen. Der Schwerpunkt liegt auf der Klärung der rechtlichen Grundlagen und der Zusammenhänge zwischen handels- und steuerrechtlicher Gewinnermittlung.
Gewinnermittlung nach IAS im Vergleich zum HGB: In diesem Kapitel werden das „Accrual Principle“ und das Realisationsprinzip nach den International Accounting Standards (IAS) und International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgestellt und mit den handelsrechtlichen Vorschriften verglichen. Der Vergleich konzentriert sich auf die Unterschiede in der Gewinnermittlung bei mehrperiodischen Leistungen, insbesondere auf die „Completed-Contract Method“ und die „Percentage-of-Completion Method“. Die unterschiedlichen Methoden werden kritisch gewürdigt, um die jeweiligen Vor- und Nachteile im Kontext der periodengerechten Erfolgsrechnung zu beleuchten.
Zukünftige Bedeutung des handelsrechtlichen Realisationsprinzips im Kontext einer Ausrichtung der dt. Rechnungslegung an internationale Standards: Dieses Kapitel analysiert die potenziellen Auswirkungen der zunehmenden Anwendung von IAS/IFRS in Deutschland auf das deutsche Realisationsprinzip. Es untersucht die „Revenue Recognition“-Standards und deren mögliche Änderungen in der Ertragsermittlung nach IFRS und deren Relevanz für die steuerliche Gewinnermittlung. Der Abschnitt beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Annäherung der deutschen Rechnungslegung an internationale Standards ergeben.
Schlüsselwörter
Realisationsprinzip, Gewinnermittlung, Steuerbilanz, Handelsgesetzbuch (HGB), Einkommensteuergesetz (EStG), International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS), Accrual Principle, periodengerechte Erfolgsrechnung, mehrperiodische Leistungen, Completed-Contract Method, Percentage-of-Completion Method, deutsche Rechnungslegung, Internationale Rechnungslegung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Seminararbeit - Das Realisationsprinzip
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Bedeutung des Realisationsprinzips für die steuerliche Gewinnermittlung in Deutschland und vergleicht die deutsche Rechtslage mit internationalen Standards (IAS/IFRS). Der Fokus liegt auf der periodengerechten Erfolgsrechnung, insbesondere bei mehrperiodischen Leistungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Realisationsprinzip im deutschen Steuer- und Handelsrecht, vergleicht es mit dem „Accrual Principle“ nach IAS/IFRS, untersucht Unterschiede in der Gewinnermittlung bei mehrperiodischen Leistungen (z.B. Fertigungsaufträge, Dienstleistungen), analysiert die Auswirkungen internationaler Rechnungslegungsstandards auf das deutsche Realisationsprinzip und beinhaltet eine Bewertung und ein Plädoyer für das deutsche Realisationsprinzip.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die historische Entwicklung des Realisationsprinzips. Es folgen Kapitel zur Gewinnermittlung nach EStG (inkl. Relevanz der GoB und des Realisationsprinzips nach HGB), einem Vergleich der Gewinnermittlung nach IAS/IFRS mit dem HGB (inkl. „Completed-Contract Method“ und „Percentage-of-Completion Method“), der zukünftigen Bedeutung des Realisationsprinzips im Kontext der Internationalisierung der Rechnungslegung und einem abschließenden Plädoyer.
Was ist das Realisationsprinzip?
Das Realisationsprinzip ist ein wesentlicher Bestandteil der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Es bestimmt den Zeitpunkt der Erfassung von Erträgen in der Bilanz. Im Wesentlichen besagt es, dass Erträge erst dann erfasst werden, wenn sie realisiert sind, d.h. wenn ein Rechtsanspruch auf die Zahlung des Ertrages entstanden ist und der Ertrag mit hinreichender Sicherheit bewertet werden kann.
Wie unterscheidet sich das Realisationsprinzip vom „Accrual Principle“?
Das „Accrual Principle“ (Zuflussprinzip) nach IAS/IFRS erfasst Erträge, sobald sie verdient wurden, unabhängig vom tatsächlichen Zahlungseingang. Das Realisationsprinzip hingegen verknüpft die Erfassung von Erträgen eng mit dem Zeitpunkt der Realisierung (Rechtsanspruch und sichere Bewertung).
Welche Methoden zur Gewinnermittlung bei mehrperiodigen Leistungen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die „Completed-Contract Method“ und die „Percentage-of-Completion Method“ zur Gewinnermittlung bei mehrperiodigen Leistungen. Die „Completed-Contract Method“ erfasst den Gewinn erst nach Abschluss des Auftrags, während die „Percentage-of-Completion Method“ den Gewinn anteilig über die Projektlaufzeit verteilt.
Welche Auswirkungen haben internationale Rechnungslegungsstandards auf das deutsche Realisationsprinzip?
Die zunehmende Anwendung von IAS/IFRS in Deutschland könnte das deutsche Realisationsprinzip beeinflussen. Die Arbeit analysiert die „Revenue Recognition“-Standards und deren mögliche Auswirkungen auf die Ertragsermittlung nach IFRS und deren Relevanz für die steuerliche Gewinnermittlung.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit schließt mit einem Plädoyer für das deutsche Realisationsprinzip, wobei die Argumentation auf den im Vergleich zu den internationalen Standards dargestellten Vor- und Nachteilen basiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Realisationsprinzip, Gewinnermittlung, Steuerbilanz, Handelsgesetzbuch (HGB), Einkommensteuergesetz (EStG), International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS), Accrual Principle, periodengerechte Erfolgsrechnung, mehrperiodische Leistungen, Completed-Contract Method, Percentage-of-Completion Method, deutsche Rechnungslegung, internationale Rechnungslegung.
- Quote paper
- Diplomkaufmann Dominic Sinzger (Author), 2005, Zur Bedeutung des Realisationsprinzips für die steuerliche Gewinnermittlung - Darstellung und Beurteilung der geltenden Rechtslage im Vergleich mit IAS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45393