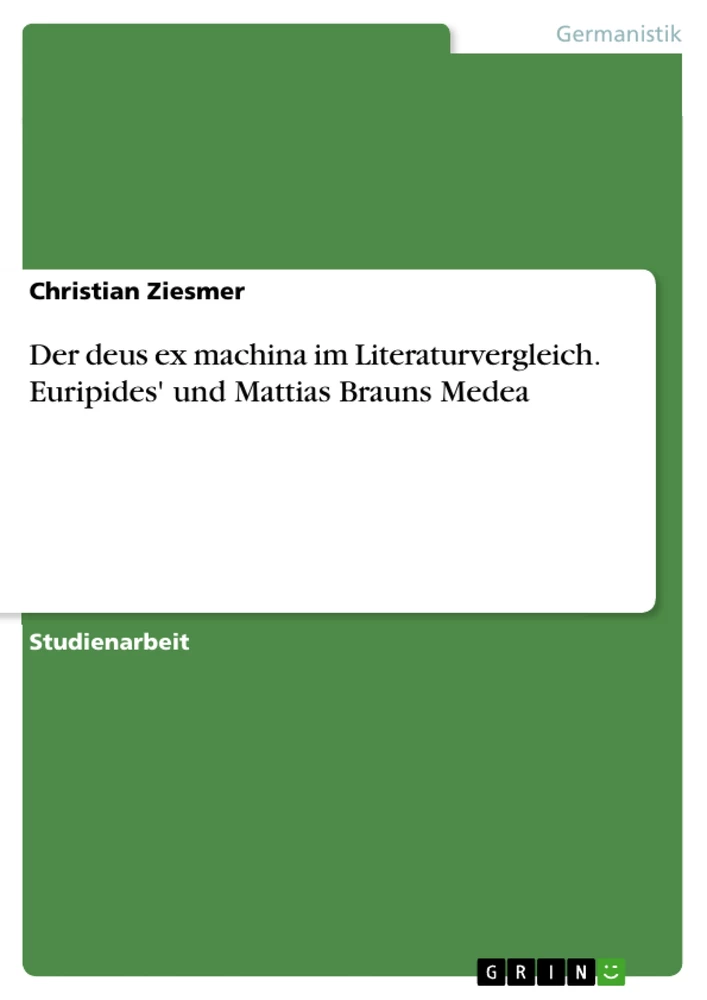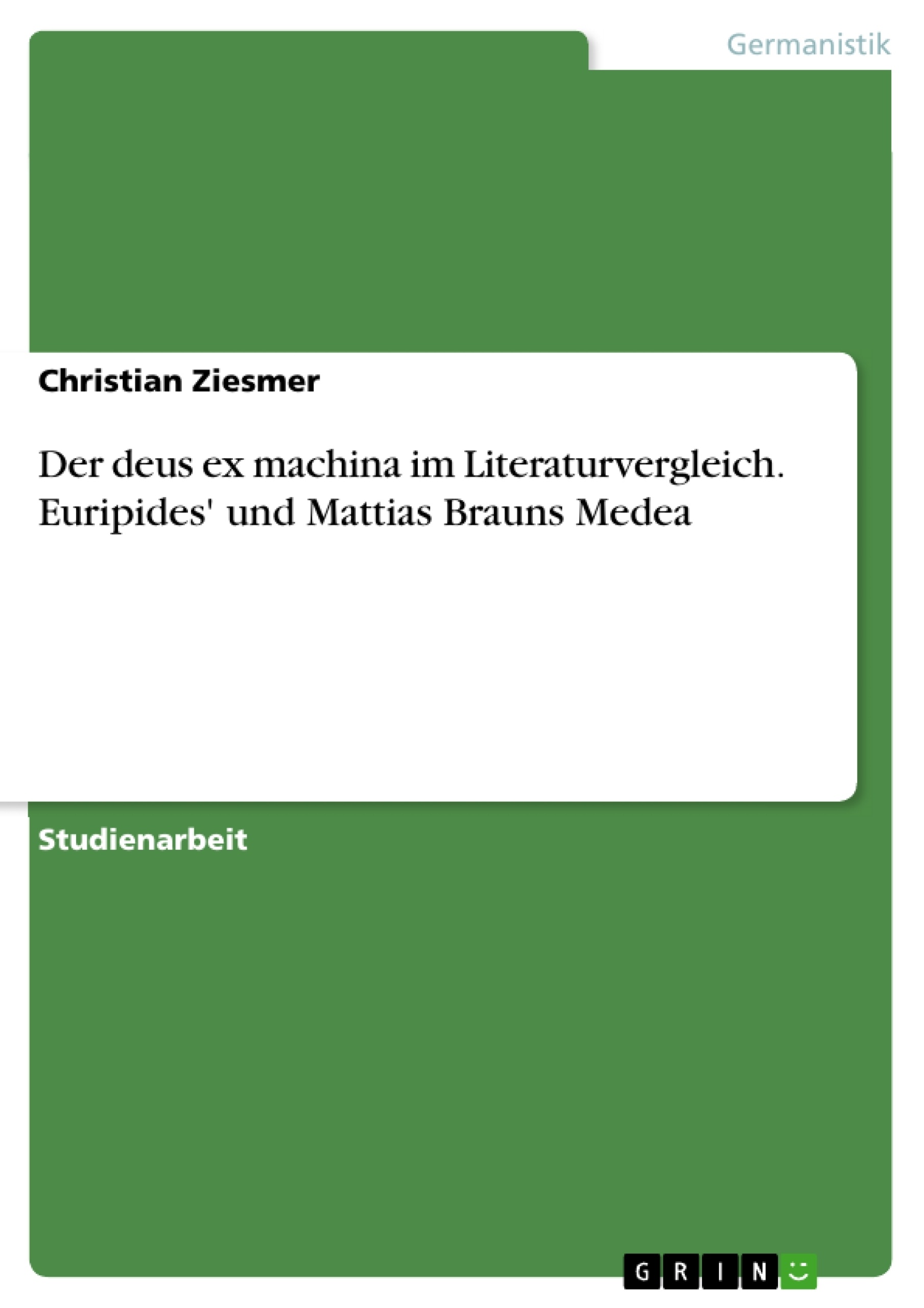In dieser Hausarbeit wird die Neugestaltung der Schlussszene bei Braun im Bezug zum deus ex machina bei Euripides untersucht. Hierzu wird zuallererst der Begriff deus ex machina und Wandlungsprozess erklärt. Im Anschluss folgt eine kurze Einführung zur Vorgeschichte des Medea- Mythos. Folgend werden beide Werke inhaltlich zusammengefasst, wobei der Schwerpunkt auf eine ausführliche Darstellung der jeweiligen Schlussszene gesetzt wird. Die Schlussszene wird durch zu Hilfenahme der aktuellen Forschungsliteratur analysiert und abschließend die eigenen Schlussfolgerungen entwickelt.
Das Bild der barbarischen Mörderin, die vor der Tötung ihrer Kinder nicht zurückschreckte, wird eine der ersten Assoziationen sein, wenn der Name Medea fällt. Dieses Bild entstand durch den griechischen Tragödiendichter Euripides, der für einen Theaterwettkampf im Jahr 431 v. u. Z., den sogenannten Großen Dionysien, aus der Mutter Medea die Kindsmörderin transformierte. Das Bild der Kindsmörderin blieb über die Jahrhunderte erhalten, doch durchlebte das Theaterstück eine vielschichtige Metamorphose.
Eine der markantesten Stellen der euripideischen Medea ist ein göttlicher Drachenwagen, der Medea vor ihrem irdischen Schicksal rettet. Doch wurde dieses von Euripides erfundene Werkzeug, der deus ex machina, von antiken Mitstreitern kritisiert, da es die wahre Auflösung der Tragödie verhindere. Dieser Version folgend, schuf Mattias Braun im Jahr 1958 seine eigene Version der Tragödie Medea, die im Rahmen der Luisenburger Festspiele uraufgeführt wurde. Im Gegensatz zu vielen bekannten Metamorphosen der Medea veränderte Braun die inhaltliche Struktur von Euripides Medea nicht sehr stark. Doch verzichtete Braun auf die in der Antike umstrittene göttliche Einmischung in der Schlussszene.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsliteratur
- 3. deus ex machina
- 4. Medea
- 4.1 Vorgeschichte der Argonauten
- 4.2 Euripides' Medea
- 4.2.1 Inhalt
- 4.2.2 Mord und Rettung
- 4.2.3 Bedeutung des deus ex machina
- 4.3 Brauns Medea
- 4.3.1 Bemerkung der inhaltlichen Nähe
- 4.3.2 Der „fehlende“ deus ex machina
- 4.3.3 Bedeutung der Schlussszene
- 5. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Neugestaltung der Schlussszene in Mattias Brauns Medea im Vergleich zu Euripides' Medea, mit besonderem Fokus auf die Rolle des deus ex machina. Die Arbeit analysiert, wie der Verzicht auf die göttliche Intervention bei Braun die Bedeutung und Interpretation der Tragödie beeinflusst.
- Der deus ex machina in der antiken griechischen Tragödie und seine Kritik.
- Vergleich der inhaltlichen Strukturen von Euripides' und Brauns Medea.
- Analyse der Schlussszene in beiden Werken und deren jeweilige Bedeutung.
- Die Auswirkungen des fehlenden deus ex machina auf die Interpretation von Brauns Medea.
- Die Relevanz der Forschungsliteratur zur Medea und zum deus ex machina.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor: den Vergleich der Medea-Adaptionen von Euripides und Mattias Braun, insbesondere im Hinblick auf den deus ex machina. Sie skizziert das gängige Bild der Medea als Kindsmörderin und hebt die Bedeutung des deus ex machina in Euripides’ Stück hervor, der in der Folgezeit kontrovers diskutiert wurde. Die Arbeit kündigt den methodischen Ansatz an: Zuerst wird der Begriff deus ex machina erläutert, anschließend folgt eine kurze Einführung in den Medea-Mythos, danach werden beide Werke im Hinblick auf ihre Schlussszenen verglichen und analysiert, um schließlich eigene Schlussfolgerungen zu ziehen.
2. Forschungsliteratur: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Forschungsliteratur zu Euripides' Medea und dem deus ex machina. Es zeigt, dass es zwar umfangreiche Literatur zu Euripides selbst gibt, die Forschung zum deus ex machina jedoch begrenzt ist. Die Arbeit nennt Andreas Spira und Wieland Schmidt (1963) sowie Walter Nicolai (1990) als wichtige Quellen zu Euripides und hebt Kurt Roeske (2006) als eine der wenigen Quellen hervor, die sich mit Brauns Medea auseinandersetzen, insbesondere mit dem Schlussakt. Das Kapitel betont die Forschungslücke bezüglich Brauns Medea und die Notwendigkeit, diese zu schließen.
3. deus ex machina: Dieses Kapitel erklärt den Begriff deus ex machina – „Gott aus der Maschine“ – und seine Funktion im antiken griechischen Theater. Es beschreibt den deus ex machina als einen Theatercoup, der dazu dient, ausweglose Konfliktsituationen aufzulösen. Der Kapitel beschreibt die Verwendung von mechanischen Bühnenmitteln zur Inszenierung des deus ex machina und diskutiert die Kritik an diesem dramaturgischen Mittel, die von der Antike bis ins 18. Jahrhundert reicht. Der Kapitel beschreibt die Weiterentwicklung des Konzepts über die Jahrhunderte, wobei der göttliche Bezug verloren ging und fiktive oder menschliche Figuren die Rolle des deus ex machina übernahmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Medea – Vergleich Euripides und Braun
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit vergleicht die Schlussszenen von Euripides' und Mattias Brauns Adaptionen der Medea-Tragödie, mit besonderem Fokus auf die Rolle des deus ex machina. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse, wie der Verzicht auf die göttliche Intervention in Brauns Version die Bedeutung und Interpretation des Stücks beeinflusst.
Welche Ziele verfolgt die Hausarbeit?
Die Arbeit untersucht den deus ex machina in der antiken griechischen Tragödie und seine Kritik, vergleicht die inhaltlichen Strukturen beider Medea-Versionen, analysiert die Schlussszenen und deren Bedeutung, untersucht die Auswirkungen des fehlenden deus ex machina auf Brauns Medea und beleuchtet die Relevanz der Forschungsliteratur zum Thema.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Forschungsliteratur, deus ex machina, Medea (mit Unterkapiteln zu Euripides' und Brauns Version) und Schlussfolgerungen. Die Einleitung stellt das Thema vor und skizziert den methodischen Ansatz. Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über die vorhandene Forschungsliteratur. Kapitel drei erklärt den Begriff des deus ex machina. Kapitel vier vergleicht die beiden Medea-Adaptionen, insbesondere ihre Schlussszenen. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist ein deus ex machina?
Der Begriff „deus ex machina“ bedeutet „Gott aus der Maschine“. Im antiken griechischen Theater bezeichnete er einen dramaturgischen Kniff, bei dem eine göttliche Figur unerwartet eingreift, um ausweglose Konfliktsituationen zu lösen. Die Inszenierung erfolgte oft mit Hilfe mechanischer Bühnenmittel. Die Verwendung des deus ex machina wurde kontrovers diskutiert und seine Bedeutung hat sich im Laufe der Zeit gewandelt, wobei der göttliche Bezug im Laufe der Zeit verloren ging.
Wie werden Euripides' und Brauns Medea verglichen?
Die Hausarbeit vergleicht die beiden Medea-Versionen vor allem anhand ihrer Schlussszenen. Ein zentrales Element des Vergleichs ist die An- bzw. Abwesenheit des deus ex machina und die daraus resultierenden Unterschiede in der Bedeutung und Interpretation der jeweiligen Tragödie. Die Arbeit untersucht auch die inhaltlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Werke.
Welche Forschungsliteratur wird verwendet?
Die Hausarbeit bezieht sich auf verschiedene Forschungsarbeiten zu Euripides' Medea und dem deus ex machina. Sie nennt Andreas Spira und Wieland Schmidt (1963) sowie Walter Nicolai (1990) als wichtige Quellen zu Euripides und Kurt Roeske (2006) als eine der wenigen Quellen zu Brauns Medea. Die Arbeit hebt die Forschungslücke bezüglich Brauns Medea hervor.
Was sind die zentralen Schlussfolgerungen der Hausarbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen werden im fünften Kapitel der Hausarbeit präsentiert. Es ist zu erwarten, dass die Arbeit die Auswirkungen des fehlenden deus ex machina auf die Interpretation von Brauns Medea herausarbeitet und die Bedeutung dieses Unterschieds im Vergleich zu Euripides’ Version beleuchtet.
- Quote paper
- Christian Ziesmer (Author), 2015, Der deus ex machina im Literaturvergleich. Euripides' und Mattias Brauns Medea, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/453728