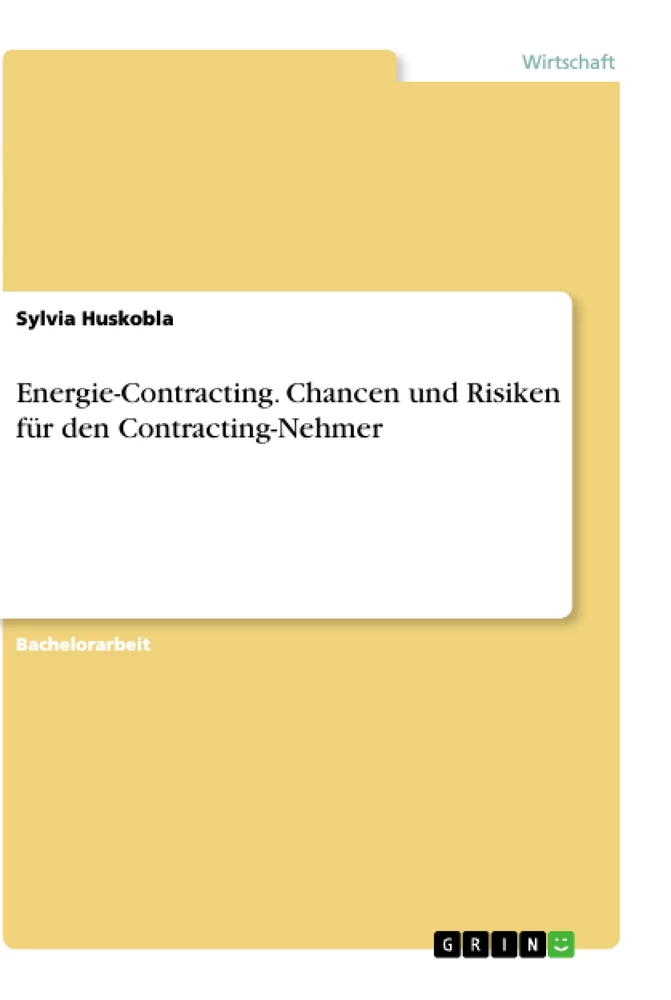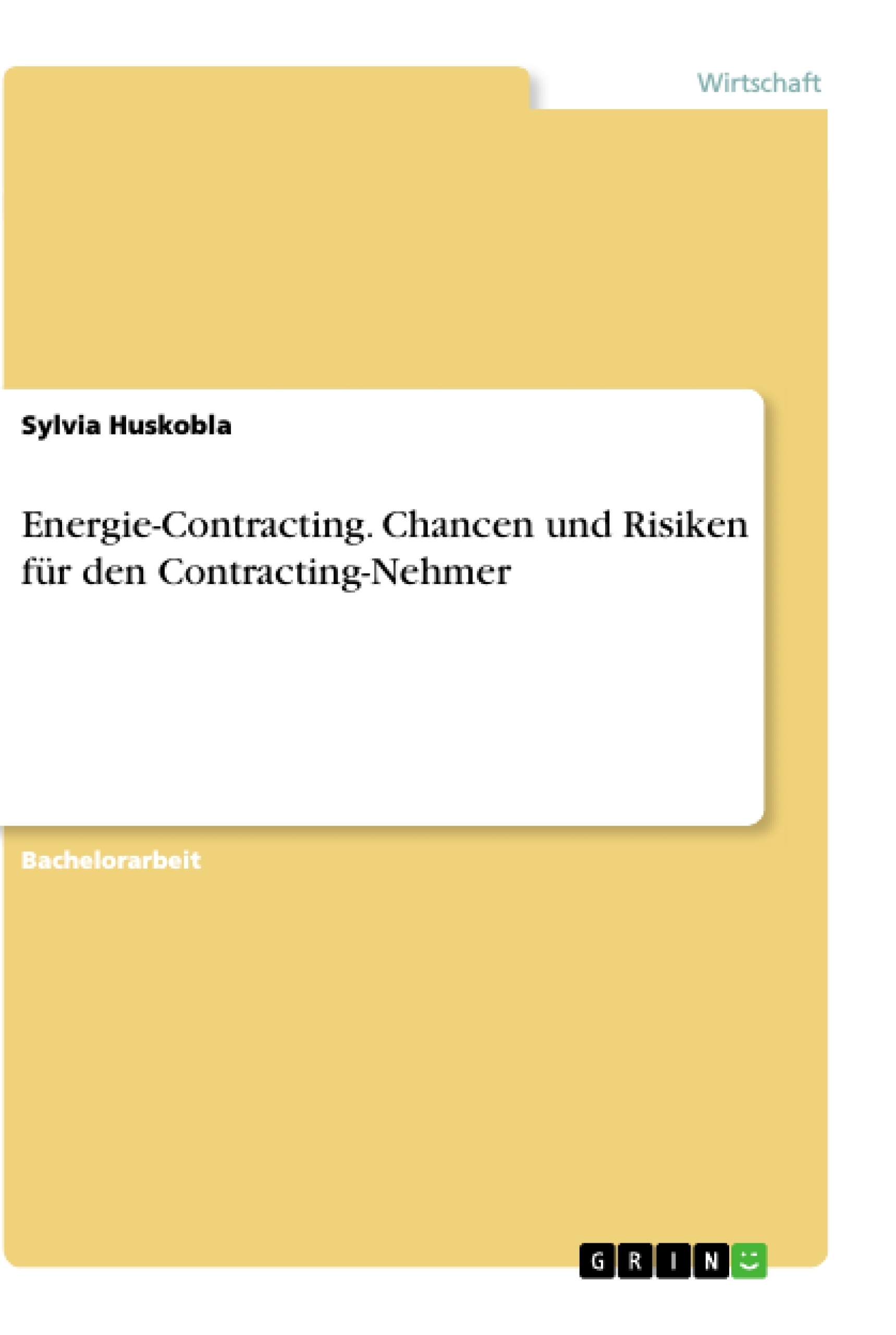Welche Risiken und Chancen ergeben sich für den Contracting-Nehmer beim Energie-Contracting und welche Möglichkeiten zur Reduzierung der Risiken existieren bei einer Abwandlung des ursprünglichen Contracting-Modells? Mit dieser Leitfrage befasst sich die Problemstellung dieser wissenschaftlichen Arbeit.
Das Geschäftsmodell Energie-Contracting wird in der Energiewirtschaft seit einiger Zeit angewendet und erhält zunehmend an Bedeutung bei den Anbietern, aber auch bei den Kunden. Das Konzept des Contractings beinhaltet nicht nur Vorteile für die Geschäftspartner, sondern umfasst auch eine Reihe an Nachteilen für beide Seiten. Aus diesem Grund werden die Vertragsfreiheiten der Energieversorgungsunternehmen durch bestimmte Vorgaben begrenzt, die in den allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme formuliert wurden. Zusätzlich zum Schutz des Endverbrauchers sind die Anbieter bei Contracting-Geschäften mit Vermietern dazu verpflichtet, die speziellen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches bezüglich des Mieterrechts zu beachten und einzuhalten, welche Bestandteil der Mieterrechtsreform im Jahr 2013 war.
Insbesondere hinsichtlich des Aspektes von Risiken bietet das Contractinggeschäft eine Vielzahl an positiven Effekten für den Contracting-Nehmer, da der Contractor den Großteil der Hauptrisiken, wie zum Beispiel das leistungswirtschaftliche Risiko, selbst und eigenständig trägt. Dennoch existieren für den Contracting-Nehmer einige Gefahren, die es zu vermindern oder sogar zu vermeiden gilt.
Es ist zur Beantwortung der Fragestellung notwendig, zu Beginn das Geschäftsmodell des Energie-Contracting zu erläutern und die Risiken zu bestimmen. Anschließend wird das ähnliche Konzept des Leasings mit den zwei Hauptvertragsvarianten beleuchtet. Eine Beschreibung und die Identifizierung charakteristische Merkmale dienen als Grundlage. Eine Herausforderung besteht insbesondere bei der Betrachtung der Möglichkeiten zur Risikovermeidung bzw. -verminderung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung: Energie-Contracting
- 2. Problemstellung der Thematik
- 3. Aufbau der Arbeit
- 4. Das Energie-Contracting-Geschäft
- 4.1 Definition Energie-Contracting
- 4.2 Die Marktentwicklung des Energie-Contractings
- 4.3 Merkmale und Besonderheiten beim Contracting
- 4.3.1 Das rechtliche und wirtschaftliche Eigentum
- 4.3.2 Die Laufzeit des Geschäftsmodells
- 4.3.3 Das Entgelt: die Contracting-Rate
- 4.4 Arten von Contracting-Modellen
- 4.4.1 Das Energieliefer-Contracting
- 4.4.2 Das Energieeinspar-Contracting
- 4.4.3 Das Betriebsführungs-Contracting (technisches Anlagenmanagement)
- 4.4.4 Das Finanzierungs-Contracting
- 4.5 Rechtliche Rahmenbedingungen zum Energie-Contracting
- 4.5.1 Wesentliche gesetzliche Bestimmungen in der Energiewirtschaft
- 4.5.1.1 Das Gesetz zur Stromsteuer
- 4.5.1.2 Das Erneuerbarer-Energien-Gesetz
- 4.5.1.3 Die AVB Fernwärme Verordnung
- 4.5.2 Relevante Regelungen zu den einzelnen Vertragsarten
- 4.5.3 Vorschriften zum Eigentum der Anlage
- 4.5.4 Spezielle Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch für die Wohnungswirtschaft
- 4.5.1 Wesentliche gesetzliche Bestimmungen in der Energiewirtschaft
- 4.6 Vor- und Nachteile von Contracting-Geschäften
- 4.6.1 Chancen für den Contracting-Nehmer
- 4.6.2 Risiken aus Sicht des Contracting-Nehmers
- 5. Exkurs: Leasing als alternatives Geschäftsmodell
- 5.1 Allgemeine Fakten und Begriffsbestimmung
- 5.2 Varianten des Leasingvertrages
- 5.3 Chancen und Risiken für den Leasingnehmer
- 5.4 Die Regelungen des IFRS 16: Bedeutung für das Leasing
- 6. Abgrenzung zwischen Energie-Contracting und Leasing
- 7. Zusammenfassung der Ergebnisse und eine Möglichkeit zur Abwandlung des ursprünglichen Contracting-Modells
- 8. Kritische Würdigung zum Contracting
- 9. Ausblick: Prognose zur Marktentwicklung des Energie-Contractings
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Energie-Contracting aus der Perspektive des Contracting-Nehmers. Ziel ist es, die Chancen und Risiken dieser Geschäftsmodelle umfassend darzustellen und zu analysieren. Der Fokus liegt auf einer differenzierten Betrachtung der verschiedenen Vertragsarten und der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen.
- Definition und Marktentwicklung des Energie-Contractings
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Vertragsgestaltung
- Chancen und Risiken für den Contracting-Nehmer
- Vergleich mit alternativen Geschäftsmodellen (z.B. Leasing)
- Ausblick auf die zukünftige Marktentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Energie-Contracting: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Energie-Contractings ein und beschreibt den Gegenstand der Arbeit. Es legt den Fokus auf die Perspektive des Contracting-Nehmers und skizziert die zentralen Fragestellungen.
2. Problemstellung der Thematik: Dieses Kapitel spezifiziert die Problemstellung und begründet die Notwendigkeit einer detaillierten Untersuchung der Chancen und Risiken des Energie-Contractings für den Contracting-Nehmer. Es unterstreicht die Komplexität der Vertragsgestaltung und der rechtlichen Rahmenbedingungen.
3. Aufbau der Arbeit: In diesem Kapitel wird der Aufbau der Arbeit erläutert und eine Übersicht über die einzelnen Kapitel gegeben. Es dient als Orientierungshilfe für den Leser und strukturiert den Gesamtüberblick der Arbeit.
4. Das Energie-Contracting-Geschäft: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung des Energie-Contracting-Geschäfts. Es definiert den Begriff, analysiert die Marktentwicklung, beschreibt die verschiedenen Arten von Contracting-Modellen und beleuchtet die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen. Es werden sowohl die Chancen (Kosteneinsparungen, innovative Anlagen) als auch die Risiken (Contractor-Auswahl, Preisanpassungen, lange Vertragslaufzeiten) für den Contracting-Nehmer detailliert dargestellt.
5. Exkurs: Leasing als alternatives Geschäftsmodell: Dieser Exkurs vergleicht Energie-Contracting mit Leasing als alternativem Geschäftsmodell. Er erläutert verschiedene Leasingvarianten, deren Chancen und Risiken und die Bedeutung von IFRS 16 für das Leasing. Der Vergleich dient dazu, die Vor- und Nachteile von Energie-Contracting im Kontext anderer Finanzierungs- und Betriebsmodelle aufzuzeigen.
6. Abgrenzung zwischen Energie-Contracting und Leasing: Dieses Kapitel befasst sich mit der systematischen Abgrenzung zwischen Energie-Contracting und Leasing. Es analysiert die wesentlichen Unterschiede in den Vertragsstrukturen, den Risiken und den Vorteilen für die jeweiligen Vertragspartner.
Schlüsselwörter
Energie-Contracting, Contracting-Nehmer, Chancen, Risiken, Rechtliche Rahmenbedingungen, Vertragsgestaltung, Leasing, Marktentwicklung, Energiewirtschaft, Kosteneinsparungen, Vertragslaufzeiten, IFRS 16.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Energie-Contracting
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Energie-Contracting aus der Perspektive des Contracting-Nehmers. Der Fokus liegt auf der umfassenden Darstellung und Analyse der Chancen und Risiken dieser Geschäftsmodelle, insbesondere im Hinblick auf die verschiedenen Vertragsarten und die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Marktentwicklung des Energie-Contractings, die rechtlichen Rahmenbedingungen und Vertragsgestaltung, die Chancen und Risiken für den Contracting-Nehmer, einen Vergleich mit alternativen Geschäftsmodellen wie Leasing und einen Ausblick auf die zukünftige Marktentwicklung. Es werden verschiedene Arten von Contracting-Modellen (Energieliefer-, Energieeinspar-, Betriebsführungs- und Finanzierungs-Contracting) detailliert beschrieben.
Welche Arten von Energie-Contracting-Modellen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Energieliefer-Contracting, Energieeinspar-Contracting, Betriebsführungs-Contracting (technisches Anlagenmanagement) und Finanzierungs-Contracting. Jede Art wird im Detail erläutert.
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet relevante gesetzliche Bestimmungen in der Energiewirtschaft (z.B. Stromsteuergesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, AVB Fernwärme Verordnung), Regelungen zu einzelnen Vertragsarten, Vorschriften zum Eigentum der Anlage und spezielle Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch für die Wohnungswirtschaft.
Wie wird Leasing als alternatives Geschäftsmodell behandelt?
Leasing wird als alternatives Geschäftsmodell zu Energie-Contracting verglichen. Die Arbeit erläutert verschiedene Leasingvarianten, deren Chancen und Risiken und die Bedeutung von IFRS 16 für das Leasing. Der Vergleich dient der Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile beider Modelle.
Welche Chancen und Risiken werden für den Contracting-Nehmer hervorgehoben?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Chancen (z.B. Kosteneinsparungen, innovative Anlagen) und Risiken (z.B. Contractor-Auswahl, Preisanpassungen, lange Vertragslaufzeiten) des Energie-Contractings aus der Sicht des Contracting-Nehmers.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in neun Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einführung und einer Problemstellung, gefolgt von einer detaillierten Darstellung des Energie-Contractings, einem Exkurs zu Leasing, einem Vergleich beider Modelle, einer Zusammenfassung der Ergebnisse, einer kritischen Würdigung und einem Ausblick auf die zukünftige Marktentwicklung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Energie-Contracting, Contracting-Nehmer, Chancen, Risiken, Rechtliche Rahmenbedingungen, Vertragsgestaltung, Leasing, Marktentwicklung, Energiewirtschaft, Kosteneinsparungen, Vertragslaufzeiten, IFRS 16.
- Quote paper
- Sylvia Huskobla (Author), 2018, Energie-Contracting. Chancen und Risiken für den Contracting-Nehmer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/453482