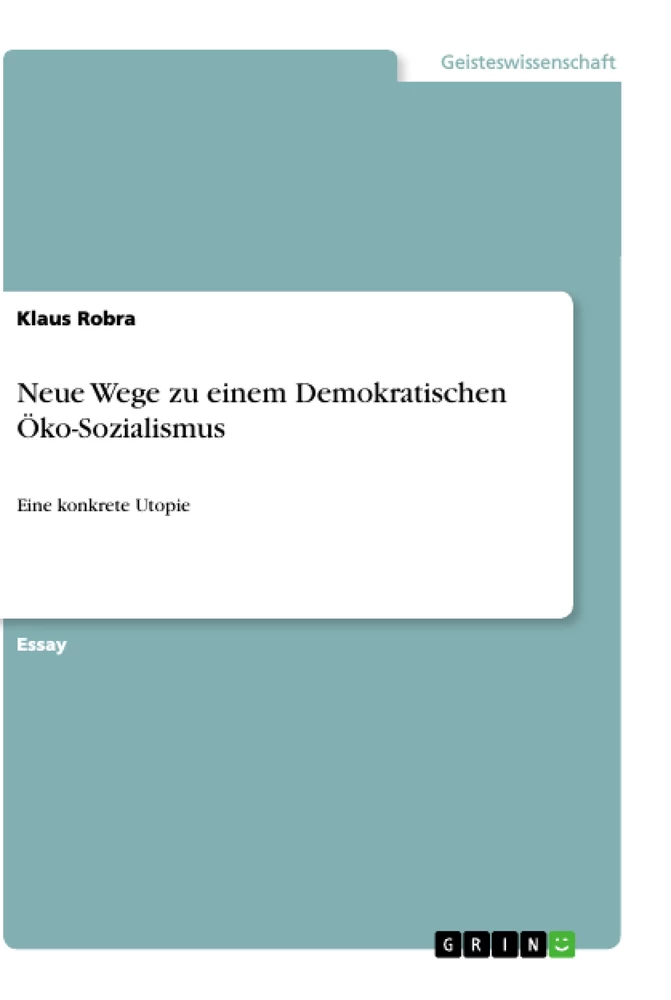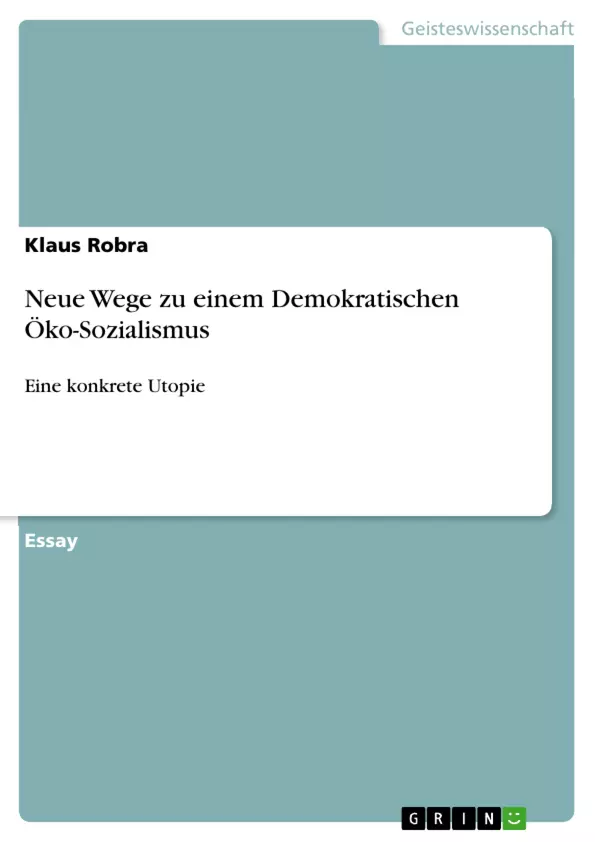Sämtliche bisherigen Versuche, einen Sozialismus, gar einen "mit menschlichem Angesicht", nachhaltig zu etablieren, sind anscheinend gescheitert. Aus dem wohl spektakulärsten Scheitern, dem des im Ostblock "real existierenden Sozialismus", wurde geschlossen, der Sozialismus sei in Theorie und Praxis geschichtlich widerlegt und endgültig besiegt worden. Was schon deshalb nicht zutrifft, weil einige sozialistische Experimente, so das chinesische und das kubanische, weitergehen, wenn auch mit gravierenden Defiziten.
Durch die Wechselfälle des globalisierten neoliberalen Turbo-Kapitalismus ist die aktuelle Lage nahezu unübersichtlich kompliziert geworden. Trotzdem kann und muss mit dem Konzept eines neuen Demokratischen Öko-Sozialismus der Versuch eines Gegenmodells gewagt werden, zumal die akute Verschärfung der Öko-Krise und der weltweiten Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten rasches und zugleich theoretisch fundiertes Handeln erforderlich macht. Einführende und weiterführende Literatur zum Thema gibt es, auch im Internet, in großer Fülle, allerdings anscheinend nur zu den Teilgebieten 'Demokratischer Sozialismus' und 'Ökosozialismus', während es auf die Notwendigkeit einer neuen Synthese von Demokratie, Ökologie und Sozialismus fast gar keine Hinweise gibt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Geschichtsphilosophie, Globalisierung und digitale Revolution
1.1 Ein neuer globaler ‚Player‘: die digitale Revolution
1.2 Globalisierung und digitale Revolution im Jahre 2016
1.3 Die Öko-Krise. Umweltzerstörung und Klimawandel
1.4 Ein Lichtblick: der Pariser Weltklimavertrag von 2015
2. Ein Lösungsvorschlag: Demokratischer Öko-Sozialismus
2.1 Warum Sozialismus?
2.2 Substanzziel Sozialismus.
2.3 Wie aber sollen und können die Substanz-Ziele überhaupt erreicht werden?
2.4 Und was für ein Sozialismus?
2.4.1 Das Sozialistische Projekt in Frankreich 1980-1983
2.4.2 Öko-Sozialismus
2.4.3 Digitaler Sozialismus?
2.5 Marktwirtschaft, Wirtschaftsdemokratie, Marktsozialismus
2.5.1 Zur Theorie des Marktsozialismus
2.6 Synopse: Nah- und Fernziele eines Demokratischen Öko-Sozialismus
2.7 Und wie kann ein Demokratischer Öko-Sozialismus Wirklichkeit werden? Zur Teleo-Logik des Sozialismus in Über-gangsgesellschaften („Die Wahrheit des Sozialen ist der Sozialismus.“)
2.7.1 Zur konkreten Analyse der konkreten Situation
3. Ästhetik. Person – Kunst – Materie – Sozialismus und Freiheit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Sämtliche Versuche, einen Sozialismus, gar „mit menschlichem Angesicht“, zu etablieren, sind anscheinend gescheitert. Aus dem vielleicht spektakulärsten Scheitern, dem des im Ostblock „real existierenden Sozialismus“ zu Beginn der 1990er Jahre, wurde geschlossen, der Sozialismus sei nun in Theorie und Praxis historisch widerlegt und endgültig besiegt worden. Was schon deshalb nicht zutrifft, weil ja einige sozialistische Experimente, darunter das chinesische und das kubanische, weitergehen, wenn auch mit teils gravierenden Defiziten.
Woran ein sozialistisches Experiment in einem hochentwickelten kapitalistischen Land scheitern kann, lässt sich an der Beendigung des französischen ‚Projet socialiste‘ zu Beginn der 1980er Jahre ablesen. Wobei zu beachten ist, dass die aktuelle Lage durch die Wechselfälle des globalisierten neoliberalen Turbo-Kapitalismus nahezu unübersichtlich kompliziert geworden ist. Trotzdem wage ich mit meinem Konzept eines Demokratischen Öko-Sozialismus den Versuch eines Gegenmodells, zumal einige aktuelle Krisen-Symptome, wie die des Klimawandels und der rasanten Verschärfung der sozialen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, sofort durchgreifendes, nachhaltiges Handeln erfordern.
Einführende und weiterführende Literatur zum Thema gibt es, auch im Internet, in großer Fülle, allerdings anscheinend nur zu den Teilgebieten ‚Demokratischer Sozialismus‘ und ‚Ökosozialismus‘, während es kaum Hinweise auf die Notwendigkeit einer neuen Synthese von Ökologie, Sozialismus und Demokratie gibt. Die philosophische Einbettung meines Konzepts ist nachzulesen in meiner Arbeit Person und Materie. Vom Pragmatismus zum Demokratischen Öko-Sozialismus, München, GRIN-Verlag 2017, gratis online unter: http://www.grin.com/de/e-book/375344/. Speziell zur Künstlichen Intelligenz: K.R.: Wie ist Erkenntnis möglich? Kants Theorie und ihre Folgen. Schicksalsfrage der Menschheit? GRIN-Verlag 2018, S. 128-132 bzw. 171 f.
1. Geschichtsphilosophie, Globalisierung und digitale Revolution
„Menschen wollen handeln, Menschen werden handeln“, sagte einmal der Tübinger Romanist Kurt Wais (1907-1995) in einer Vorlesung über die Kultur der italienischen Renaissance, speziell zu Machiavelli. Im Hinblick auf die Geschichte im Allgemeinen füge ich hinzu: Personen handeln, sie machen Geschichte, und zwar auf Grund der materiellen und immateriellen Verhältnisse, die sie vorfinden bzw. in denen sie sich selbst befinden. Gäbe es nur Personen und keine Materie, wäre so etwas wie reiner, „absoluter Geist“ à la Hegel durchaus vorstellbar, und dies auch und gerade als “Motor der Geschichte“. Da aber jede Person selbst aus Körper-Materie besteht, kann es absoluten, im wörtlichen Sinne von der Materie „losgelösten“ Geist nicht geben.
Ohnehin geht es in der Geschichte nicht selten eher ungeistig bzw. „geistlos“ zu. Viel beschworen wurden der „Ungeist des National-sozialismus, ... des Bolschewismus, ... des religiösen Fanatismus“ usw. Wenn nicht einfach „große Männer“ in Haupt- und Staatsaktionen, sondern Personen jeglicher Herkunft, Couleur und Wesensart Geschichte machen, ist deren gesamte Tätigkeit – und nicht nur ihre gesellschaftliche Arbeit – der „Motor der Geschichte“.
Woraus folgt, dass auch die Globalisierung, zumal unter dem Aspekt der Weltgeschichte oder gar der Ewigkeit (‚sub specie aeternitatis‘), keineswegs das Ganze der Geschichte ausmacht. Wobei ich erneut betone, dass dieses Ganze nicht überschaubar ist. So dass zu fragen ist, welche Teilaspekte der Geschichte denn gemeint sein können, wenn von Globalisierung die Rede ist. Dem Wort nach: das Umspannen (sprich: Umspannen!), der Einbezug des gesamten Erdballs in die Geschichtshorizonte der Menschheit und in die Möglichkeiten geschichtlichen Handelns.
Anscheinend beginnt alles „lokal“, z.B. die Geschichte jeder Einzelperson im Mutterleib, aber auch politisch-geografische Expansionen wie die der Geschichte Roms und seines Imperiums. Wonach dann das bloß Lokale aufgegeben wird zu Gunsten stetiger Horizonterweiterung, die schließlich nicht auf einzelne Regionen beschränkt bleibt.
In grauer Vorzeit haben Urmenschen in Horden, größeren Scharen, ihre ursprünglichen Siedlungsgebiete, aus welchen Gründen auch immer, verlassen, um Neuland zu betreten und zu gewinnen, so von Ostafrika aus nach Asien und von dort nach Europa – was sicherlich meistens nicht ohne kriegerische Auseinandersetzungen mit Autochthonen vonstatten ging. Der Krieg sei „der Vater aller Dinge“, meinte Heraklit (um 500 v.Chr.) und, nachhaltiger: „panta rei“, alles ist im Fluss, das Urwort der Geschichts-Dialektik, neben der nicht weniger tiefsinnigen Weisheit des Autors, dass man „nicht zweimal in den gleichen Fluss“ steigt.
Was zweifellos auch für die Globalisierung gilt. Nach Alexander dem Großen ist der Globus nicht mehr der gleiche wie vor ihm. Rom steigerte das ‚Plus ultra‘ in ungeahntem Maße bis an die Ränder der damals bekannten Welt; bis schließlich das Imperium zusammen-brach, hauptsächlich wohl deshalb, weil global nichts Profit-Trächtiges mehr der Expansionssucht zur Verfügung stand. –
Zu Beginn der Neuzeit vermitteln See-Helden wie Kolumbus, Vasco da Gama und Magellan ihren Zeitgenossen die Gewissheit, dass sie auf einem Globus und nicht etwa auf einer Scheibe zu Hause sind. Die Entdecker enthüllen den Charakter des Globalen: das, was die Welt umgreift, das Weltumspannende. Nicht nur Handelsgüter, sondern auch Ideen, Religionen und Weltanschauungen wandern seitdem um den Erdball herum. Eine Migration von Materiellem und Immateriellem, an der sich eine stets wachsende Anzahl von Personen beteiligt, und zwar im Takt und im Gefolge des technischen Fortschritts, der immer mehr Mobilität, Kommunikation, Produktion und Austausch von Gütern aller Art ermöglicht. In höchstem Maße verstärkt durch die Industrielle Revolution; geschichtlich teils grausam erzwungen durch Kriege und Revolutionen, insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert.
So dass sich nunmehr die Frage stellt, was „das alles“, und dabei insonderheit die anscheinend „unaufhaltsame“ Globalisierung, zu bedeuten hat, d.h. was sie nicht nur unserem Verstehen und Verständnis zumutet, sondern auch unserer Fähigkeit zur Anpassung an neue Techniken und Technologien, neue Umweltbedingungen, neue Informations- und Kommunikations-Möglichkeiten, neue Konsum- und Leistungsmodalitäten. Und zwar in einer nicht nur zunehmend vereinheitlichten („integrierten“), sondern auch zuneh-mend zersplitterten, immer unübersichtlicher werdenden Welt-Gesell-schaft.
In frappierender Weise ändern sich die Antworten auf die Fragen nach der Bedeutung der Globalisierung, und zwar oft in Abhängigkeit von teilweise völlig unvorhersehbaren Wechselfällen der Geschichte. So schrieb ich im Jahre 2003 über „die Globalisierungskrise“: „Ungewiss scheint, ob es eine durch die Globalisierung verursachte Krise überhaupt gibt. Neoliberale Theoretiker verneinen dies. Sie versuchen, die negativen Folgen der Globalisierung zu verniedlichen und nur deren positive Wirkungen gelten zu lassen. Der Hauptgrund dafür, dass ich den Begriff Globalisierungs-Krise für richtig und unverzichtbar halte, liegt in der dem Phänomen Globalisierung innewohnenden Tendenz zur Verstetigung und Unumkehrbarkeit (Irreversibilität). Unter den Bedingungen der neoliberalen „freien Marktwirtschaft“ herrscht nahezu schrankenlose, internationale Konkurrenz unter den Produzenten und Anbietern, den kleinen und großen Unternehmen bis hin zu den Handwerksbetrieben. Anscheinend sind fast alle Klein-, Mittel- und Großunternehmer gezwungen, sich an dem gnadenlosen internationalen Konkurrenzkampf zu beteiligen. Das aber ist sozusagen des Pudels Kern. Nicht nur die Mammut-Fusionen (der Großkonzerne und der Hochfinanz) verstetigen die Globalisierung und machen sie unumkehrbar. Wer als Unternehmer überleben will, muss sich – offenbar in der großen Mehrheit der Fälle – an dem „Run ins Ausland“ beteiligen.
Diese Tendenzen können unkritische Beobachter dazu verleiten, die katastrophalen „Nebenwirkungen“ der Globalisierung, z.B. für die Soziale Frage (Verschärfung der sozialen Unterschiede und Gegensätze), für Klima, Umwelt und Weltpolitik, zu übersehen oder als „unwichtig“ von sich zu weisen. Das halte ich für unverantwortlich.
Hinzu kommt, dass auch die nationalen Regierungen anscheinend nicht in der Lage sind, eine politische Kontrolle über den international und weltweit agierenden „Turbo-Kapitalismus“ (den globalisierten Neoliberalismus) zu gewinnen. Durch dessen Verstetigung geraten die politisch Verantwortlichen außerdem in Widersprüche und Zielkonflikte. Schützen und stützen sie die Auslandsaktivitäten ihrer heimischen Unternehmer, nehmen sie stillschweigend die negativen Folgen der Globalisierung in Kauf. Tun sie dies nicht, bezichtigt man sie der Untätigkeit und der Gleichgültigkeit.“[1]
Diese Analyse trifft im Jahre 2016 nicht mehr uneingeschränkt zu. Eher deterministisch nahm ich im Jahre 2003 noch an, dass sich mit der Globalisierung auch der sogenannte Turbo-Kapitalismus verstetigen würde. Das hat sich nicht bestätigt. Als Gründe hierfür nennen Harald Schumann und Christiane Grefe schon im Jahre 2009 – und schon unter dem Eindruck des fürchterlichen Finanzcrashs von 2008 – Folgendes:
„Die wechselvolle Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts belegt: Die grenzenlose Ausdehnung des Kapitalismus ist keineswegs vorherbestimmt. Der Lauf der Geschichte kann durchaus eine andere Richtung nehmen. Es handelt sich um einen dialektischen Prozess. Wo immer der Mechanismus von Angebot und Nachfrage, von Kapitalrendite und Strukturwandel Grenzen überwindet, Partikularinteressen verletzt oder bestehende Kulturen bedroht, erzeugt dieser Vorgang auch Gegenbewegungen. Und die Konsequenzen sind offen. Dass der Trend zur globalen Integration anhält und nicht wieder ins Gegenteil umschlägt, ist keineswegs ausgemacht.“ 2
In der Tat gibt es vielfältige, teils bedenklich populistische Gegenbewegungen gegen die turbo-kapitalistische Globalisierung, die ich hier aus Platzgründen nicht näher beschreiben kann. Weiterhin gültig und geboten ist jedenfalls die Warnung vor einer Verharmlosung katastrophaler „Nebenwirkungen“ der Globalisierung, darunter die der Verschärfung der sozialen Gegensätze und Konflikte, die schleichende bis akute Klima- und Umwelt-Katastrophe, zunehmend ungleicher Handel, zunehmende Weltmarkt-Beherrschung durch einige Großkonzerne (die „Global Players“), mit bösen Folgen wie dem Kollaps ganzer Volkwirtschaften in Afrika und anderswo, was u.a. zu Kriegen, katastrophalen Flüchtlingskrisen und humanitären Katastrophen geführt hat. – Hinzu kommt der Banken- und Finanzcrash des Jahres 2008, mit schwerwiegenden, unabsehbaren Folgen für die Weltwirtschaft und den Verlauf der Globalisierung.
1.1 Ein neuer globaler ‚Player‘: die digitale Revolution
Die globale digitale Revolution unserer Zeit, z.B. durch das Internet (‚WWW‘, das „weltweite Netz“), Computerisierung und Roboterisierung, eröffnet dem Person-Sein einerseits ganz neue Möglichkeiten, gefährdet es aber andererseits in bisher nie gekanntem Maße. Wie u.a. die NSA-Spionage-Affäre gezeigt hat, steht zu befürchten, dass nicht nur das öffentliche, sondern auch das private Leben jeder Einzelperson vollständig ausgespäht wird (bzw. ausgespäht werden kann). Freiheit geht dann vollends verloren, ebenso die Möglichkeit, langfristig wirkliche Freiheit, ein Reich der Freiheit für alle, zu erringen. Dagegen wird sich sowohl die Einzelperson als auch die Gesellschaft zur Wehr setzen müssen, sei es durch private Schutzvorkehrungen (Verschlüsselung der Online-Kommunikation usw.), sei es durch gesetzgeberische Maßnahmen.
Im Übrigen kann man sich über Vor- und Nachteile des Internets im Internet selbst rasch informieren. Wichtigste Vorteile: Information in Hülle und Fülle; über fast alles kann man sich schneller und besser als je zuvor informieren. Man kann jederzeit weltweit Kontakte herstellen, kostengünstig und vielfältig kommunizieren (natürlich auch beruflich und kommerziell); man kann günstig einkaufen, Reisen buchen, Bankgeschäfte abwickeln usw.
Womit aber auch die Schattenseiten schon erkennbar werden: Kriminelle können sich ins Online-Banking wie in praktisch jede andere Form der Online-Kommunikation einschleusen. Illegale Geschäfte sind in Folge unsicherer oder fehlender Rechtsgrundlagen möglich. Kinder und Jugendliche können u.a. durch Gewalt- und Porno-Videos gefährdet werden. Vielfältiger, oft krimineller Miss-brauch ist nicht auszuschließen.
Fazit: Welchen Wert – oder Unwert – die digitale Revolution tatsächlich darstellt, lässt sich (noch) nicht abschließend feststellen. Der individuellen Wahlfreiheit wird viel, sehr viel zugemutet, zumal bei der Abwägung von Chancen und Risiken der digitalen Freiheit. Zu fragen ist jeweils, wie viel Eigensteuerung möglich, wie viel Fremdsteuerung, gar Manipulation (z.B. auch durch das persönliche und kollektive Unbewusste), zu befürchten ist. Was wiederum analog auch für fast alle anderen Lebensbereiche gilt, so für die Partnerwahl, die Berufswahl und -Ausübung, die Freizeit-Gestaltung (innerhalb einer „Spaßgesellschaft“ und anderswo).3
1.2 Globalisierung und digitale Revolution im Jahre 2016
In einem ‚ZEIT‘-Artikel vom 21. Januar 2016 stellt Uwe Jean Heuser klar, dass Gewinner der Globalisierung insbesondere zahlreiche deutsche Unternehmer sind, die dafür sogar in der breiten Öffentlichkeit mit Anerkennung und Beifall bedacht wurden. Viele Deutsche hätten die Globalisierung „erst als Jobvernichter gefürchtet und dann als Jobmaschine schätzen gelernt.“ – Inzwischen seien aber unerwartete negative Entwicklungen eingetreten, die erneut Zweifel und Befürchtungen aufkommen ließen. Dazu rechnet Heuser 1. den Abschwung der chinesischen Wirtschaft („Chinakrise“), 2. die Talfahrt der Rohstoffpreise (insbesondere des Rohöls) und 3. die immer bedeutender werdende Roboterisierung im Rahmen der unaufhaltsam voranschreitenden Computerisierung. Wodurch nicht nur bewährte Formen der internationalen Arbeitsteilung, sondern auch eine Vielzahl von Arbeitsplätzen in Gefahr geraten seien. („Fünf Millionen Jobs könnten wegfallen.“) Und: „ ... in der Dialektik des Wandels ist der Sieg von gestern die drohende Niederlage von morgen“.
Dennoch sei auf jeden Fall das Potenzial der digitalen Revolution noch keineswegs ausgeschöpft, so dass eine massiv Arbeitsplätze vernichtende Veränderung bzw. „Umwälzung“ vorerst nicht zu erwarten sei. Nichtsdestoweniger gibt Heuser am Schluss des Artikels ein paar warnende Hinweise, so, wenn er feststellt: „Es ist noch die gute alte digitale Revolution, die aber jetzt die Basis der Globalisierung verändert. In einer solchen Umwälzung geht es nicht immer nur bergauf. Das wurde deutlich, als die New Economy zur Jahrtausendwende zusammenbrach.“ Krisen habe es immer wieder mal gegeben, so während der Industriellen Revolution und der „Gründerjahre“ des 19. Jahrhunderts.
Zuversichtlich klingt Heuser hier nicht, eher skeptisch und besorgt. Wofür allerdings schwerwiegende weitere Gründe bestehen, zumal Krisen nicht nur durch die von Marx so benannte „Dauerkrise des Kapitalismus“ entstehen, wozu sicherlich auch die gegenwärtige Globalisierungskrise des Turbo-Kapitalismus zu rechnen ist. Hinzu kommt nämlich die durch den Klimawandel verschärfte schleichende Umweltkatastrophe, die Öko-Krise, so dass seit circa 20 Jahren sogar von einer Weltkrise die Rede ist.
1.3 Die Öko-Krise. Umweltzerstörung und Klimawandel
Verharmlosend wird diese Krise gelegentlich als „Kulturkrise“ bezeichnet. Es ist jedoch eine Kulturkrise der besonderen Art, weil sie – im Unterschied zu anderen – nicht nur das Bewusstsein, sondern, z.B. in Folge von Stress, Lärm und Umweltgiften, auch den Körper jeder Person schädigt bzw. schädigen kann. Zwischen den Personen (als „individuellen Systemen“) und dem planetarischen Öko-System besteht ein Verhältnis wechselseitiger Abhängigkeit. Mit den Worten von Theodore Roszak: „Die Bedürfnisse des Planeten sind auch die Bedürfnisse der einzelnen Person..., die Rechte der einzelnen Person sind auch die Rechte des Planeten.“ (Zit. bei Capra 1983, S. 447.)
Wenn es aber eine planetarische Krise gibt, die nicht nur durch die weltweite Öko-Krise, sondern auch durch die oben beschriebene Globalisierungskrise des Turbo-Kapitalismus hervorgerufen worden ist, empfiehlt es sich, nach Zusammenhängen zwischen diesen Krisen Ausschau zu halten. Existieren solche Zusammenhänge, ist die Öko-Krise nicht einfach eine Kulturkrise, sondern Teil einer planetarischen Krise der Person.
Zusätzlich kompliziert wird die „Sachlage“ (die Lage aller Personen) dadurch, dass anscheinend nicht jede Öko-Krise auch als „ökologische Krise“ gelten muss, denn wir kennen nicht sämtliche Umweltprobleme in jedem Winkel der Erde und wir können nicht jedes offensichtliche Öko-Problem (wie z.B. den Klimawandel) mit letzter Sicherheit ökologisch bestimmen. Daher bevorzuge ich den Begriff Öko-Krise.
Was aber ist Öko? Vom Altgriechischen her zunächst nur ‚oikos‘, das Haus. Das Haus Erde (Welt) ist in Gefahr. Gibt es eine (spät)kapitalistische Welt- und Globalisierungskrise, dann betrifft diese sowohl das „Haus“ der Ökologie als auch das der Ökonomie. Unschwer nachweisbar ist, dass dieses Haus sowohl durch kapitalistisch-marktwirtschaftlichen als auch durch „realsozialistisch“-planwirtschaftlichen Raubbau an Natur und Umwelt schwer geschädigt worden ist.
Da immer noch zu viele Abgase (durch Fahrzeuge, Fabriken, private Haushalte usw.) unsere Umwelt belasten, scheinen auch der dadurch verursachte, lebensgefährliche Treibhauseffekt und der darauf beruhende Klimawandel größtenteils hausgemacht zu sein.
Wenn jedoch – wie dies Autoren wie Christoph Lauterburg (1998) sinnfällig dargestellt haben – die Umweltvergiftung in Ballungsräumen bereits die Fortpflanzungsfähigkeit des Menschen zu zerstören beginnt, wird nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft des Person-Seins radikal in Frage gestellt.
Dass der Klimawandel tatsächlich vorwiegend „hausgemacht“ ist, also von Menschen verursacht wurde, wird aktuell kaum noch in Frage gestellt. (Eine der wenigen Ausnahmen: der US-Präsident Donald Trump 2017!) Augenmaß und Vernunft lässt dagegen Andreas Lienkamp erkennen, wenn er feststellt: „Was auf den ersten Blick wie ein natürliches Ereignis aussieht, z.B. das Abschmelzen von Gletschern oder der Anstieg des Meeresspiegels, kann auf den zweiten Blick zwar nicht auf die Handlungen einzelner Akteure zurückgeführt werden, aber doch auf dominante, klimaschädigende Produktions- und Konsummuster, die vor allem in den Industrie- und Schwellenländern, aber auch seitens der Eliten in den Entwicklungsländern praktiziert werden.“4
Womit Lienkamp im Jahre 2009 weitgehend das bestätigt, was schon vier Jahre zuvor dem Schwarzbuch Klimawandel zu entnehmen war, dessen Autoren vorsichtig abwägend unterscheiden zwischen a) dem, „was die Wissenschaft zu wissen glaubt“, b) dem, „was sie vermutet“, und c) dem, „was diskutiert wird und was daraus folgt“.5 Als wahrscheinlich wichtigste Kernaussagen greife ich heraus zu a): „Die Kohlendioxydkonzentration in der Atmosphäre liegt heute um etwa ein Drittel höher als je zuvor in den letzten 400.000 Jahren. Der Anstieg der Kohlendioxydkonzentration ist auf anthropogene Quellen zurückzuführen; ...“ (ebd.), zu b): „Die in den letzten Jahrzehnten beobachteten Temperaturänderungen sind nach heutigem Verständnis des Klimasystems nur zu erklären, wenn der Einfluss der anthropogenen Treibhausgasemissionen berücksichtigt wird.“ (a.O. S. 213 f.), sowie: „Klimaänderungen im erwarteten Ausmaß können einschneidende Auswirkungen auf die Wasserverfügbarkeit, die Nahrungsmittelversorgung und die Gesundheit in manchen Teilen der Welt haben. Die Schere zwischen arm und reich wird durch den Klimawandel verstärkt, Entwicklungsländer sind stärker betroffen als industrialisierte Staaten.“ (a.O. S. 214, Hervorhebungen durch mich). Und schließlich zu c): „Längerfristig können abrupte Klima-änderungen, wie etwa der Zusammenbruch der Thermohalinen Zirku-lation, infolge der anthropogenen Klimaänderung nicht ausge-schlossen werden.“ (ebd.)
Umso entsetzlicher wirkt die Tatsache, dass verantwortliche Amtsträger überall auf der Welt jahrzehntelang die durch den Klimawandel verursachten Probleme einfach zu ignorieren versuchten, und zwar nach dem Motto: „Global reden – national aufschieben“.6 Harald Schumann und Christiane Grefe nennen dies im Jahre 2009 „die dunkle Seite des bisherigen globalen Klimaregimes“, das völlig unzulänglich gewesen sei (ebd. S. 324).
1.4 Ein Lichtblick: der Pariser Weltklimavertrag von 2015
Durchgreifende Änderung scheint erst seit dem Jahr 2015 in Sicht, d.h. seit dem „Paris-Abkommen“, dem von 195 Staaten und der EU geschlossenen ‚Weltklimavertrag‘, der 2016 in Kraft getreten ist. Darin verpflichtet sich die Weltgemeinschaft, „die Erwärmung deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhunderts“ zu halten, dazu den Ausstoß von Treibhausgasen schrittweise zu reduzieren, die Abgasziele unter laufender Kontrolle stetig zu verschärfen, „neue Arten der Energieversorgung und Frühwarnsysteme für Naturereignisse“ bereitzustellen, Schäden und Verluste auszugleichen und die ärmeren Länder durch ausreichende Finanzhilfen bei ihren neuen Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu unterstützen.
Dessen ungeachtet wurden nicht alle berechtigt erscheinenden Forderungen ärmerer Länder erfüllt, ein Manko, auf das Axel Bojanowski, der Autor des hier von mir referierten Berichts über den Weltklimavertrag, am Schluss seines Artikels hinweist. Unter der Überschrift „Referenz7 an Mutter Erde“ heißt es dort: „Gescheitert ist ... der verzweifelte Kampf der indigenen Völker. Alle Demonstrationen für zugesicherte Rechte im Klimavertrag haben wenig genützt. Ihre Bedürfnisse werden lediglich ‚beachtet‘, selbst für Uno-Sprache eine äußerst unverbindliche Formulierung. – Freude hingegen bei einigen Südamerikanern. Der Schutz von ‚Mutter Erde‘ wird ausdrücklich gewürdigt, in der Präambel des Weltklimavertrags.“8 Abzuwarten bleibt, welche Taten solchen Würdigungen und vertraglichen Vereinbarungen folgen werden.
2. Ein Lösungsvorschlag: Demokratischer Öko-Sozialismus
2.1 Warum Sozialismus?
Antworten auf diese Frage habe ich bei Ernst Bloch gefunden, und zwar im Zusammenhang mit dem von mir behandelten Thema:
Subjekt, Substanz und Sozialismus, oder auch: „Vive la sociale!“ – und eine Definition des Sozialismus 9
Blochs Sozialismus beruht bekanntlich nicht nur auf den Lehren der marxistischen Klassiker, sondern auch auf den Lehren der Geschichte. Der Kampfruf der Pariser Communarden des Jahres 1871 lautete: „Vive la sociale!“ (wobei sich die weibliche Form ‚la sociale’ wohl dadurch erklärt, dass hier vor allem an die ‚révolution sociale’ gedacht wurde). Wie dem auch sei: Ohne die Pariser Commune wäre der Marxismus vielleicht nicht substanziell – im Sinne einer revolutionären Subjekt-Substanzialität – geworden. Denn: Vor allem durch die Pariser Commune wissen wir, dass direkte Demokratie, Arbeiterkontrolle und tendenziell herrschaftsfreie Solidarität möglich sind, solange solche Errungenschaften nicht durch übermächtige Feinde zerstört werden. Allerdings: Marx schloss genau hieraus, der Weg zum Sozialismus könne (und müsse gegebenenfalls) über eine „Diktatur des Proletariats“ führen. Eine Folgerung, die sich geschichtlich als sehr bedeutsam, d.h. möglicherweise sogar als fatal erwiesen hat. (Wobei nicht zu vergessen ist, dass Marx auch parlamentarische Wege zum Sozialismus für möglich hielt!)
Umso wertvoller sind Blochs Erörterungen des Verhältnisses von Substanz und Sozialismus, können sie doch auch uns heute dabei helfen, Klarheit über das Wesen und die Ziele eines zeitgemäßen Sozialismus zu gewinnen. Bloch erklärt nämlich: „Die Wahrheit des Sozialen ist der Sozialismus“.10 Und worin besteht diese Wahrheit? Nun, es ist eine, der Bloch nicht nur realistisch, sondern auch konkret-utopisch auf die Spur kommt und auf die Sprünge hilft. Das heißt: Er entwirft die Vision:
2.2 Substanzziel Sozialismus.
Die utopische Einheit von Substanz und Subjekt heißt Endsubstanz in unentfremdetem An- und Fürsichsein.11 Wobei kein Zweifel daran bestehen kann, dass dieses Ziel mit denjenigen übereinstimmt, die Marx und Bloch dem Kampf für den Sozialismus mit auf den Weg gegeben haben. Doch zu bedenken bleibt, auch und gerade angesichts der geschichtlichen Erfahrungen seit Marx und Bloch:
„Sozialismus ist das Einfache, das schwer zu machen ist.“ –
So einfach klingt das bei Bertolt Brecht, wenn auch zweifellos nicht überall in seinem Werk. Ähnlich und doch auch ganz anders bei Bloch, dem es darauf ankommt, der Wahrheit des Sozialen zum Durchbruch zu verhelfen, in einer Ausformulierung des Substanzziels: „Übergang oder Eingang zum Subjekt als Substanz, eben als Kernnatur; dieses bezeichnenderweise erst herzustellende utopische, nicht etwa bereits dinglich gegebene Substanzziel nannte Marx >das Reich der Freiheit<, mit fast christlichem Ausdruck.“12 Einfach scheint daran fast gar nichts zu sein. Das Substanzziel „Reich der Freiheit“ können wir allerdings durch eine Vielzahl ähnlicher marxistischer Begriffe, Theoreme und Theorien präzisieren, angefangen von der zunächst etwas rätselhaft anmutenden „Wiederherstellung des Menschen“13, über die Freiheit von Not, Elend, Ausbeutung, Erniedrigung, Knechtung und Entfremdung bis hin zur „freien Assoziation freier Individuen“ und „Resurrektion der Natur“. Freiheit ist also nicht nur die Engelssche „Einsicht in die Notwendigkeit“! Und aus den solcherart präzisierten Substanzzielen lässt sich wahrscheinlich ein System abgestufter, aufeinander abgestimmter Fern- und Nahziele ableiten, ein Substanz-System, das sich allerdings in tagtäglicher Praxis zu bewähren hätte.
Von den genannten Synonymen des „Reichs der Freiheit“ scheint die „Wiederherstellung des Menschen“ das Einfachste überhaupt zu sein, denn Menschen sind wir doch alle. Laut Kant sind wir es allerdings erst dann wirklich, wenn jegliche Unmenschlichkeit beseitigt ist. Keiner darf sich demnach frei wähnen, solange nicht alle frei sind. Wie soll das zu erreichen sein? Durch bloßes Substanzdenken? Wohl kaum!
Und wie steht es mit den übrigen Substanzzielen? Das Reich der Freiheit ist nicht „bereits dinglich gegeben“, sondern es ist das „erst herzustellende utopische“. Es ist also noch nirgendwo verwirklicht! Schlimmer noch: Wenn die reaktionär-konservativen Verächter des Sozialismus Recht haben, gibt es Freiheit nur ohne Sozialismus und nur gegen ihn. In der Tat, die gibt es, und zwar sozusagen „dinglich“, nämlich in dem verdinglichten Bewusstsein, das Gewerbefreiheit und Finanz-Exzesse als Freibrief für jede Art von Profitgier auffasst und dies ständig (und geradezu ständisch!) unter Hinweis auf die angeblich „ach so egoistische menschliche Natur“ rechtfertigt. Nicht zuletzt mit Hilfe dieser Ideologie hat der Kapitalismus bisher fast jede Krise überstanden, so dass auch aktuell vor allzu großem Optimismus in Bezug auf eine mögliche „Systemüberwindung“ dringend gewarnt werden muss.
Im Hinblick auf das „Reich der Freiheit“ billigt Bloch Marx zu, er drücke sich „fast christlich“ aus. Was aber heißt das für uns? Mit dem „Reich der Freiheit“ assoziieren Christen wohl gern das „Reich Gottes“, das angeblich „nicht von dieser Welt“ ist. Und in der Tat: Bezieht man diese Ansicht auf die neoliberal-kapitalistische Welt, wie sie derzeit real existiert, haben Christen Recht – und folglich auch dann, wenn sie aktuell statt des Rechts der Stärkeren die Stärke des Rechts einfordern. Mehr als naiv wäre es jedoch anzunehmen, dass in einer Klassengesellschaft das Recht quasi substanziell per se existiere und daher nicht vom „Recht“ bzw. Unrecht der Stärkeren unterminiert und missbraucht werden könne. – So viel zu den Substanz-Zielen des Sozialismus.
2.3 Wie aber sollen und können die Substanz-Ziele überhaupt erreicht werden?
Vor rund 20 Jahren und noch bis vor kurzem schien diese Frage völlig obsolet geworden zu sein. Die triumphierenden Neoliberalen verlangten (bzw. erwarteten wie selbstverständlich), dass Sozialisten und Kommunisten endgültig kapitulierten und den Sozialismus ad acta legen bzw. auf den berühmtem „Müllhaufen der Geschichte“ werfen würden. Das sieht heute bekanntlich wieder völlig anders aus. Die Frage nach einer vernünftigen und zugleich erträglichen Gesellschaftsordnung ist zu einer Schicksalsfrage der Menschheit geworden, und zwar vor allem angesichts der mindestens dreifachen aktuellen Bedrohung durch Öko-, Wirtschafts- und Finanzkrisen (also einschließlich der akuten und schleichenden Umwelt-Katastrophen, der weltweiten Armutskrise und der Hunger-Katastrophen, beschönigend „Nahrungsmittelkrise“ genannt). Daher steht jetzt die (bzw. eine) sozialistische Alternative wieder auf der Tagesordnung der Geschichte, sollte jedenfalls dort stehen.
2.4 Und was für ein Sozialismus?
2.4.1 Das Sozialistische Projekt in Frankreich 1980-1983
Als Vorbild für einen humanen Sozialismus, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz, gilt mir seit 1980, neben dem ‚Prager Frühling‘ des Jahres 1968, der französische Projet socialiste, der unter diesem Titel auch als Buch erschienen ist. Wirklich human war dieser sozialistische Versuch, weil er sich nicht auf Gewalt, Unterdrückung und Meinungsterror, sondern auf soziale, freiheitliche und demokratische Prinzipien gründete. Man wollte endlich das in arroganten Herrschaftsallüren erstarrte kapitalistische Ausbeutungs-System durch ein neues Humanum in Freiheit, Gleichheit und Solidarität: Brüder-/Schwesterlichkeit ersetzen.
Die Sozialisten und Kommunisten, die mit diesen hohen Zielen im Jahre 1981 eine neue Regierung mit Franҁois Mitterrand (1916-1996) an der Spitze bildeten, waren keine Putschisten oder Revoluzzer, sondern frei gewählte Vertreter des französischen Volkes, die sich selbstverständlich an die Regeln der parlamentarischen Demokratie und des Rechtsstaats hielten und daher nicht auf unabwählbare Machtausübung fixiert oder gar „abonniert“ waren. Ihr Scheitern – spätestens bei den Parlamentswahlen des Jahres 1986 – ist tragisch zu nennen; denn ihre konkreten Ziele waren:
1.) Schrittweise Beseitigung der sozialen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten.
2.) Mitbestimmung und Teilhabe der Werktätigen statt Ausbeutung und Unterdrückung.
3.) Direkte gesellschaftliche Kontrolle (‚nationalisation‘: ‚Vergesellschaftung‘; nicht ‚étatisation‘, nicht bloße ‚Verstaatlichung‘!) der Produktionsmittel, insbesondere der Großunternehmen in Schlüsselindustrien und im Finanzsektor. In den vergesellschafteten Großbetrieben sollten neue, drittelparitätisch besetzte Aufsichtsgremien gebildet werden, die aus a) Delegierten der Behörden, b) der Unternehmensbelegschaft und c) der Kunden und Zulieferfirmen des Unternehmens bestehen sollten.
Zu 1.) Von 1981 bis 1983 wurde der Mindestlohn um ca. 38 % angehoben, die „staatlichen Löhne, Renten und Arbeitslosen-unterstützung ... um 10 bis 25 Prozent“14, Kinder- und Wohngeld um 25 bzw. 50 %; die Regelarbeitszeit wurde, bei vollem Lohnausgleich, von 40 auf 39 Stunden gesenkt.
Zu 3.) „Der Staat kontrollierte nun 95 Prozent des Kredit- und Bankwesens, den Großteil der Schwerindustrie und auch 75 Prozent der Textilindustrie. Im staatlichen Sektor wurden 200.000 Stellen geschaffen ... . Außerdem wurde die Rente mit 60 durchgesetzt, ein großes Programm für die Erneuerung des sozialen Wohnungsbaus aufgelegt, die Todesstrafe abgeschafft und ein Ministerium für die Gleichstellung der Frau errichtet.“ (Gastbeitrag ebd.)
Negative Folgen:
Exorbitante Zunahme der Staatsverschuldung, u.a. in Folge der hohen Entschädigungszahlungen an die nationalisierten Unternehmen, Anstieg des Handelsbilanzdefizits auf fast 100 Milliarden Francs, massive Kapitalflucht = massiver Rückgang der Investitionen, Kursverfall des Franc u.a.m.
Eine zunehmend katastrophale Entwicklung, die schon 1983 zur Beendigung des sozialistischen Experiments und zu einem radikalen Politikwechsel führte (Sparprogramme, ‚austérité‘, Einfrieren der Löhne und Gehälter etc.).
Welche Lehren sind aus diesem Debakel zu ziehen? 1. Gegen den geballten Widerstand des Großkapitals ist Sozialismus anscheinend nicht durchsetzbar. 2. Ohne die Mobilisierung breiter Kreise der Bevölkerung, insbesondere der Arbeiterschaft, kann ein sozialistisches Experiment nicht gelingen. Höchste Beachtung verdient daher das folgende Fazit: „Die Gründe für das Versäumnis, die Bevölkerung zu mobilisieren, sind im Politikverständnis der Sozialisten zu suchen. Der französische Sozialismus vereinte eine radikale Rhetorik etwa des „Bruches mit dem Kapitalismus“ mit einer Vorstellung, dass die sozialistische Wirtschaftspolitik das Beste sei, um auch die Interessen der französischen Unternehmer zu wahren. Das sahen die Unternehmer aber anders. Als nun die Umsetzung des Programms auf harten Widerstand von Seiten des Kapitals stieß und die Gesellschaft sich polarisierte, waren die französischen Sozialisten nicht darauf vorbereitet. Das führte innerhalb kurzer Zeit dazu, dass die Regierung auf Unternehmerkurs einschwenkte.“ (a.O. S. 2)
Diese bitteren Erfahrungen, dieses Scheitern eines humanen Sozialismus, lassen sich sicherlich nicht verallgemeinern, obwohl sie äußerst lehrreich sein dürften. Welche Lehren aber tatsächlich zu gewinnen sind, hängt völlig von den jeweiligen lokalen und globalen Gegebenheiten ab. Obendrein ist die Situation, fast 40 Jahre nach dem französischen Experiment, noch erheblich komplizierter geworden, und zwar vor allem durch die Globalisierungskrise, die Umwelt- und Klimakrise und die digitale Revolution (s.o.). So dass ich im Folgenden nicht umhin kann, im Zusammenhang mit der Frage nach einem möglichen Sozialismus zwei große Themenkomplexe anzuschneiden: a) den Öko-Sozialismus und b) den digitalen Sozialismus.
Zuvor ist jedoch ein Exkurs vonnöten, und zwar zum Verhältnis von Theorie und Praxis in der Politik. Wenn das französische sozialistische Experiment nicht zuletzt an eigenen politischen Unzulänglichkeiten der Sozialisten gescheitert ist, müssen die Gründe hierfür analysiert werden, und zwar nicht ins Blaue hinein, sondern angeleitet sowohl durch theoretische Orientierung als auch durch praktische Erfahrung. Verallgemeinert: Da Sozialismus niemals nur theoretisch und niemals nur praktisch ist, bedarf es theoretischer Orientierung als Richtschnur des politischen Handelns. Auch und gerade in Bezug auf die Politik gilt es, die Dialektik von Theorie und Praxis zu beachten. Unter diesem Aspekt werden auch die Überlegungen zum Öko-Sozialismus und zum „digitalen Sozialismus“ zu beurteilen sein. Daher nunmehr der
2.4.1.1 Exkurs zu Prinzipien und Unwägbarkeiten der Politik, oder auch: Bietet der Machiavellismus Orientierung für politische Praxis?
Purer Machiavellismus ist wahrscheinlich immer zum Scheitern verurteilt. Warum dieses? Nun, wenn Niccoló Machiavelli (1469-1527) Recht hat, gibt es für den ‚Principe‘, den „Fürsten“, d.h. für alle diejenigen, die nach größtmöglicher politischer Macht streben, nur zwei Fragen und eine Antwort. Die Fragen:
1.„Wie komme ich an die Macht?“ und 2. „Wie bleibe ich an der Macht?“ Die Antwort: „Der Zweck heiligt die Mittel.“ (Was bekanntlich auch eine Devise des Jesuiten-Ordens ist.)
Die beiden Fragen halte ich für problematisch, aber berechtigt, die Antwort für falsch. Ohne Machtausübung ist Politik nicht denkbar, und in relativ kurzer Zeit kann durch Politik durchweg nur wenig, zu wenig, bewirkt werden – zumal dann, wenn es, wie gegenwärtig, außerhalb der Politiker-Kaste im engeren Sinne wirtschaftliche bzw. finanzstarke Machthaber und Manipulatoren gibt, die anscheinend „alles im Griff“ haben. Schon deshalb ist es verständlich, dass heutige Politiker sich besonders schwer damit tun, vernünftige Antworten auf Machiavellis Fragen zu finden. Zumal Machiavellis eigene Antwort falsch ist, und zwar aus folgendem Grunde: Es stimmt zwar, dass zur Erreichung von Zielen und zur Erfüllung von Zwecken Mittel eingesetzt werden müssen, doch es ist zu beachten, dass Zweck-Mittel-Verhältnisse stets der Teleo-Logik zuzurechnen, d.h. in Grundschemata der Teleologie einzuordnen sind. Wer einen Zweck verfolgt, fungiert als Urheber einer Wirkung. Der/die politische Verursacher/in setzt bestimmte Mittel ein, um bestimmte Ziele, bestimmte Wirkungen zu erreichen.
Insofern stecken in der politischen Verursachung sowohl Wirkursachen als auch Ziel- und Zweck-Ursachen (causae efficientes und causae finales). Daher können bestimmte Wirkungen (Ziele / Zwecke) nur durch bestimmte Mittel erreicht werden, die letztlich von der „Ursache“ (bzw. dem/der Verursacher/in) abhängen. Folglich besteht auch zwischen den Wirkungen und den Mitteln ein Verhältnis der Abhängigkeit. – Wenn aber der Zweck die Mittel „heiligt“, erscheinen die Mittel nur in Abhängigkeit von den Zwecken, nicht umgekehrt. Tatsächlich aber hängen die Zwecke (bzw. deren Erreichung) auch von den eingesetzten Mitteln ab. Schon deshalb kann der Zweck nicht einfach die Mittel „heiligen“; vielmehr müssen die Mittel den Zweck „heiligen“ können. Daher halte ich schon aus Gründen der Logik Machiavellis Antwort für falsch.
Was sich in der Weltgeschichte tatsächlich immer wieder bewahr-heitet hat. Potentaten – wie Cäsar, Cesare Borgia, Napoleon, Hitler und Mussolini, aber auch Pol Pot, Saddam Hussein und Gaddafi – schreckten bekanntlich nicht davor zurück, auch ethisch nicht zu rechtfertigende Mittel, so z.B. Verbrechen vielfacher Art, einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Ob und wie sie tatsächlich alle genau daran gescheitert sind, wäre näher zu erörtern.
Verfehlt wäre es allerdings, aus den genannten Beispielen auf eine allgemein-gültige Regel, also vom Besonderen aufs Allgemeine, zu schließen, zumal es Gegenbeispiele gibt: Stalin15, Mao, Franco, Mobutu u.a.m. Anzunehmen ist dennoch, dass Machiavellis Antwort aus den genannten Gründen ein hohes Risiko des Scheiterns in sich birgt. Unethische Mittel, auch und gerade zur Erreichung von Fernzielen, können diese Fernziele völlig entwerten bzw. hinfällig15 werden lassen. Ein Beispiel: Im Jahre 1870 provoziert Bismarck den Deutsch-Französischen Krieg. Nahziel: Einigung der deutschen „Stämme“ durch Sieg über Frankreich, Fernziel: Errichtung des Zweiten Deutschen Kaiserreichs. Haben diese Ziele das Mittel Krieg gerechtfertigt? Zweifellos nicht, denn dieser Krieg verfestigte die „Erbfeindschaft“ zwischen zwei konkurrierenden imperialistischen Mächten, was zum Ausbruch des 1. Weltkriegs beitrug, an dessen Ende das 2. Deutsche Kaiserreich zusammenbrach. – Hätte, umgekehrt, das Mittel Krieg den Macht-Zweck heiligen können? Zweifellos nicht, denn Krieg kann nie etwas heiligen.
Zu Zweck-Mittel-Relationen, insbesondere denjenigen historisch-politischer Art, hat Ernst Bloch oftmals Stellung genommen16 und betont, dass diese Relationen auch und gerade hinsichtlich der Nah- und Fernziele stimmen müssen. Recht gibt ihm immer wieder das Scheitern totalitärer, illegitimer, undemokratischer Politik.
Übrigens: Wenn Pragmatisten und andere behaupten, besser sei es zu handeln als nicht zu handeln, behaupte ich, dass es besser sein kann, nicht zu handeln als (bewusst?) falsch oder (unbewusst?) schlecht zu handeln. Und: Alle Macht sollte vom Volke ausgehen, – und man sollte wissen, wohin sie geht. –
Inwiefern nun solche Einsichten für sozialistische Politikerinnen und Politiker relevant werden können, hängt von mindestens drei Faktoren ab: 1. Konkrete Analyse der konkreten Situation, 2. Kritische, möglichst intersubjektive Überprüfung und Kontrolle der eigenen Analyse, 3. Theorien oder Teile davon (Theoreme), einschließlich der marxistischen, sind nur dann anwendbar, wenn sie sich bewährt haben, d.h. nicht falsifiziert sind, sich nicht als unzutreffend herausgestellt haben. Wobei es allerdings Streitfälle gibt, wie z.B. Engels‘ ‚Dialektik der Natur‘, Lenins Abbild- und Widerspiegelungstheorie oder auch bestimmte Lehren Freuds.
2.4.2 Öko-Sozialismus
Als Grundlagenwerk des Öko-Sozialismus kann – jedenfalls in einigen Teilen – die von dem Umwelt-Aktivisten und Germanisten Saral Sarkar verfasste, 454 Seiten umfassende Studie angesehen werden, die unter dem Titel Die nachhaltige Gesellschaft – Eine kritische Analyse der Systemalternativen im Jahre 2001 in deutscher Übersetzung erschienen ist (englisch 1999).
Die Öko-Krise führt Sarkar auf die u.a. durch Raubbau verursachte Verknappung der Ressourcen und die damit einhergehende Umweltzerstörung in den herkömmlichen Industriegesellschaften zurück. Dagegen setzt er das Prinzip der Nachhaltigkeit und verbindet es mit weitergehenden sozialistischen Forderungen. Im Anschluss an „Meadows et al. 1992“ hält er eine Gesellschaft nur dann für nachhaltig, „wenn sie so strukturiert ist und sich so verhält, dass sie über alle Generationen existenzfähig bleibt“17, woraus er schließt, dass eine Wirtschaft „ theoretisch“ nur dann nachhaltig sein könne, „wenn sie vollständig auf erneuerbaren Ressourcen basiert“ und diese nicht schneller verbraucht als „sie sich regenerieren bzw. von der Natur wieder produziert werden“, was zwangsläufig zum Ende des herkömmlichen industriellen Wirtschaftens führen müsse (ebd.). In der Praxis seien allerdings vorerst noch Kompromisse und Ausnahmen (so bei Kohle, Eisen und Aluminium) vonnöten. (Leider thematisiert Sarkar hier nicht die durch die „digitale Revolution“ eintretenden Veränderungen.)
Andere als sozialistische Lösungen der Probleme hält Sarkar nicht für möglich, zumal nicht nur die „Grenzen des Wachstums“, sondern auch die der technologischen Lösungen deutlich erkennbar seien. Folglich formuliert er auf S. 220 konkrete Ziele für eine nachhaltige Umgestaltung der Gesellschaft, darunter als oberstes: „Die Wirtschaft muss nachhaltig gemacht werden.“ An diesen Zielen misst er nicht nur die System-Alternativen zum Sozialismus, sondern auch den ab 1989 zerfallenden Sowjet-Kommunismus, dem er immerhin fast ein Viertel seiner Arbeit widmet (S. 43-142). Nicht nur die Mängel des politischen Systems, sondern – in noch höherem Maße – schwere ideologische Defizite seien für den Zusammenbruch des sowjetischen Experiments verantwortlich (S. 48). – Für nicht weniger unzulänglich hält Sakar die Lösungsversuche, die im Zeichen des Öko-Kapitalismus, des Öko-Keynesianismus und des Marktsozialismus unternommen worden seien.
Seine neue „Synthese von Sozialismus und Radikalökologie“ begründet er damit, dass „ohne Planung ein geordneter Rückzug vom heutigen Wahnsinn überhaupt nicht möglich sein“ werde (S. 319). Worin diese Synthese besteht, fasst er auf der folgenden Seite in acht Punkten verblüffend kurz und bündig zusammen, wobei nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern auch die „Schrumpfung“ zu einem Schlüsselbegriff avanciert. Schrumpfung der „Wirtschaften“ – und zwar weltweit! – sei erforderlich, um den übermäßigen Ressourcenverbrauch zu stoppen und, statt ständigen Wachstums, einen „Steady-State“, also das Nullwachstum der Wirtschaft, zu erreichen. Dies bedeute zugleich eine erhebliche Senkung des allgemeinen Lebensstandards, was aber, unter bestimmten Bedingungen, durchaus zumutbar sei. Denn nicht nur die Wirtschaft, sondern die gesamte Gesellschaft müsse ebenfalls, und zwar gleichzeitig, in den Stand der Nachhaltigkeit versetzt werden, wozu es weiterer drastischer Maßnahmen bedürfe, nämlich nicht weniger als 1. Abschaffung des Kapitalismus, 2. Einführung der Planwirtschaft, 3. Herstellung allgemeiner Gleichheit. Letzteres vor allem deshalb, weil nur unter dieser Bedingung überall in den Bevölkerungen die Akzeptanz der Senkung des allgemeinen Lebensstandards erreichbar sei. Und umfassende Planung sei vor allem deshalb vonnöten, weil ein „ungeordneter Rückzug“ aus dem Wachstumskapitalismus „zu Chaos und Zusammenbrüchen“ führen würde. Im Übrigen müsse auch das Bevölkerungswachstum durch staatliche Eingriffe gestoppt werden.
Diesen äußerst ehrgeizigen Plan einer umfassenden sozialistischen Umwälzung begründet Sarkar damit, dass Sozialismus „ein moralisches Projekt“, der Kapitalismus hingegen unmoralisch sei. Demgemäß schreibt er zu Punkt 8, dem letzten Punkt seiner Zusammenfassung: „Ein moralisches Wachstum, eine moralische Wirtschaft und Gesellschaft, sind notwendig, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Dies ist nicht möglich im Rahmen des Kapitalismus, gleich welcher Art. Dies ist möglich, wenn auch nicht garantiert, in einem sozialistischen Rahmen, weil Sozialismus ein moralisches Projekt ist.“ Wozu der Autor wenig später erläuternd anmerkt, dass erst in einem ganz neuen Öko-Sozialismus (von dem Marx und Engels noch nichts hätten wissen können) die wahren ursprünglichen Prioritäten des Sozialismus wiederhergestellt werden könnten, nämlich nicht nur einfach „die Produktivkräfte zu entwickeln“, sondern: „die Produktionsverhältnisse zu ändern mit den Zielen Gleichheit, klassenlose Gesellschaft, Abschaffung der Ausbeutung und Emanzipation“ (a.O. S. 321). –
Umso mehr fällt auf, dass der Autor mit seinem Konzept auch bei sozialistischen Kritikern nicht selten auf Ablehnung gestoßen ist, so bei dem linksorientierten Wirtschaftswissenschaftler Elmar Altvater, der Sarkar einen „rigiden Ökosozialismus“ bescheinigt, der vielleicht sogar in der Nähe einer „höchst autoritären Barbarei“ zu verorten sei.18 Mit anderen Worten: Man könne Sarkars Konzept auch „als ziemlich brutalen Vorschlag zur Durchsetzung eines okzidentalen Willens der Weltbeherrschung interpretieren. Weniger Menschen und weniger Naturverbrauch, damit die Geschichte weitergeht.“ (a.O. S. 4) Womit der Öko-Sozialismus sich einreihe in die „Tradition rationalistischer Ordnung der >besten aller möglichen Welten<“ (über die sich bekanntlich schon Voltaire lustig gemacht hat). Insgesamt, so Altvater, hinterlasse Sakars Buch „eher ein Gefühl der Trostlosigkeit“ (ebd.).
Wie eine Antwort auf diese Kritik wirkt teilweise die Schrift Ökosozialismus oder Barbarei, die Sarkar im Jahre 2008 zusammen mit Bruno Kern herausgebracht hat. Darin präzisiert er seine Kapitalismus-Kritik und bezeichnet erneut den Ökosozialismus als „Voraussetzung für eine nachhaltige Gesellschaft“. Merkwürdig scheint dabei die Tatsache, dass die Autoren wiederum den sozialistischen Staat als Garanten für die Abschaffung des Kapitalismus einsetzen, andererseits aber nunmehr Partizipation, Mitbestimmung „auf allen Ebenen“ der Gesellschaft einfordern.19
Nichtsdestoweniger hält der kritische Rezensent A. Karathanassis die Analysen der Autoren für unzulänglich, weil es ihnen nicht gelungen sei, die tieferen Gründe für die durch den Kapitalismus verursachte Naturzerstörung aufzudecken: „Eine theoretische Auseinandersetzung, die in der Kapitalbewegung den notwendigen Zusammenhang von Wert und Stofflichkeit identifiziert und somit Kapitalakkumulation und Naturzerstörung systematisch-strukturell miteinander verknüpft, bleibt aus.“ (a.O. S. 3) Außerdem sei es sehr bedenklich, dass die Autoren weiterhin den „starken sozialistischen Staat“ beschwören, was den Verdacht aufkommen lasse, man wolle sich – trotz aller gegenteiligen Beteuerungen – erneut am „so genannten Staatssozialismus sowjetischer Prägung“ orientieren, ein Verdacht, den indirekt ja auch Elmar Altvater geäußert hat (s.o.).
Umso mehr erstaunt die Tatsache, dass das von Sarkar und Kern vorgetragene Konzept nahezu vollständig in „Die ökosozialistische Erklärung von Belém“ eingegangen ist. In der brasilianischen Hafenstadt Belém fand im Januar 2009 ein Weltsozialforum statt, auf dem das Soziale seine angebliche Wahrheit in der Forderung nach einer radikalen ökosozialistischen Umwälzung fand, deren Hauptziel Nachhaltigkeit allerdings nur unter äußerst weitreichenden, teils problematischen Prämissen für erreichbar gehalten wurde, nämlich a) der „Kollektivierung der Produktionsmittel“, b) der Einführung der Planwirtschaft und c) einer drastischen Schrumpfung der Produktion, und zwar mit folgender Begründung: „Um die globale Erwärmung und andere Gefahren, die das Überleben von Mensch und Umwelt gefährden, zu vermeiden, müssen ganze Sektoren von Industrie und Landwirtschaft abgeschafft, reduziert oder restrukturiert und andere entwickelt werden, wobei Beschäftigung für alle gewährleistet wird.
Eine solche radikale Umwälzung ist unmöglich ohne kollektive Kontrolle über die Produktionsmittel und ohne demokratische Planung von Produktion und Austausch. Demokratische Entscheidungen über Investitionen und technologische Entwicklung müssen die Kontrolle durch kapitalistische Unternehmen, Investoren und Banken ersetzen, um dem langfristigen Horizont des Gemeinwohls, sowohl in Bezug auf die Gesellschaft wie auf die Natur, gerecht zu werden.“20
Womit die Autoren der ‚Erklärung‘ nicht mehr und nicht weniger als eine umfassende ökosozialistische Revolution fordern, und zwar weltweit, so dass endlich auch „der am meisten unterdrückte Teil der menschlichen Gesellschaft, die Armen und die indigenen Völker“ der Dritten Welt, von Elend, Unterentwicklung und Ungerechtigkeit (z.B. durch ungleichen, unfairen Handel!) befreit werden könne. Im Zuge dieser Befreiung könne dann auch die volle Gleichberechtigung von Mann und Frau, die „Geschlechtergleichheit“ als „integraler Bestandteil des Ökosozialismus“, überall auf der Welt gewährleistet werden. Es handele sich um ein Programm, für das die Mehrheit der Bevölkerung allenthalben zu gewinnen sei.
Weiter konkretisierend schlagen die Autoren radikale Umwälzungen („Transformationen“) vor, die es verdienen, im vollen Wortlaut zitiert zu werden, und zwar: „1.Transformation des Energiesystems mittels Ersetzen von fossilen und Biotreibstoffen durch saubere Energie-quellen unter Kontrolle der Gemeinden: Wind-, geothermische, Wellen- und vor allem Sonnenenergie; 2. Transformationen des Transportsystems durch die drastische Reduzierung der privaten Nutzung von Lastwagen und PKWs und Ersetzen derselben durch ein kostenfreies und effizientes öffentliches Transportsystem; 3. Trans-formationen der derzeitigen Art der Produktion, Konsumtion und Konstruktion, die auf Verschwendung, eingebaute Alterung, Wett-bewerb und Verschmutzung beruht, durch Produktion von ausschließlich nachhaltigen und recyclebaren Gütern und durch Entwicklung einer „grünen“ Architektur; 4. Transformationen im Bereich der Nahrungsmittelproduktion und -verteilung, indem man, soweit als möglich, für lokale Nahrungsmittelselbstversorgung eintritt, durch die Beseitigung der umweltverschmutzenden Agrarindustrie, durch die Schaffung nachhaltiger Agrarökosysteme sowie die aktive Wiederherstellung fruchtbaren Bodens.“ (a.O. S. 5)
Im Übrigen empfehlen die Autoren ihr Programm auch als Anleitung für dringend notwendige Reformen im Hier und Jetzt. Hunger, Not, Elend, Natur- und Umweltzerstörung dulden keinen Aufschub mehr. Abhilfe muss unverzüglich geschaffen werden, wo immer es möglich ist.
2.4.3 Digitaler Sozialismus?
Computer und „soziale Medien“ allein können die Probleme der Gesellschaft nicht lösen, zumal die Komplexität der menschlichen Person – auch und gerade als eines Gemeinschaftswesens – sich dem bloß quantifizierenden und rubrizierend-einordnenden Zugriff von Rechnern entzieht. Mit den Worten von Wolf Lotter: „Die Informatik ist eine Brille mit einer hervorragenden Optik, aber kein Auge und kein Gehirn. Die Informatik kann uns helfen, unseren Verstand zu erweitern, aber sie kann keinen Geistesblitz zünden. Das können nur wir selbst.“21 (Zumal Geist nicht in bloß digitaler Form, sondern als umfassende, dialektische Subjekt-Objekt-Beziehung existiert.) Außerdem beruht die Gesellschaft zwar auf Kommunikation und Kontakt, erfüllt ihr Wesen aber nicht darin. So dass sich in Bezug auf den Sozialismus die Frage stellt, welche gesellschaftliche Bedeutung den IT-Medien tatsächlich zukommt. Gibt es wirklich „Alternativen aus dem Rechner“?, wie W. Paul Cockshott und Alin Cottrell 1993 in ihrem gleichnamigen Buch behaupten, wobei sie ihre Hauptthese schon im Untertitel ankündigen: „Für sozialistische Planung und direkte Demokratie“. Da auf beiden Ebenen sowohl der herrschende Kapitalismus als auch der zentralistische Sowjet-„Sozialismus“ versagen (bzw. versagt haben), wird die Suche nach Alternativen unvermeidlich.
Alternativen, die sich nach der Überzeugung von Cockshott und Cottrell durch die digitale Revolution unmittelbar nahelegen, wenn auch unter altbekannten, uralt-sozialistischen Prämissen: Kollektivierung der Schlüsselindustrien und Planwirtschaft, so dass erneut idealtypische Vorstellungen und Forderungen erkennbar werden, wenn auch in Verbindung mit umfangreichen, durchaus realistischen Analysen, die sich immerhin auch auf wirtschaftswissenschaftliche und -politische Phänomene wie Arbeit, Kapital, Makroökonomie, Haushaltspolitik, Konsumgüter-Marketing, Außenhandel u.a.m. beziehen. Im Mittelpunkt stehen jedoch, jeweils idealtypisch:
2.4.3.1 sozialistische Planung
Computer und Internet eröffnen dem Sozialismus ganz neue Möglichkeiten. Makroökonomie, aber auch Detailprobleme wie die der Arbeitszeiten, sind plötzlich in ungeahnter Schnelligkeit berechenbar: „Beim Gebrauch heutiger Supercomputer ist die Berechnung der Arbeitszeiten für eine ganze Volkswirtschaft in nur wenigen Minuten machbar.“22 Was sich aber gar nicht realisieren lässt, solange die real existierenden kapitalistischen Unternehmen – angeblich aus Gründen des Datenschutzes und der Computersicherheit – ihre Dateien streng unter Verschluss halten. Wohingegen in einem neuen IT-Sozialismus „makroökonomische Planung, strategische Planung und Produktionsplanung“ zum Wohle der Allgemeinheit selbstverständlich wären (a.O. S. 94). Wodurch sich nicht nur der Lebensstandard insbesondere der Arbeiterklasse, sondern auch das allgemeine kulturelle Niveau beträchtlich erhöhen würde (S. 93).
2.4.3.2 direkte Demokratie
Erstaunlicherweise greifen die Autoren hier auf den „ demos“ der attischen Demokratie zurück, den sie sowohl dem sowjetischen Zentralismus als auch der kapitalistischen Machtausübung entgegenstellen. Nicht käufliche Machteliten und „Experten“, sondern das Volk selbst soll alle wichtigen Entscheidungen in direkter Abstimmung treffen. Was technisch umso weniger problematisch erscheint, je mehr Bürgerinnen und Bürger über TV und einen PC verfügen, der zugleich als elektronisches Abstimmungsgerät dienen kann. Im neuen sozialistisch-demokratischen „Azephalus-Staat“ gibt es weder Zentralismus noch Hierarchie, „keine Regierung, keinen Premierminister, keinen Präsidenten, kein Staatsoberhaupt“ (a.O. S. 226, 229). Das Volk selbst wäre endlich Herr im eigenen Haus, und zwar durch die Gewährung positiver Rechte, von denen die Autoren als wichtigste nennen: „(1) Das Recht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, (2) Das Recht, den vollen Wert ihrer Arbeit zu erhalten und (3) Das Recht, über den Wert ihrer Arbeit nach eigenem Wunsch frei zu verfügen.“ (a.O. S. 245). Das wären neuartige Eigentumsrechte, und zugleich das Ende von Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Entfremdung und Fremdbestimmung: „Erst, wenn allen Bürgern eine aktive Rolle in der Wirtschaft ermöglicht wird, kann das Wohl der Gesellschaft als Ganzes maximiert werden.“ (ebd.) So dass auch für die Umwelt-Probleme einschließlich der Ressourcen-Nutzung vernünftige Lösungen zu finden wären. Wozu die Autoren vorschlagen, nicht mehr nationale Sonderwege und Eigenbröteleien zuzulassen, sondern eine neue „globale Autorität“, eine internationale (UNO-?) Behörde zu schaffen, die über die sinnvolle Nutzung der weltweiten Ressourcen und z.B. deren Schutz vor ausufernden Schadstoffemissionen wacht (S. 256).
Insgesamt: eine wunderschöne neue Welt der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Aber: Wie soll sie erreicht, wie geschaffen, wie durchgesetzt werden? Und warum sind wir ihr seit dem Erscheinen der Vorschläge von Cockshott und Cottrell im Jahre 1993 fast keinen Schritt näher gekommen? – Hätte nicht das Scheitern sowohl der sowjetischen als auch der französischen (pseudo-)sozialistischen Experimente (1983 bzw. 1989 ff.) Autoren wie Sarkar, Kern, Cockshott, Cottrell und die Verfasser der ‚Erklärung von Belém‘ zu ganz anderen Schlussfolgerungen veranlassen müssen? Dazu mehr im Folgenden.
2.5 Marktwirtschaft, Wirtschaftsdemokratie, Marktsozialismus
Mit dem Diplomökonomen Siegfried Wenzel (1929-2015) stimme ich darin überein, dass es sinnvoll und naheliegend ist, auf dem Weg zu einem neuartigen Sozialismus „den in der sechstausendjährigen Geschichte der Warenwirtschaft ausgebildeten marktwirtschaftlichen Regulationsmechanismus neben der makroökonomischen Planung als ein Hauptsteuerungsinstrument der wirtschaftlichen Entwicklung zu nutzen“.23 Wobei zu beachten ist, dass Wenzel DDR-Bürger war und über umfangreiche praktische Ökonomie- und Politik-Erfahrungen verfügte, zumal er u.a. in der Staatlichen Plankommission der DDR gearbeitet hat. Seit ca. 1990 plädiert er für Marktwirtschaft, wenn auch nicht unter kapitalistischem Vorzeichen. Kapitalistisch wird der Waren-Produzent stets finanziell und sozial begünstigt, der Konsu-ment dagegen benachteiligt, so dass Klassenunterschiede und -gegen-sätze permanent verstärkt werden.
Sozialistisch soll das Gegenteil davon erreicht werden, nämlich eine Entwicklung hin zu einer solidarischen, gerechten, klassenlosen Gesellschaft. Praktisch könnte dies wahrscheinlich nur dann möglich werden, wenn die Marktwirtschaft gesamtgesellschaftlicher Kontrolle unterworfen wird, makro- und mikroökonomisch durch kompetente Steuerungs-Behörden möglichst auf allen Ebenen, von der Arbeiter-Kontrolle in den Betrieben über lokale und nationale Einrichtungen bis hin zu internationalen Gremien, auch z.B. durch entsprechende Neuerungen in der UNO.
Kapitalistische Marktwirtschaft müsste somit zu einem neuen Marktsozialismus transformiert werden, wozu neben politischer Macht die Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung erforderlich ist. Hierzu schreibt Wenzel: „Bei einem solchen Weg muss nicht die Frage einer abrupten, grundlegenden Veränderung der ökonomischen Beziehungen, der Steuerungsinstrumente und der in Jahrhunderten gewachsenen Alltagskultur gestellt werden. Die gesellschaftliche Entwicklung könnte sich in einem Umfeld vollziehen, das den Menschen vertraut ist; dadurch könnten auch die Ängste einer Bevölkerungsmehrheit in den entwickelten Ländern abgebaut und ihre Gewinnung für eine demokratische Veränderung des Bestehenden in Richtung einer solidarischen, ökologisch fundierten Gesellschafts-entwicklung wesentlich erleichtert werden. Es spricht viel für die ebenso zielgerichtete wie sensible Fortführung des in Jahrhunderten Gewachsenen.“ (a.O.) Nicht Traditionsbruch um jeden Preis, sondern sinnvolle Neuorientierung und Transformation wären das Gebot der Stunde.
2.5.1 Zur Theorie des Marktsozialismus
Um einen friedlichen, gewaltfreien Übergang zum Sozialismus angesichts der gegenwärtigen Weltlage wenigstens denkbar zu machen, muss ein neuer Marktsozialismus mit einer demokratischen Verfassung des Gemeinwesens vereinbar sein. So sieht es jedenfalls der US-amerikanische Mathematiker und Philosoph David Schweikart (geb. 1942), der allerdings, anders als Wenzel, eine makro-ökono-mische staatliche Planungsbehörde für überflüssig hält. In Schweikarts Konzept erkennt der Wirtschaftswissenschaftler Michael R. Krätke (geb. 1950) drei Hauptelemente, die er wie folgt zusammenfasst: „1. Alle Unternehmen sind selbständig, vom Staat unabhängig, genos-senschaftlich organisiert und werden von den Genossen nach Maßgabe einer demokratischen Betriebsverfassung selbst verwaltet. 2. Es gibt Märkte mit freier Konkurrenz für die meisten Güter und Dienstleistungen. Es gibt keine zentrale Produktionsplanung. Es gibt aber auch keinen „freien Arbeitsmarkt“. Die Bürger sind frei, sich einer Genossenschaft anzuschließen bzw. mit anderen eine neue Genossenschaft zu gründen, nicht aber, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. 3. Die Investitionen unterliegen einer gesellschaftlichen, demokratisch organisierten Kontrolle. ... Über die Verwendung und Allokation dieser Investitionsfonds wird demokratisch entschieden, nicht von einer Planungsbehörde, sondern von Parlamenten (auf verschiedenen Ebenen).“24 In diesem Modell treten „Bürger-Genossen“ an die Stelle von Kapitalisten und Lohnarbeitern. Ihre neue Sozialistische Markt-wirtschaft25 soll ohne Privatunternehmen und Kapitalbesitzer funktio-nieren. Zwar gibt es in diesem „Genossenschaftssozialismus“ keine Vollbeschäftigungs- Garantie, dafür aber eine demokratische Investitionsplanung und -steuerung, die nicht mehr dem Prinzip der Profitmaximierung, sondern dem der Bedürfnisbefriedigung für alle Bürgerinnen und Bürger folgt. Ob dies allerdings dauerhaft ohne gesamtwirtschaftliche und -gesellschaftliche Rahmenplanung (der Makroökonomie usw.) überhaupt möglich wäre, scheint durchaus fraglich zu sein.
2.6 Synopse: Nah- und Fernziele eines Demokratischen Öko-Sozialismus
lassen sich aus dem zum Thema Dargelegten ableiten, wenn auch nicht automatisch. Vielmehr gilt es, bestimmte Kriterien zu beachten, darunter vor allem die historisch-politischen Erfahrungen, ins-besondere mit den gescheiterten Experimenten des Sowjet-Kommunismus, aber auch des französischen Sozialismus (s.o.). Dogmatisch verteidigte Revolutionstheorien erweisen sich durchweg als unzulänglich. Friedliche, gewaltfreie, demokratisch kontrollierte Übergänge zum Öko-Sozialismus scheinen möglich zu sein, wobei ich die Erkenntnisse u.a. von Schweikart und Wenzel (s.o.) für besonders relevant und hilfreich halte.
Für unrealistisch halte ich dagegen die von Sarkar u.a. erhobene Forderung nach „Schrumpfung der Wirtschaft“. Sie würde abgelehnt, weil in weiten Teilen der Bevölkerungen, zumal in den Unterschichten nicht nur der Dritten Welt, ohnehin Armut, Not und sogar Hunger herrschen. Während dort, wo es den Menschen, z.B. auf Grund sozialstaatlicher Leistungen, besser geht, massive Verunsicherung und Infragestellung bisheriger Wohlfahrtsleistungen eintreten würden. All dies dürfte unzumutbar sein.
Wenn ich in der folgenden Übersicht zwischen Nahzielen und Fernzielen von Ökologie, Demokratie und Sozialismus unterscheide, so dient dies vor allem der besseren Verständlichkeit. In Wirklichkeit bedingen die fünf Begriffe sich wechselseitig, stellen die Rubriken keine „fensterlosen Monaden“ dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ökologie:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Demokratie:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Sozialismus:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.7 Und wie kann ein Demokratischer Öko-Sozialismus Wirklichkeit werden? Zur Teleo-Logik des Sozialismus in Über-gangsgesellschaften („Die Wahrheit des Sozialen ist der Sozialismus.“)
Wenn die Wahrheit des Sozialen der Sozialismus ist, bedarf es sowohl einer Wahrheitstheorie (s.o.) als auch einer Theorie des Sozialen. Dass es Soziales, z.B. in Form des Sozialstaats („Wohlfahrtsstaat“) und der sozialen Errungenschaften überhaupt, gibt, kann nicht bezweifelt werden. Sozialismus dagegen, wie er z.B. Marx und Bloch im Ideal des Reiches der Freiheit vorschwebt, gibt es bisher anscheinend nirgendwo. Folglich verhält es sich mit dem Sozialen ähnlich wie mit der Wahrheit: Es gibt das Soziale, aber noch nicht in voller Wahrheit, nicht in derjenigen des Sozialismus.
Über Möglichkeiten, im 21. Jahrhundert Wege zum Sozialismus zu finden, ist viel geschrieben worden. Als Grundvoraussetzung (conditio sine qua non) gilt die Erringung der politischen Macht im Staat. Der Marxist Heinz Dieterich stellt fest: „Die entscheidende Macht-bedingung für die Transition zum neuen Sozialismus ist, wie in allen klassengesellschaftlichen Phasen, die Kontrolle des Staates. Diese kann, theoretisch, fünf Modellen folgen: dem sowjetischen, dem chinesischen, dem venezolanischen, dem iranischen oder dem Implosions-Modell bestimmter realsozialistischer europäischer Staaten.“26 Dem ersten Satz dieser Analyse stimme ich zu, dem zweiten nicht. Auch öko-sozialistische Umgestaltung wird nicht möglich sein, wenn die Staatsmacht nicht „mitzieht“. Für nicht weniger wichtig halte ich die Zustimmung einer großen Mehrheit der Bevölkerung, wofür zunächst intensives Engagement in politischer Aktivität und Aufklärungsarbeit erforderlich ist. – Für wenig hilfreich halte ich Dieterichs Hinweis auf die „fünf Modelle“, die „theoretisch“ der Machtgewinnung und -ausübung dienen sollen. Alle fünf Modelle haben sich nämlich als unzureichend und zumeist unpassend und auf keinen Fall in hoch entwickelten, digital revolutionierten Industrie-ländern anwendbar erwiesen. Wenn Dieterich obendrein das Adverb „theoretisch“ benutzt, verrät er damit seine unausgesprochenen, schwerwiegenden Zweifelsgründe: Was nur „theoretisch“ Sinn macht, bleibt für die politische Praxis ohne Bedeutung; und zwar erst recht in marxistischer Sicht, wonach Theorie und Praxis stets als dialektische Einheit zu begreifen sind.
Zumindest für hochentwickelte Industrieländer sind daher andere als die mit den „fünf Modellen“ implizierten Strategien des Übergangs zu entwickeln. Wenn das Soziale im Sozialismus zu voller Wahrheit aufblühen soll, muss es selbst als Ausgangsbasis der Umgestaltung dienen, so dass zunächst bei den bestehenden sozialen Errungen-schaften, speziell des Sozialstaats, anzuknüpfen ist.
2.7.1 Zur konkreten Analyse der konkreten Situation
Unumgänglich ist es, sich über das bereits vorhandene Soziale einen möglichst klaren Überblick zu verschaffen. Hinsichtlich der sozialen Errungenschaften galt Deutschland lange Zeit als vorbildlich, verfügte es doch – u.a. auf Grund des Sozialstaats-Prinzips – über hochentwickelte und bestens organisierte Systeme der Sozial- und Krankenversicherung, der medizinischen Versorgung und, seit 1949, auch über eine freiheitliche Grundordnung in einem demokratischen Rechtsstaat. Und noch heute gibt es ein weltweit anerkanntes „Leistungsspektrum des deutschen Sozialstaats“ mit a) Fürsorge- leistungen wie Arbeitslosengeld, Wohngeld und Sozialhilfe, b) Ver-sorgungsleistungen wie Kindergeld und Beamtenbesoldung, c) Ver-sicherungsleistungen wie Renten, Pensionen, Kranken-, Pflege-, Mutterschafts- und Invaliditäts-Versicherungen.27
Globale Infragestellungen dieser Systeme geschahen relativ selten, am heftigsten vielleicht während der Studenten-Revolte von 1968, die sich allerdings nicht gegen das Sozialstaatsprinzip richtete. Gravierende Krisen-Symptome traten aber seit dem um 1990 beginnenden „Siegeszug“ des neoliberalen Turbo-Kapitalismus auf, verstärkt durch die globale Finanz- und Bankenkrise des Jahres 2008.Was für Notlagen dabei zu beklagen waren, geht aus einem im April 2012 im Deutschen Bundestag gestellten Antrag der Fraktion DIE LINKE hervor, in dem es heißt, „in der Europäischen Union“ seien „über Jahrzehnte erkämpfte soziale Errungenschaften in Gefahr“, zumal „auch nach vier Jahren ... die Finanz- und Wirtschaftskrise sowie ihre Ursachen ungelöst“ seien und „mehrere süd- und osteuropäische Staaten kurz vor dem finanziellen Ruin; ihre Bürgerinnen und Bürger vor dem sozialen Absturz“28 stünden. Nicht die durch Lohndumping künstlich bevorteilte deutsche Wirtschaft, wohl aber mehrere sogenannte „ärmere“ EU-Länder waren dem sozialen Kollaps nahe, krisenbedingt durch massiven Sozialabbau, Erhöhung von Verbrauchssteuern, Lohn- und Rentenkürzungen usw., was jedoch nicht zur Behebung, sondern zur Verschärfung der Krise führte. – Dagegen forderte die Linkspartei neue Schutzmaßnahmen u.a. für die Öffentlichen Haushalte sowie zur Arbeitsbeschaffungs- und Sozialpolitik, darunter auch „ein effektives, europaweites Zukunftsinvestitionsprogramm zum sozialökologischen Umbau, kurzfristig Konjunkturpakete in den Krisenstaaten und sanktionsfreie Mindestsicherungssysteme“ (Drucksache ... a.O. S. 3).
Ob bzw. inwieweit diese Forderungen inzwischen erfüllt worden sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Dennoch lässt sich an Hand der beschriebenen Fehlentwicklung exemplarisch zeigen, woran bisher das Nahziel der Stärkung und Erweiterung des Sozialstaats scheitert. Um hier endlich wieder Fortschritte zu erzielen, ist aktives politisches Engagement auf allen Ebenen erforderlich, was sinngemäß auch für alle weiteren Ziele eines neuen Öko-Sozialismus gilt (s.o.). Aufklärende Agitation und Propaganda, ‚Agitprop‘ im besten und weitesten Sinne des Begriffs, sind vonnöten, um, über alle Partei- und Gesinnungsgrenzen hinweg, der gesamtgesellschaftlichen Emanzipation, dem Vorschein des Reichs der Freiheit, näher zu kommen.
3. Ästhetik. Person – Kunst – Materie – Sozialismus und Freiheit
Wie eine personalistische Ästhetik beschaffen sein kann, habe ich in meinem Personalismus-Buch (2003) dargelegt, so dass ich mich im Folgenden kurzfassen kann. Künstler*innen genießen das Privileg der Nicht-Entfremdung, der wahrhaft freien Entfaltung ihrer Persön-lichkeit in ihren Werken. Bereits in der Gegenwart arbeiten sie an der Errichtung des Reichs der Freiheit, das eines Tages, unter soziali-stischem Vorzeichen, jedem Menschen die volle Freiheit im Sinne künstlerischer Kreativität gewähren kann. Eine dem gemäße Definition der Kunst hat Ernst Bloch wie folgt vorgeschlagen: „ Kunst ist ein Laboratorium und ebenso ein Fest ausgeführter Möglichkeiten, mitsamt den durcherfahrenen Alternativen darin, wobei die Ausführung wie das Resultat in der Weise des fundierten Scheins geschehen, nämlich des welthaft vollendeten Vor-Scheins.“29
Dialektisch-materialistisch liegt solche Vollendung im Bereich des Möglichen, zumal die Materie selbst im Fluss des „In-Möglichkeit-Seins“ steht. Weil die Kunst „das sinnliche Scheinen der Idee“ (Hegel) verkörpert, entstehen in ihr immer wieder neue Synthesen aus Personalität, Geist und Materie.
Die Idee der Freiheit so weit wie möglich, und zwar für alle Menschen, zu verwirklichen, ist das Ziel des Sozialismus: die „freie Assoziation freier Individuen“, von der Marx spricht, ohne jedoch im Detail anzugeben, wie diese Freiheit konkret gestaltet bzw. gestaltbar sein wird. Worin ihm Herbert Marcuse, ein Marxist des 20. Jahr-hunderts, folgt, indem er erklärt, man könne „den Sozialismus nicht malen“.
Auf genau diese Zurückhaltung verzichtet Oscar Wilde (1854-1900), der Schöpfer hervorragender sprachlicher Kunstwerke. Im Sozialismus sieht Wilde die Voraussetzung dafür, den Individualismus als wahre Freiheit der Person zu verwirklichen; und er malt sich auch aus, welche Kunst diesem Ideal am ehesten gerecht werden könnte, und zwar in seinem 1891 erschienenen Essay The soul of man under socialism, deutsch: Der Sozialismus und die Seele des Menschen.30 Im Sozialismus werde es weder Armut noch erzwungene Arbeit geben. Selbstverwirklichung, wie sie bisher nur „die Dichter, die Philosophen, die Geistmenschen, ... die Menschen, die sich selbst verwirklicht haben“, erreichen, soll jedem Individuum ermöglicht werden, und zwar, um „das Schöne zu tun“ (a.O. 11, 32): allgemeine Freiheit durch die Kunst! Individualismus als Kunst ist für Wilde diejenige „zerstörende und zersetzende Kraft“, die darauf abzielt, „die Eintönigkeit des Typus, die Sklaverei der Gewohnheit, die Tyrannei der Sitte und die Erniedrigung des Menschen auf die Stufe einer Maschine“ zu beseitigen und durch Kreativität zu ersetzen (a.O. S. 40 f.) Und: „Wenn der Mensch glücklich ist, dann ist er in Harmonie mit sich selbst und seiner Umgebung. Der neue Individualismus, in dessen Diensten der Sozialismus, ob er es will oder nicht, am Werke ist, wird vollendete Harmonie sein.“ (a.O. S. 73)
Welche Art von Kunst kann diesem Ideal entsprechen? Oder, wie Wilde fragt: „Was ist ein gesundes und was ein ungesundes Kunstwerk?“ (a.O. S. 44) Wilde bezieht diese Fragen a) auf den Stil eines Kunstwerks, b) auf dessen Gegenstand und c) „auf beide zugleich“. Und er stellt fest: „Hinsichtlich des Stils ist ein Kunstwerk gesund, wenn sein Stil die Schönheit des Materials, das es verwendet, erkennen läßt, bestehe es nun aus Worten, aus Bronze, aus Farben oder aus Elfenbein, und wenn es diese Schönheit als Mittel zur Erzeugung der ästhetischen Wirkung benutzt. Hinsichtlich des Gegenstandes ist ein Kunstwerk gesund, wenn die Wahl dieses Gegenstandes vom Temperament des Künstlers bedingt ist und unmittelbar aus ihm entspringt. Kurz, ein Kunstwerk ist gesund, wenn es sowohl Vollendung wie Persönlichkeit hat.“ (ebd.)
Im Kunstwerk sieht Wilde also bedeutsame Aspekte von Materialität und Personalität vereinigt. Für den künstlerischen Ausdruck gebe es keine Grenzen und keine „Dekadenz“. Künstler innen vertragen keinerlei politischen Zwang, keinerlei „autoritäre Gewalt“ über sich: „ Die Regierungsform, die für den Künstler am geeignetsten ist, ist: überhaupt keine Regierung.“ (S. 59) – Und genau dies entspricht wohl dem, was Karl Marx unter dem Reich der Freiheit und der freien Assoziation freier Individuen verstand.
Literaturverzeichnis
Altvater, Elmar 2002: Rezension zu Sarkar 2001, www.deutschlandfunk.de/saral-sarkar-die.nachhaltige-...
Belém 2009: https://www.oekologische-plattform.de/die-oekosozialistische-erklaerung-von-belem/
Bloch, Ernst 1972: Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz, Frankfurt a.M.
Bloch, Ernst 1977: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a.M.
Bloch, Ernst 1977a): Philosophische Aufsätze zur objektiven Phantasie, Frankfurt a.M.
Bojanowski, Axel 2015: „Die Welt einigt sich auf historischen Klimavertrag“, www.spiegel.de...
Cockshott, W. Paul / Cottrell, Allin 2001: Alternativen aus dem Rechner. Für sozialistische Planung und direkte Demokratie, Köln
Der deutsche Sozialstaat. www.bpb.de/politik/grundfragen/24-deutschland/40475/sozialstaat
Dieterich, Heinz 2011: „Übergänge zum Sozialismus im 21. Jahrhundert“, in: Brie / Detje / Steinitz (Hrsg.): Wege zum Sozialismus im 21. Jahrhundert. Alternativen – Entwicklungspfade – Utopien, Hamburg 2011, S. 128-143
Drucksache 17/ 9410 (vom 25.4.2012):
Engert, Klaus 2010: Ökosozialismus – das geht!, Köln
Gastbeitrag 2015: „ Frankreich unter Mitterrand – Wie das Kapital die Hoffnung zerstörte“, https://die freiheitsliebe.de/author/salam
Karathanassis, Athanasios 2009: Rezension zu Sarkar 2001, www.glasnost.de/autoren/athan/oekosoz.html
Krätke, Michael R. 2003: „Wirtschaftsdemokratie und Marktsozialismus, www.praxisphilosophie.de/kraetkewd.pdf
Kromp-Kolb, Helga / Formeyer, Herbert 2005: Schwarzbuch Klimawandel. Wie viel Zeit bleibt uns noch?, Salzburg
Lienkamp, Andreas 2009: Klimawandel und Gerechtigkeit. Eine Ethik der Nachhaltigkeit in christlicher Perspektive, Paderborn
Robra, Klaus 2003: Und weil der Mensch Person ist … Person-Begriff und Personalismus im Zeitalter der (Welt-) Krisen, Essen
Robra, Klaus 2011: „ Substanz und Sozialismus bei Ernst Bloch“, in: ‚VorSchein‘ Nr. 31 (s.o.), Nürnberg 2011, S. 69-92
Robra, Klaus 2015: Wege zum Sinn, Hamburg
Sarkar, Saral 2001: Die nachhaltige Gesellschaft. Eine kritische Analyse der Systemalternativen (Rotpunktverlag)
Sartre, Jean-Paul 1983: Cahiers pour une morale, Paris
Schumann, Harald / Grefe, Christiane 2009: Der globale Countdown. Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung – die Zukunft der Globalisierung, Köln
Wenzel, Siegfried 2006: „Sozialismus des 21. Jahrhunderts?“ www.linksnet.de/de/artikel/20094
Wilde, Oscar 1970: Der Sozialismus und die Seele des Menschen, Zürich
1 Robra 2003, S. 154
2 Schumann / Grefe 2009, S. 14
3 Vgl. Robra 2015, S. 338 f.
4 Lienkamp 2009, S. 359
5 Kromp-Kolb / Formayer 2005, S. 213
6 Schumann / Grefe 2009, S. 324 f.
7 Es muss natürlich heißen: „Reverenz ...“!
8 Bojanowski 2015, S. 3
9 Vgl. Robra 2011, S. 69-92
10 Bloch 1977 a), S. 243
11 Vgl. Bloch 1972, S. 234 f.
12 Bloch 1977 a), S. 571
13 Bloch 1977, S. 679
14 In: Gastbeitrag 2015, S. 1
15 Hierzu auch: Smail Rapic: „ Höllenfahrt einer politischen Utopie? – Das Ende des Marxismus und seine offenen Fragen, http://www.philosophie.uni-wuppertal.de/praktische-philosophie/professorinnen/prof-dr-smail-rapic.html
16 In Tübingen (ca. 1968) bezeichnete er Bismarck einmal als den „Fälscher der Emser Depesche“.
17 Sarkar 2001, S. 218
18 Altvater 2002, S. 2
19 Zit. bei Karathanassis 2009, S. 2
20 Belém 2009, S. 4-5
21 W. Lotter in der Zeitschrift ‚brandeins‘, 11/November 2016, S. 40
22 Cockshott/Cottrell 2001 (1993), S. 83
23 Wenzel 2006
24 Krätke 2003. Hierzu auch: Engert 2010.
25 Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen offiziellen Staatsdoktrin Chinas und Vietnams, die aus historisch-politischen Gründen völlig anders geartet ist.
26 Dieterich 2011, S. 141
27 Vgl. Der deutsche Sozialstaat (s. Literaturverzeichnis!). U.a. führte das Lohndumping inzwischen zu schlimmen Missständen, insbesondere beim Arbeitslosengeld (Hartz IV) und bei den Renten. Ein Lichtblick dagegen: die Einführung des Mindestlohns.
28 Drucksache 17/ 9410 , S. 1 (s. Literaturverzeichnis!)
29 Bloch 1977, S. 249
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Der Text untersucht die Notwendigkeit eines Demokratischen Öko-Sozialismus als Lösung für globale Krisen, einschließlich der Globalisierungskrise, der Umweltzerstörung und der digitalen Revolution. Es werden verschiedene Aspekte des Sozialismus, der Demokratie und der Ökologie analysiert und in Beziehung gesetzt.
Welche Krisen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt hauptsächlich drei Krisen: die Globalisierungskrise des Turbo-Kapitalismus, die Umwelt- und Klimakrise (Öko-Krise) und die Herausforderungen der digitalen Revolution.
Was versteht der Text unter Demokratischem Öko-Sozialismus?
Der Demokratische Öko-Sozialismus wird als ein Gegenmodell zum aktuellen globalisierten neoliberalen Turbo-Kapitalismus vorgeschlagen, das auf den Prinzipien der Demokratie, der Ökologie und des Sozialismus basiert. Es zielt darauf ab, soziale Ungleichheiten zu verringern, die Umwelt zu schützen und die Freiheit aller zu gewährleisten.
Was sind einige der im Text genannten historischen Beispiele sozialistischer Experimente?
Der Text erwähnt das Scheitern des im Ostblock „real existierenden Sozialismus“ sowie das französische ‚Projet socialiste‘ zu Beginn der 1980er Jahre als Beispiele gescheiterter sozialistischer Experimente.
Welche Rolle spielt die digitale Revolution im Kontext des Demokratischen Öko-Sozialismus?
Die digitale Revolution wird als ein zweischneidiges Schwert dargestellt, das einerseits neue Möglichkeiten für das Person-Sein eröffnet, andererseits aber auch neue Gefahren birgt, insbesondere im Hinblick auf Überwachung und Verlust der Freiheit. Der Text betont die Notwendigkeit, sich sowohl individuell als auch gesellschaftlich gegen diese Gefahren zur Wehr zu setzen.
Was sind die Hauptziele eines Demokratischen Öko-Sozialismus laut Text?
Zu den Hauptzielen gehören die schrittweise Beseitigung sozialer Ungerechtigkeiten, die Mitbestimmung und Teilhabe der Werktätigen, die direkte gesellschaftliche Kontrolle der Produktionsmittel und der Schutz der Umwelt.
Welche Kritik wird am Konzept des Öko-Sozialismus geäußert?
Kritiker bemängeln, dass einige Konzepte des Öko-Sozialismus, wie z.B. die Forderung nach „Schrumpfung der Wirtschaft“, unrealistisch und potenziell autoritär seien. Es wird auch die Gefahr eines erneuten Staatssozialismus sowjetischer Prägung gesehen.
Welche Rolle spielt die Ästhetik im Kontext des Sozialismus und der Freiheit?
Der Text betont, dass die Kunst ein Laboratorium und Fest ausgeführter Möglichkeiten ist. Im Sozialismus sollte jeder Mensch die volle Freiheit im Sinne künstlerischer Kreativität haben. Der Individualismus, wie er von Oscar Wilde beschrieben wird, ist eng mit der Idee der Selbstverwirklichung verbunden, die im Sozialismus gefördert werden soll.
Was sind Nah- und Fernziele im Rahmen eines Demokratischen Öko-Sozialismus?
Nahziele umfassen die Stärkung des Sozialstaats, ökologische Nachhaltigkeit durch Förderung erneuerbarer Energien und Schutz der Artenvielfalt, demokratische Beteiligung auf allen Ebenen und soziale Gerechtigkeit durch faire Löhne und Bildungschancen. Fernziele umfassen eine umfassende ökologische Nachhaltigkeit mit Kreislaufwirtschaft, eine umfassende direkte Demokratie mit Bürgerbeteiligung und eine klassenlose Gesellschaft mit gleichem Zugang zu Ressourcen und Bildung.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text hinsichtlich der Realisierbarkeit eines Demokratischen Öko-Sozialismus?
Der Text argumentiert, dass friedliche, gewaltfreie und demokratisch kontrollierte Übergänge zum Öko-Sozialismus möglich sind. Es wird betont, dass die Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung sowie aktives politisches Engagement auf allen Ebenen erforderlich sind. Dogmatisch verteidigte Revolutionstheorien werden als unzulänglich betrachtet.
- Quote paper
- Dr. Klaus Robra (Author), 2018, Neue Wege zu einem Demokratischen Öko-Sozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/453321