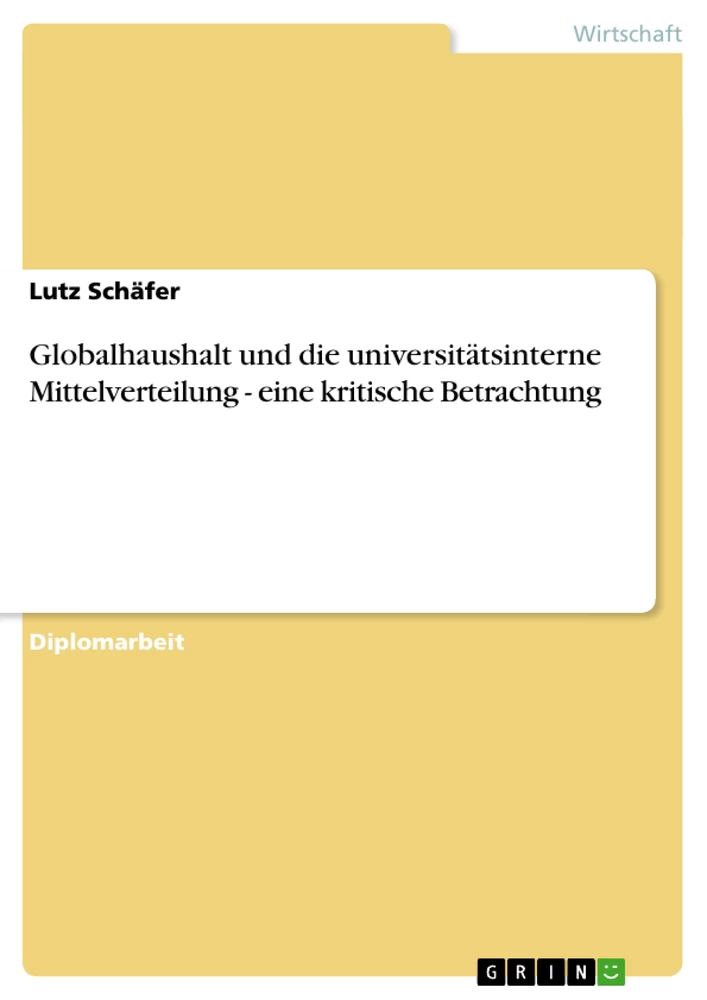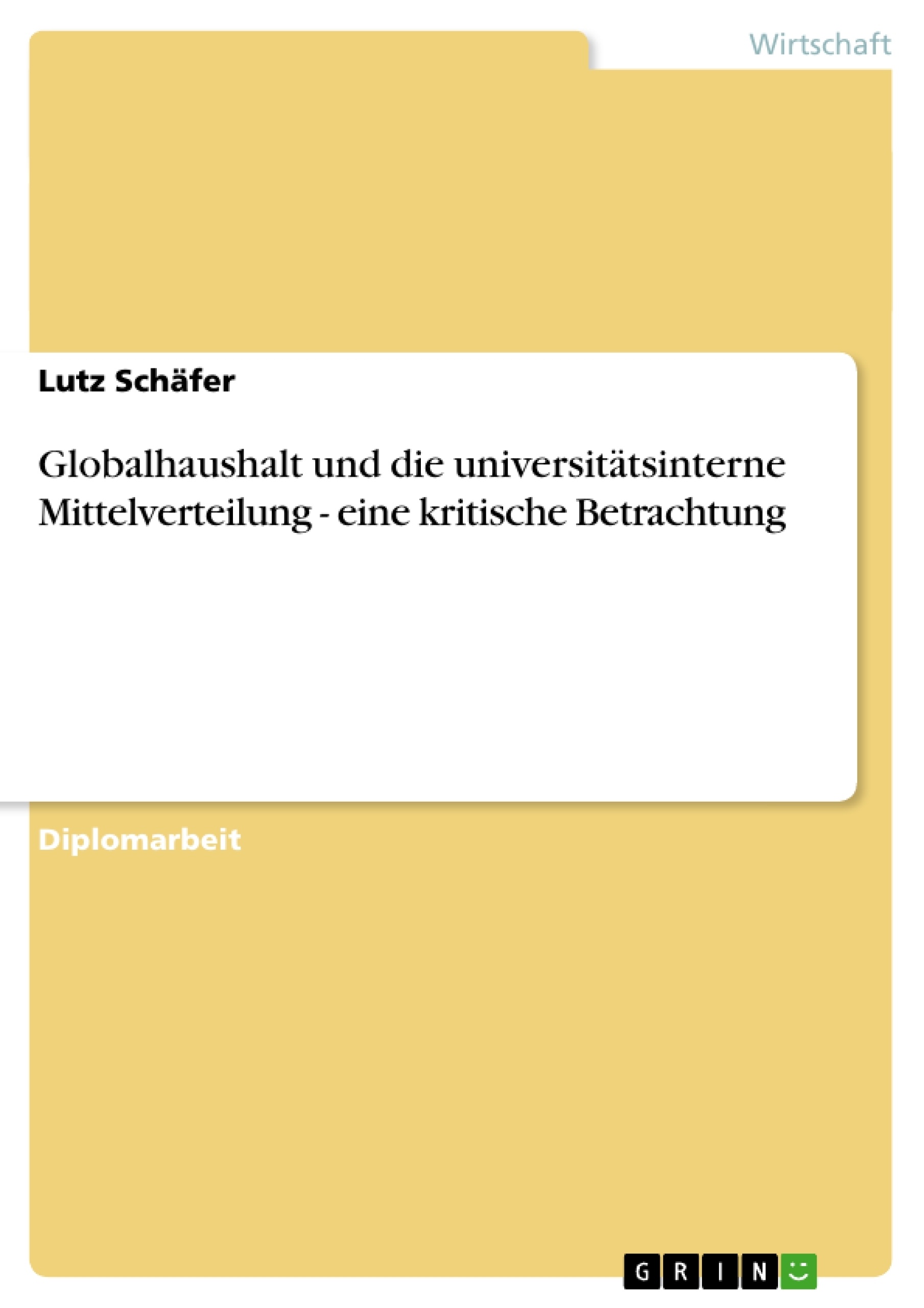Seit Beginn der 90’er Jahre wird eine Neuorganisation der finanziellen Verteilungssysteme in der öffentlichen Verwaltung, speziell in den Hochschulhaushalten, diskutiert. Der Grund dafür ist, dass die bisherige Finanzierungspolitik als veraltet und den Anforderungen der Zukunft als nicht gewachsen angesehen wird.
Das alte kameralistische Finanzierungsmodell, basierend auf Ausgabentiteln und Budgetfortschreibung, weist einige Schwächen auf, die ein neues und umfassendes Modell der Mittelverteilung zu lösen versucht. Ein mögliches neues Verfahren soll unter anderem folgendes leisten:
•Mittelverteilung nach Leistung, Innovation und Übernahme staatlich vorgegebener Aufgaben
•Autonomie bei der hochschulinternen Mittelweiterverteilung
•Integration von Anreiz und Sanktionsmechanismen
•Eine fundierte Rechtfertigung der Hochschulbudgets durch die Bindung der Mittel an Outputgrößen.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht soll sich die Hochschule mehr als Leistungserbringer verstehen, eine Organisation die Produkte anbietet, sei es Forschung, Bildung oder Dienstleistung an Externe. Die Qualität und Quantität dieser Leistungen sollen in Zukunft darüber entscheiden, welche Ressourcen den einzelnen Leistungserbringern zugeteilt werden. Für diesen Erneuerungsprozess haben sich mehrere, synonym zu verwendende, Begriffe herausgebildet, die jedoch die gesamte öffentliche Verwaltung einbeziehen. Zu nennen sind das „New Public Management“ (NPM), das „Neue Steuerungsmodell“ (NSM) und die „Neue
Verwaltungssteuerung“ (NVS).
Auf Grund der zunehmenden Aktivitäten der Hochschulen, auch in Mecklenburg-Vorpommern, wird die Problematik in dieser Arbeit zum Thema. Sie soll Überblick und Kritik zugleich sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
- 2 Von der Kameralistik zu neuen Konzepten der Mittelverteilung
- 2.1 Die historischen Verteilungssysteme
- 2.1.1 Grundbegriffe und Verfahrensablauf
- 2.1.2 Kritik an den klassischen Verfahren der Mittelplanung und -verteilung
- 2.2 Der Globalhaushalt
- 2.3 Die Formelgebundene Mittelverteilung
- 2.3.1 Einleitung
- 2.3.2 Ebenen der Mittelverteilung
- 2.3.3 Zusammenhang zwischen Formelgebundener Mittelverteilung, Zielvereinbarungen und Vorabzuweisungen
- 2.3.4 Ziele der Formelgebundenen Mittelverteilung
- 2.3.5 Das Grundmodell der Formelgebundenen Mittelvergabe im Einzelnen
- 2.3.5.1 Das Modell im Überblick
- 2.3.5.2 Indikatoren der volumenbezogenen Zuweisung
- 2.3.5.3 Indikatoren der leistungsbezogenen Zuweisung
- 2.3.5.4 Indikatoren der strukturbezogenen Zuweisung
- 3 Kritische Analyse der Formelgebundenen Mittelzuweisung
- 3.1 Das Gesamtkonzept
- 3.2 Die Indikatoren
- 3.2.1 Methodisches Vorgehen bei der Analyse
- 3.2.2 Umfassende Übersicht der möglichen Indikatoren
- 3.2.3 Analysierte Indikatoren der volumenbezogenen Zuweisung
- 3.2.4 Analysierte Indikatoren der leistungsbezogenen Zuweisung
- 3.2.5 Analysierte Indikatoren der strukturbezogenen Zuweisung
- 4 Umsetzung der Formelgebundenen Mittelverteilung am Beispiel
- 4.1 Das Verteilungsmodell auf der Landesebene in Mecklenburg-Vorpommern
- 4.1.1 Funktionsweise und Berechnung
- 4.1.2 Kritik an diesem Modell
- 4.2 Das interne Verteilungssystem der Universität Rostock
- 4.2.1 Funktionsweise und Berechnung
- 4.2.2 Kritik an diesem Modell
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der kritischen Analyse der Formelgebundenen Mittelverteilung im Hochschulbereich. Sie untersucht die Anwendung dieses Systems im Kontext des Globalhaushalts und analysiert seine Auswirkungen auf die universitätsinterne Mittelverteilung.
- Die historischen Entwicklungen der Mittelverteilungsmodelle im Hochschulbereich.
- Die Funktionsweise und Prinzipien der Formelgebundenen Mittelverteilung.
- Die Kritik an den bestehenden Indikatoren und deren Auswirkungen auf die Mittelzuweisung.
- Die Anwendung der Formelgebundenen Mittelverteilung auf Landes- und universitätsinterner Ebene.
- Die Auswirkungen des Systems auf die Forschung und Lehre.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung der Mittelverteilung im Hochschulbereich ein und erläutert die Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit. Kapitel zwei beleuchtet die historischen Entwicklungen der Mittelverteilungsmodelle, beginnend mit der Kameralistik bis hin zur Formelgebundenen Mittelverteilung. Dabei werden die einzelnen Verfahren, ihre Funktionsweise und die zugrundeliegenden Prinzipien erläutert. Kapitel drei analysiert die Formelgebundene Mittelverteilung kritisch. Es werden die einzelnen Indikatoren, ihre Stärken und Schwächen, sowie deren Auswirkungen auf die Mittelzuweisung untersucht. Kapitel vier zeigt die Anwendung des Modells auf Landesebene in Mecklenburg-Vorpommern und auf universitätsinterner Ebene an der Universität Rostock. Schließlich werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und die wichtigsten Schlussfolgerungen gezogen.
Schlüsselwörter
Formelgebundene Mittelverteilung, Globalhaushalt, Hochschulfinanzierung, Mittelverteilung, Indikatoren, Kritik, Mecklenburg-Vorpommern, Universität Rostock, Forschung, Lehre, Leistungsbezogene Zuweisung, Volumenbezogene Zuweisung, Strukturbezogene Zuweisung.
- Quote paper
- Lutz Schäfer (Author), 2005, Globalhaushalt und die universitätsinterne Mittelverteilung - eine kritische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45316