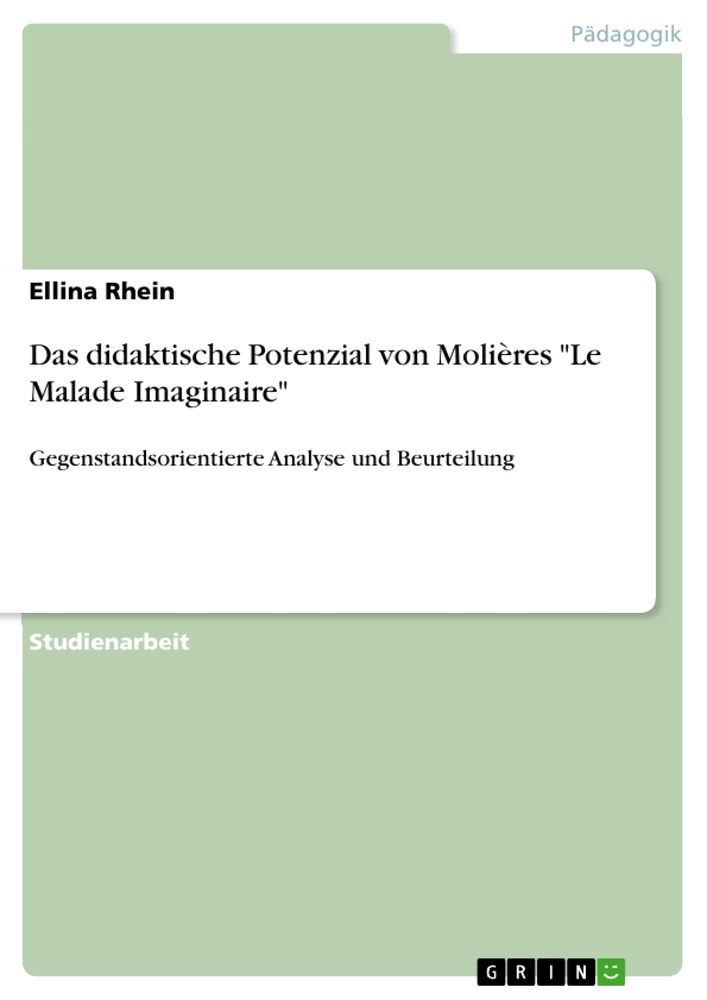In dieser Arbeit soll anhand von Molières "Le Malade imaginaire" analysiert werden, ob und inwiefern die Lektüre literarischer Texte im Französischunterricht des Gymnasiums bzw. der Gesamtschule sinnvoll sind und ob es angemessene Unterrichtsmaterialien gibt, die bedenkenlos von Lehrern genutzt werden können. Es soll aufgezeigt werden, welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen bei der Bearbeitung möglich sind, aber auch welche Bereicherung die Lektüre klassischer Texte und Molières Theaterstück im Besonderen sein können.
Ich habe mich konkret für diesen literarischen Text entschieden, da er oft im Unterricht gelesen wird, er also eine ‚typische Schullektüre‘ ist. Bisweilen ist der Text aus dem Deutschunterricht der Mittelstufe bekannt, in dem er u.a. dazu verwendet wird, das Stück mit der Klasse auf der Bühne aufzuführen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob der Text für den Französischunterricht geeignet ist, oder ob dessen Lektüre eine Tradition ist, die niemand wagt zu durchbrechen.
Bevor ich jedoch in meiner Analyse auf das Theaterstück selbst eingehe, möchte ich vorher mit Prof. Dr. Lieselotte Steinbrügge und Dieter Wolff zwei Theoretiker anführen, die sich allgemein mit dem didaktischen Potenzial literarischer Texte befasst haben. Denn die Verwendung solcher Texte im Fremdsprachenunterricht ist umstritten, weil die eingesetzte Literatur oft sogenannte Klassiker sind – diesen aber fehlt vordergründig die Aktualität. Es wird zudem behauptet, dass Schülerinnen und Schüler keinen Bezug zu solch‘ klassischen Texten aufbauen können und dass sie sich doch erst einmal mit dem System der Sprache auseinandersetzen und zunächst den Signifikanten verstehen müssen, bevor man sie an Interpretationen heranführen würde. Dementgegen führen Steinbrügge und Wolff überzeugende Argumente für die Arbeit mit literarischen Texten im Unterricht an, die im Folgenden präsentiert und an Molières "Le Malade imaginaire" angewendet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Warum literarische Texte im Französischunterricht?
- 1.2. Molières „Le Malade imaginaire“ – Inhaltliche Zusammenfassung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Analyse des Textes aus didaktischer Perspektive
- 2.2. Vorstellung und Beurteilung des Unterrichtsmaterials
- 3. Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das didaktische Potenzial von Molières „Le Malade imaginaire“ im Französischunterricht. Es wird analysiert, ob und wie die Lektüre literarischer Texte sinnvoll ist und ob adäquates Unterrichtsmaterial existiert. Schwierigkeiten und Herausforderungen der Bearbeitung werden ebenso beleuchtet wie der mögliche Gewinn durch die Beschäftigung mit klassischen Texten.
- Didaktisches Potenzial literarischer Texte im Französischunterricht
- Analyse von Molières „Le Malade imaginaire“ aus didaktischer Sicht
- Bewertung existierenden Unterrichtsmaterials
- Herausforderungen und Chancen beim Einsatz klassischer Texte
- Relevanz literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Wahl von Molières „Le Malade imaginaire“ als Fallbeispiel. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Sinnhaftigkeit literarischer Texte im Französischunterricht und der Qualität verfügbaren Unterrichtsmaterials. Die Autorin erwähnt die Kontroverse um den Einsatz klassischer Texte im Unterricht und kündigt die Anwendung theoretischer Ansätze von Steinbrügge und Wolff sowie Nieweler an. Abschließend wird die Untersuchung des Unterrichtsmaterials von Hilaire de Vos angekündigt.
1.1. Warum literarische Texte im Französischunterricht?: Dieser Abschnitt präsentiert Argumente von Dieter Wolff für den Einsatz literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht. Wolff bezieht sich auf die Sprachverarbeitungsforschung und hebt den rezeptionsästhetischen Ansatz hervor, der den literarischen Text als offenen, mehrfach interpretierbaren Text versteht. Weitere Argumente beziehen sich auf die „Alternativität“ der Textverarbeitung, den Polyvalenzfaktor literarischer Sprache und die integrative Motivation durch Identifikation mit fiktiven Figuren. Diese Aspekte fördern Sprachkompetenz und Gedächtnisleistung. Der Abschnitt unterstreicht den Mehrwert literarischer Texte gegenüber expositorischen Texten im Fremdsprachenunterricht.
2. Hauptteil: Dieser Teil wird die detaillierte Analyse des Textes aus didaktischer Perspektive und die Vorstellung und Beurteilung des Unterrichtsmaterials beinhalten. Eine detaillierte Zusammenfassung ist aufgrund der Länge des Hauptteils an dieser Stelle nicht möglich. Die Analyse wird die didaktischen Möglichkeiten und Herausforderungen von Molières Stück beleuchten und die Qualität des ausgewählten Unterrichtsmaterials kritisch bewerten, im Hinblick auf seine Angemessenheit und seinen Schwierigkeitsgrad. Die Argumentation wird sich auf die vorangegangenen theoretischen Überlegungen stützen.
Schlüsselwörter
Molière, Le Malade imaginaire, Französischunterricht, Literaturdidaktik, Sprachdidaktik, didaktisches Potenzial, klassische Texte, Unterrichtsmaterial, Sprachverarbeitungsforschung, Rezeptionsästhetik, Textanalyse, Polyvalenz.
Häufig gestellte Fragen zu: Didaktisches Potenzial von Molières „Le Malade imaginaire“ im Französischunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das didaktische Potenzial von Molières Komödie „Le Malade imaginaire“ im Französischunterricht. Sie analysiert, ob und wie die Lektüre literarischer Texte sinnvoll ist und ob adäquates Unterrichtsmaterial existiert. Die Arbeit beleuchtet Schwierigkeiten und Herausforderungen sowie den möglichen Gewinn durch die Beschäftigung mit klassischen Texten im Französischunterricht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Didaktisches Potenzial literarischer Texte im Französischunterricht; Analyse von Molières „Le Malade imaginaire“ aus didaktischer Sicht; Bewertung existierenden Unterrichtsmaterials; Herausforderungen und Chancen beim Einsatz klassischer Texte; und die Relevanz literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Résumé. Die Einleitung begründet die Wahl von „Le Malade imaginaire“ und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Sinnhaftigkeit literarischer Texte im Unterricht und der Qualität des verfügbaren Unterrichtsmaterials. Der Hauptteil analysiert den Text aus didaktischer Perspektive und präsentiert und bewertet Unterrichtsmaterial. Das Résumé fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf theoretische Ansätze von Steinbrügge und Wolff sowie Nieweler. Insbesondere werden die Argumente von Dieter Wolff für den Einsatz literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht berücksichtigt, mit Fokus auf die Sprachverarbeitungsforschung und den rezeptionsästhetischen Ansatz.
Welches Unterrichtsmaterial wird untersucht?
Die Arbeit untersucht das Unterrichtsmaterial von Hilaire de Vos.
Welche Argumente werden für den Einsatz literarischer Texte im Französischunterricht vorgebracht?
Es werden Argumente für den Mehrwert literarischer Texte gegenüber expositorischen Texten im Fremdsprachenunterricht angeführt. Diese basieren auf der Sprachverarbeitungsforschung und dem rezeptionsästhetischen Ansatz, der den literarischen Text als offenen, mehrfach interpretierbaren Text versteht. Weitere Argumente beziehen sich auf die „Alternativität“ der Textverarbeitung, den Polyvalenzfaktor literarischer Sprache und die integrative Motivation durch Identifikation mit fiktiven Figuren, welche Sprachkompetenz und Gedächtnisleistung fördern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Molière, Le Malade imaginaire, Französischunterricht, Literaturdidaktik, Sprachdidaktik, didaktisches Potenzial, klassische Texte, Unterrichtsmaterial, Sprachverarbeitungsforschung, Rezeptionsästhetik, Textanalyse, Polyvalenz.
Wie wird der Hauptteil der Arbeit strukturiert?
Der Hauptteil beinhaltet eine detaillierte Analyse von „Le Malade imaginaire“ aus didaktischer Perspektive und eine kritische Bewertung des untersuchten Unterrichtsmaterials hinsichtlich seiner Angemessenheit und seines Schwierigkeitsgrades. Die Argumentation stützt sich auf die in der Einleitung dargestellten theoretischen Überlegungen.
- Quote paper
- Ellina Rhein (Author), 2016, Das didaktische Potenzial von Molières "Le Malade Imaginaire", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/453108