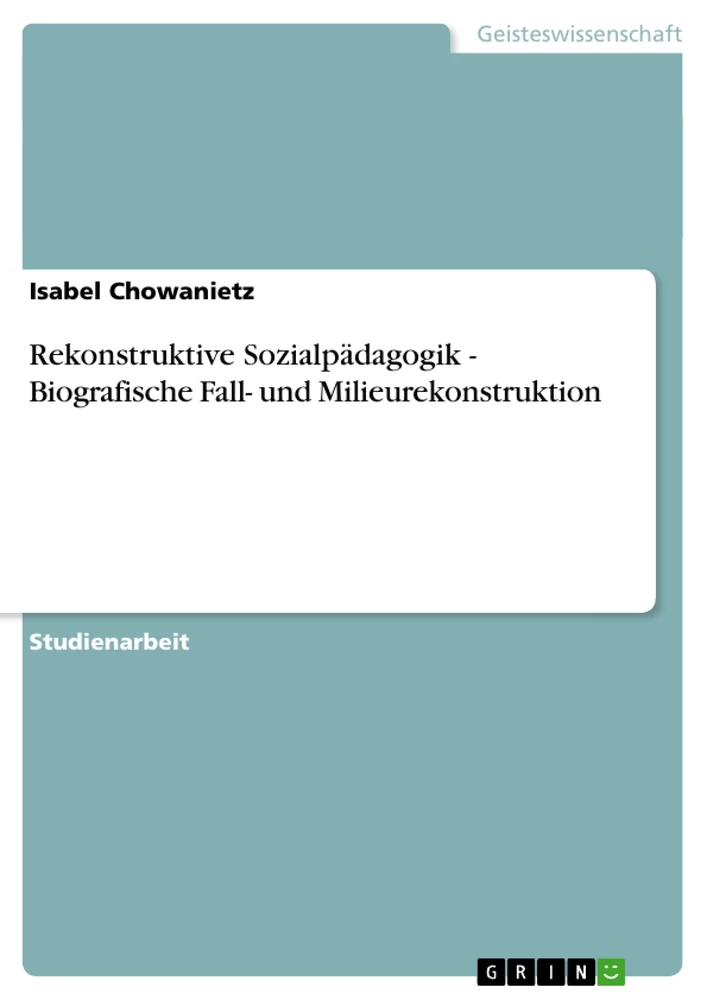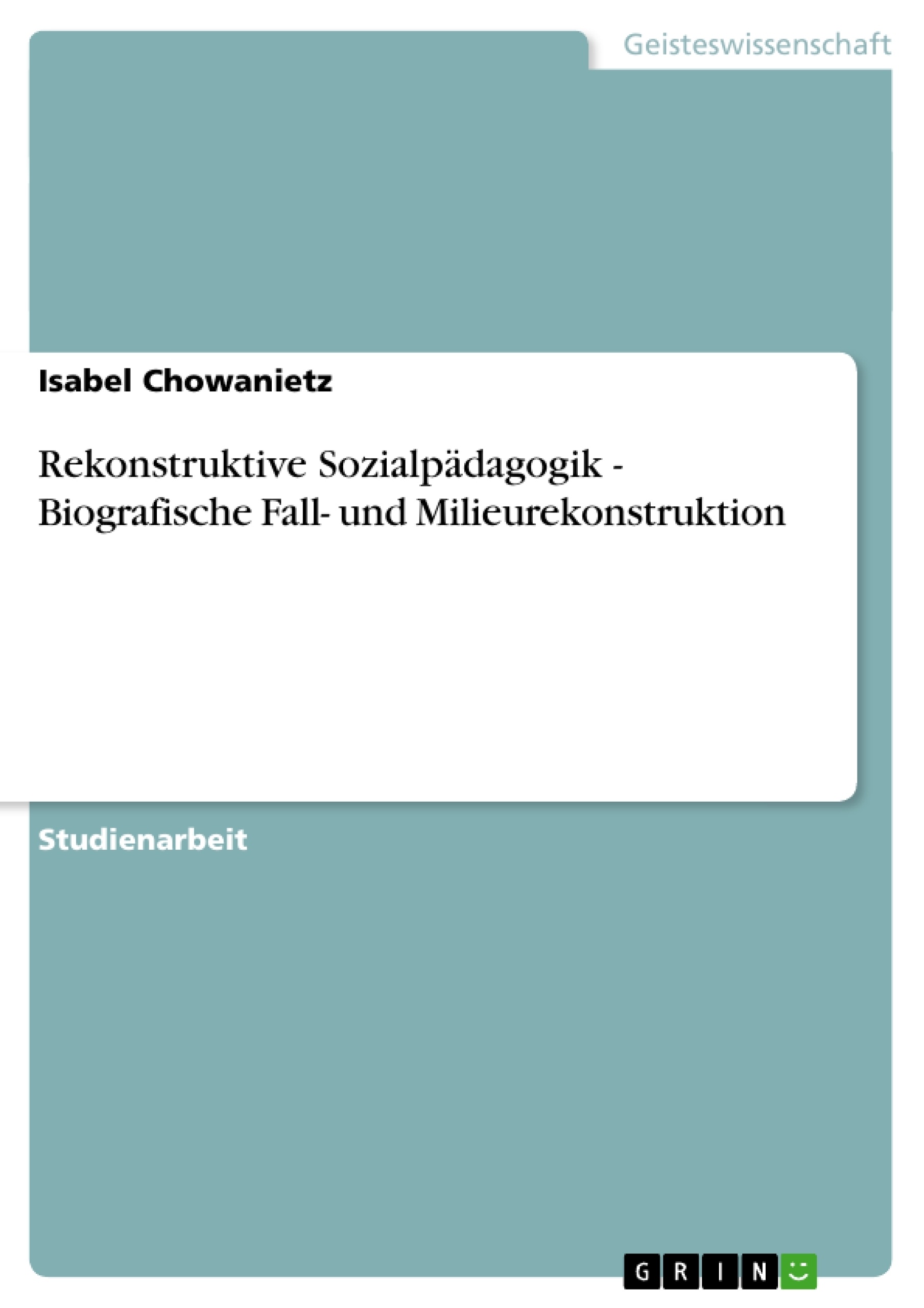In dem Seminar „Diagnose und Fallverstehen in der Sozialpädagogik“ beleuchteten wir verschiedene Aspekte der sozialpädagogischen Fallarbeit, um einen detaillierten Überblick über die verschiedenen Facetten dieser Tätigkeit zu bekommen.
Zunächst mussten wir in diesem Zusammenhang klären, was überhaupt ein „Fall“ ist und wie er entsteht. Wir hielten fest, dass ein Fall ein Konstrukt eines Beobachters ist, der mit der Darstellung des Falles ein bestimmtes Interesse verfolgt. Wann man überhaupt von einem Fall sprechen kann, bringen Ulrike Loch und Heidrun Schulz auf den Punkt. Sie sagen, dass in dem Moment, in dem ein potentieller Klient Kontakt mit z.B. einer Beratungsstelle aufnimmt, eine Begegnung im institutionellen Rahmen stattfindet und sich der Professionelle entsprechend seiner institutionellen und fachspezifischen Differenzierung dem Klienten zuwendet, man von einem „Fall“ sprechen kann. Erst durch dieses In-Beziehung-Setzen entstehe ein Fall. Wir hielten weiter fest, dass die Grundlage eines Falles ein bestimmtes Geschehen, ein Ereignis, eine Szene oder auch ein Gespräch ist. Der Beobachter nimmt dieses Geschehen wahr und formuliert oder dokumentiert es. Dies kann er mittels eines Berichts, eines Tonbandes oder Videos tun. Auch bereits vorhandene Akten o.ä. werden zur Hilfe genommen. Der daraus entstandene Fallbericht wird mit einer bestimmten Absicht präsentiert. Im Anschluss folgt die Fallanalyse, in der Hypothesen für Erklärungsansätze gebildet werden. Danach kommt es zur Fallstudie, in der eine genaue Analyse vorgenommen, eine Intervention geplant und abschließend bzw. laufend Evaluation betrieben wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Was ist ein Fall und wie entsteht er?
- Rekonstruktive Sozialpädagogik
- Ziele und Anforderungen der Rekonstruktiven Sozialpädagogik
- Die biografische Fall- und Milieurekonstruktion im Sinne einer Rekonstruktiven Sozialpädagogik
- Narrativ-biografische Verfahren
- Das narrative Interview und die Ergebnisanalyse
- Die Bedeutung der Rekonstruktiven Sozialpädagogik und der biografischen Fall- und Milieurekonstruktion für die Soziale Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung widmet sich der Rekonstruktiven Sozialpädagogik und der biografischen Fall- und Milieurekonstruktion. Sie zielt darauf ab, die Konzepte dieser Ansätze zu erläutern und deren Bedeutung für die Soziale Arbeit aufzuzeigen.
- Das Entstehen und die Bedeutung eines „Falls“ in der Sozialpädagogik
- Die Rekonstruktive Sozialpädagogik als methodischer Ansatz zur Interpretation der Wirklichkeit
- Die biografische Fall- und Milieurekonstruktion als Verfahren zur Rekonstruktion subjektiver Lebenswelten
- Die Bedeutung dieser Ansätze für die professionelle Handlungspraxis in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung - Was ist ein Fall und wie entsteht er?: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff „Fall“ in der Sozialpädagogik und zeigt auf, wie er durch die Interaktion von Beobachter und Klient entsteht. Es beschreibt die Konstruktion eines Falls anhand eines Beispiels aus der Arbeit eines Jugendamtes.
- Rekonstruktive Sozialpädagogik: Hier wird die Rekonstruktive Sozialpädagogik als ein methodischer Ansatz zur Interpretation der Wirklichkeit eingeführt. Der Fokus liegt auf dem Verstehen und der Interpretation der Lebenswelt von Klienten als eine von handelnden Subjekten konstruierte Wirklichkeit.
- Die biografische Fall- und Milieurekonstruktion im Sinne einer Rekonstruktiven Sozialpädagogik: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den narrativ-biografischen Verfahren der Rekonstruktiven Sozialpädagogik. Besonders wird das narrative Interview und die Ergebnisanalyse vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Ausarbeitung befasst sich mit zentralen Begriffen der Sozialpädagogik wie Fallarbeit, Rekonstruktive Sozialpädagogik, biografische Fall- und Milieurekonstruktion, narrative Interviews, Ergebnisanalyse und professionelle Handlungspraxis in der Sozialen Arbeit.
- Quote paper
- Isabel Chowanietz (Author), 2004, Rekonstruktive Sozialpädagogik - Biografische Fall- und Milieurekonstruktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45280